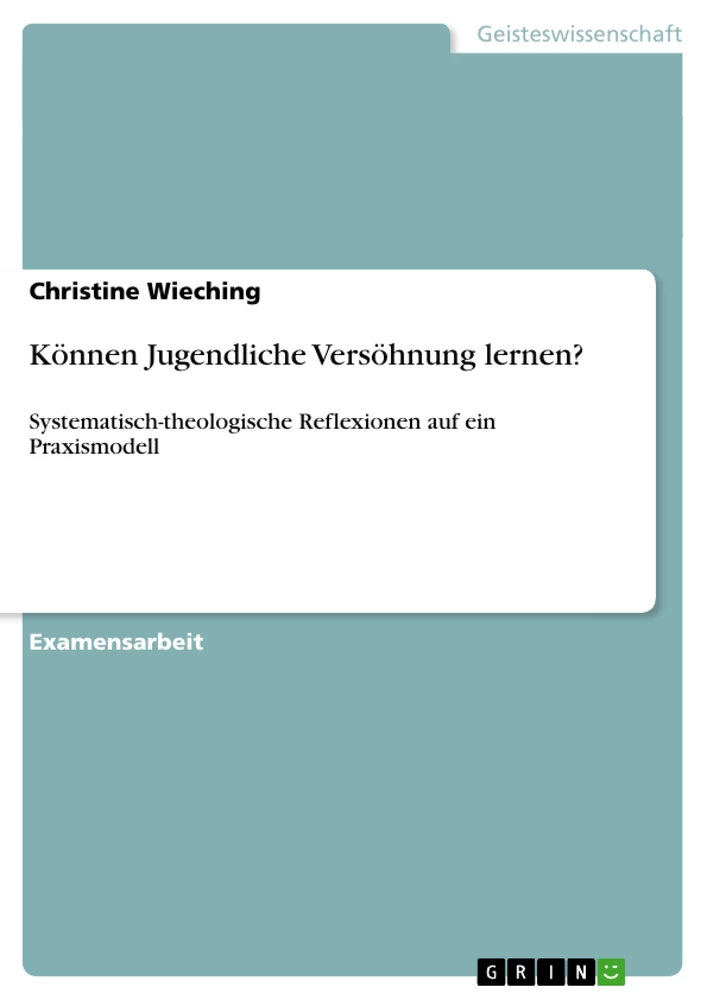In dieser Examensarbeit geht es um die systematisch-theologische Reflexion des sozialen Kompetenztrainings "Identität und Wertschätzung, Achtsamkeit und Anerkennung". In der Arbeit wird zunächst das soziale Kompetenztraining ausführlich mit seinen Übungen und Zielen beschrieben. Dabei handelt es sich um acht Unterrichtseinheiten, die in jeder Stunde einen anderen Schwerpunkt behandeln, z.B. Gefühle oder Konflikte lösen. Das Kompetenztraining wurde mit Schülern durch einen Fragebogen evaluiert. Die Ergebnisse der Evaluation werden im Anschluss vorgestellt.
Im nächsten Teil der Arbeit geht es um die entwicklungspsychologische Betrachtung eines sozialen Kompetenztrainings. Dabei werden die Stufen der moralischen Entwicklung nach Lawrence Kohlberg auf das Praxismodell angewandt. Es geht insbesondere um die Frage, ob Jugendliche im Alter von 13 bzw. 14 Jahren in der Lage sind, moralische Urteile zu fällen und sich damit während eines sozialen Kompetenztrainings von einer niedrigeren moralischen Urteilsstufe nach Kohlberg auf eine höhere Stufe entwickeln können. Die moralische Entwicklung der Jugendlichen dient dabei als Indikator für versöhnendes Handeln.
Im dritten Teilbereich dieser Arbeit geht es um die ökumenische Perspektive, speziell um das Thema "in Beziehung Heil werden". Mit dem Training soll die Sozialkompetenz der Jugendlichen verbessert werden, wodurch auch ein Beitrag zur versöhnenden Einheit der Menschen geleistet werden kann. Das Kompetenztraining wird auf die fünf Akte der dramatischen Erlösungslehre nach Raymund Schwager angewendet. Es handelt sich dabei um die relationale Soteriologie, d.h. um die Beziehungen der Menschen untereinander und zu Gott. Ein Mensch wendet sich durch die Sünde von Gott ab und unterbricht die Beziehung. Der soteriologische Grundgedanke liegt in der Beziehungsfähigkeit Gottes zu den Menschen. Dies zeigt sich vor allem in der Heilsgeschichte, denn Gottes Beziehungsfähigkeit überwindet hier die Sünde und den Tod. Gott wendet sich den Sündern stets zu. Auch in der gegenwärtigen Zeit kämpfen nicht nur Jugendliche mit Ausgrenzung und Ablehnung. Nur mit der versöhnungsbereitschaft im Sinne Gottes, so wie in der Heilsgeschichte Jesus Christus, können Beziehungen in einer Gemeinschaft aufgebaut werden. Jesus Christus verurteilt die Sünder nicht, sondern verkündet stets die Gottesherrschaft als neue Gemeinschaft und Beziehung zwischen Menschen und Gott, die er durch sein Handeln sichtbar macht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Definitorische Abgrenzung
- 2.1 Definition Sünde
- 2.2 Definition Versöhnung
- 2.3 Definition dramatische Erlösung
- 2.4 Konflikt-, Aggressions- und Versöhnungsverständnis in der Schule
- 3 Praxismodell „Identität und Wertschätzung, Achtsamkeit und Anerkennung“
- 3.1 Versöhnung im Praxismodell
- 3.2 Die Grundidee des Praxismodells
- 3.3 Ziele des Modells
- 3.4 Wirkungsziele
- 3.4.1 Ich-Ziele
- 3.4.2 Gemeinschaftsziele
- 3.4.3 Zukunftsziele
- 3.5 Handlungsziele
- 3.6 Stundenaufbau des Modells
- 3.7 Auswertung des Schulprojekts
- 3.8 Zusammenfassung der Auswertung
- 3.9 Persönliche Bewertung des Modells
- 4 Entwicklungspsychologische Betrachtung
- 4.1 Der Begriff Versöhnung auf der Grundlage der Moralentwicklung
- 4.2 Stufen der Moralentwicklung nach Lawrence Kohlberg
- 4.2.1 Die präkonventionelle Stufe
- 4.2.2 Die konventionelle Ebene
- 4.2.3 Die postkonventionelle Ebene
- 4.3 Entwicklung der Kriterien zur Bewertung des Praxismodells
- 4.4 Bewertung des Praxismodells
- 4.5 Auswertung der Ergebnisse
- 5 Theologische Perspektive
- 5.1 Versöhnung und Beziehungsdenken
- 5.2 Die fünf Akte dramatischen Erlösungslehre
- 5.2.1 Erster Akt
- 5.2.1.1 Beziehungsaspekt im ersten Akt
- 5.2.2 Zweiter Akt
- 5.2.2.1 Beziehungsaspekt im zweiten Akt
- 5.2.3 Dritter Akt
- 5.2.3.1 Beziehungsaspekt im dritten Akt
- 5.2.4 Vierter Akt
- 5.2.4.1 Beziehungsaspekt im vierten Akt
- 5.2.5 Fünfter Akt
- 5.2.5.1 Beziehungsaspekt im fünften Akt
- 5.3 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob und wie Jugendliche Versöhnung lernen können. Sie analysiert ein Praxismodell zur Förderung sozialer Kompetenzen und beleuchtet die Thematik aus entwicklungspsychologischer und theologischer Perspektive. Ziel ist es, den Einfluss des Modells auf moralische Urteilsbildung und versöhnendes Handeln zu evaluieren.
- Definition und Verständnis von Sünde, Versöhnung und dramatischer Erlösung im Kontext des Jugendalters
- Analyse eines Praxismodells zur Förderung von Versöhnung und sozialen Kompetenzen in der Schule
- Entwicklungspsychologische Betrachtung der Moralentwicklung nach Kohlberg und deren Relevanz für das Praxismodell
- Theologische Reflexion von Versöhnung und Beziehungsdenken im Kontext des christlichen Glaubens
- Bewertung der Wirksamkeit des Praxismodells zur Förderung versöhnenden Handelns bei Jugendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Arbeit beginnt mit der Schilderung des Amoklaufs von Winnenden als drastisches Beispiel für die Notwendigkeit, Versöhnung und soziales Handeln bei Jugendlichen zu fördern. Sie thematisiert die Krise des christlichen Glaubens angesichts solcher Ereignisse und stellt die Frage nach dem Lernprozess von Versöhnung im Schulalltag. Die Arbeit kündigt die Betrachtung des Praxismodells aus verschiedenen Perspektiven an: Praxis, Entwicklungspsychologie und Theologie.
2 Definitorische Abgrenzung: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe Sünde, Versöhnung und dramatische Erlösung. Es legt die jeweiligen Definitionen dar und bezieht diese auf die Lebenswelt von Jugendlichen. Die Bedeutung von Konflikt, Aggression und Versöhnung im schulischen Kontext wird ebenfalls beleuchtet, um einen fundierten Rahmen für die spätere Analyse des Praxismodells zu schaffen. Die Definitionen dienen als Grundlage für die anschließende Diskussion und Bewertung des Praxismodells.
3 Praxismodell „Identität und Wertschätzung, Achtsamkeit und Anerkennung“: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Praxismodell, seine Ziele (Ich-, Gemeinschafts- und Zukunftsziele) und den Stundenaufbau. Es erläutert die Grundidee des Modells und stellt die Auswertung des Schulprojekts vor. Die Zusammenfassung der Auswertung und eine persönliche Bewertung des Modells runden dieses Kapitel ab. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des Modells und seiner praktischen Umsetzung sowie den daraus gewonnenen Erkenntnissen über die Förderung von Sozialkompetenzen bei Jugendlichen.
4 Entwicklungspsychologische Betrachtung: Dieses Kapitel untersucht den Begriff Versöhnung im Kontext der Moralentwicklung nach Kohlberg. Es analysiert die verschiedenen Stufen der Moralentwicklung und bewertet, inwieweit das Praxismodell die moralische Urteilsbildung und damit versöhnendes Handeln fördern kann. Die Auswertung der Ergebnisse liefert Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen dem Modell und der Entwicklung moralischen Urteilsvermögens bei Jugendlichen.
5 Theologische Perspektive: Der Abschnitt beleuchtet das Thema Versöhnung aus theologischer Sicht. Er erörtert die Bedeutung von Versöhnung und Beziehungsdenken im christlichen Glauben und analysiert die fünf Akte der dramatischen Erlösungslehre im Hinblick auf ihre Relevanz für die Förderung von Versöhnung. Der Beziehungsaspekt in jedem Akt wird besonders herausgestellt, um ein umfassendes Verständnis der theologischen Perspektive auf Versöhnung zu entwickeln. Die Zusammenfassung integriert die Erkenntnisse aus der theologischen Perspektive in den Gesamtkontext der Arbeit.
Schlüsselwörter
Versöhnung, Jugendliche, Praxismodell, Moralentwicklung, Kohlberg, Theologie, Sozialkompetenz, Entwicklungspsychologie, dramatische Erlösung, Sünde, Achtsamkeit, Wertschätzung, Konfliktlösung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Versöhnung lernen im Jugendalter
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht, ob und wie Jugendliche Versöhnung lernen können. Sie analysiert ein Praxismodell zur Förderung sozialer Kompetenzen und beleuchtet die Thematik aus entwicklungspsychologischer und theologischer Perspektive. Das zentrale Ziel ist die Evaluierung des Einflusses des Modells auf moralische Urteilsbildung und versöhnendes Handeln.
Welche Begriffe werden in der Arbeit definiert?
Die Arbeit definiert die Schlüsselbegriffe Sünde, Versöhnung und dramatische Erlösung im Kontext des Jugendalters und beleuchtet deren Bedeutung im schulischen Kontext hinsichtlich Konflikt, Aggression und Versöhnung.
Welches Praxismodell wird analysiert?
Die Arbeit analysiert das Praxismodell „Identität und Wertschätzung, Achtsamkeit und Anerkennung“. Das Kapitel beschreibt detailliert das Modell, seine Ziele (Ich-, Gemeinschafts- und Zukunftsziele), den Stundenaufbau, die Auswertung des Schulprojekts und bietet eine persönliche Bewertung.
Welche Entwicklungspsychologische Theorie wird angewendet?
Die Arbeit nutzt die Stufen der Moralentwicklung nach Lawrence Kohlberg, um den Begriff Versöhnung im Kontext der Moralentwicklung zu untersuchen und zu bewerten, inwieweit das Praxismodell die moralische Urteilsbildung und damit versöhnendes Handeln fördern kann. Die Auswertung der Ergebnisse liefert Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen Modell und der Entwicklung moralischen Urteilsvermögens bei Jugendlichen.
Welche theologische Perspektive wird eingenommen?
Die Arbeit beleuchtet Versöhnung aus theologischer Sicht, erörtert die Bedeutung von Versöhnung und Beziehungsdenken im christlichen Glauben und analysiert die fünf Akte der dramatischen Erlösungslehre in Bezug auf die Förderung von Versöhnung. Der Beziehungsaspekt in jedem Akt wird besonders hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Versöhnung, Jugendliche, Praxismodell, Moralentwicklung, Kohlberg, Theologie, Sozialkompetenz, Entwicklungspsychologie, dramatische Erlösung, Sünde, Achtsamkeit, Wertschätzung, Konfliktlösung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, definitorische Abgrenzung, Beschreibung des Praxismodells, entwicklungspsychologische Betrachtung und theologische Perspektive. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Aspekte und deren Relevanz für das Thema Versöhnung im Jugendalter.
Welche Ergebnisse liefert die Arbeit?
Die Arbeit liefert Erkenntnisse über den Einfluss des Praxismodells auf die moralische Urteilsbildung und das versöhnende Handeln von Jugendlichen. Sie bietet eine umfassende Analyse aus praxisorientierter, entwicklungspsychologischer und theologischer Perspektive.
Wie beginnt die Arbeit?
Die Arbeit beginnt mit einer Schilderung des Amoklaufs von Winnenden als drastisches Beispiel für die Notwendigkeit, Versöhnung und soziales Handeln bei Jugendlichen zu fördern. Sie thematisiert die Krise des christlichen Glaubens angesichts solcher Ereignisse und stellt die Frage nach dem Lernprozess von Versöhnung im Schulalltag.
Welche Zusammenfassung der Kapitel bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, welche die Kernaussagen und Ergebnisse jedes Kapitels prägnant darstellen und den Lesefluss verbessern.
- Quote paper
- Christine Wieching (Author), 2009, Können Jugendliche Versöhnung lernen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137832