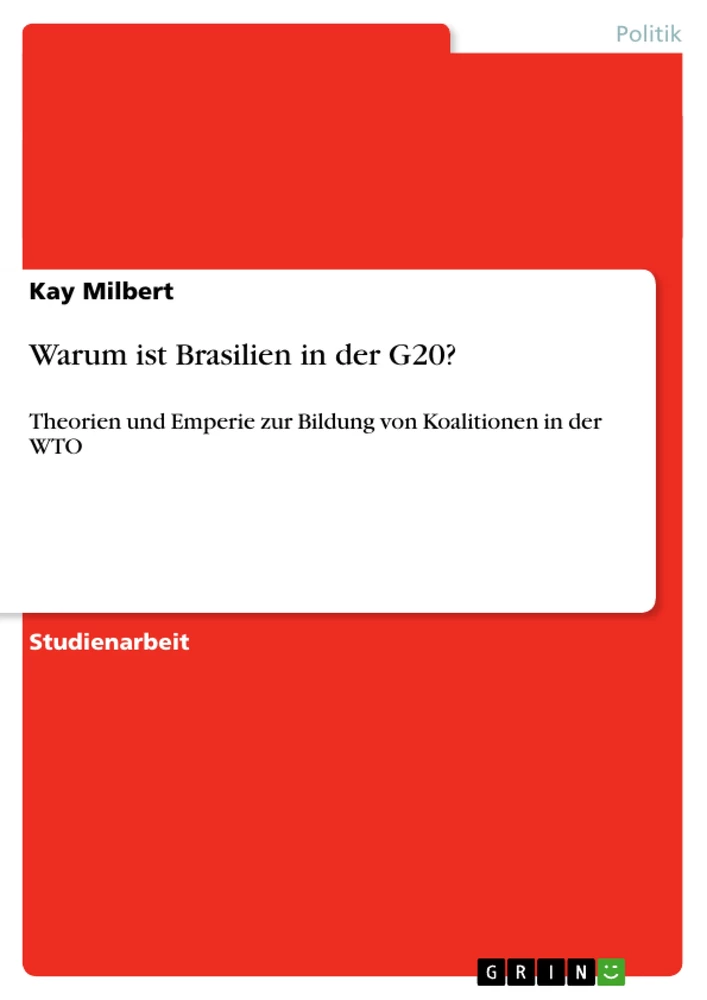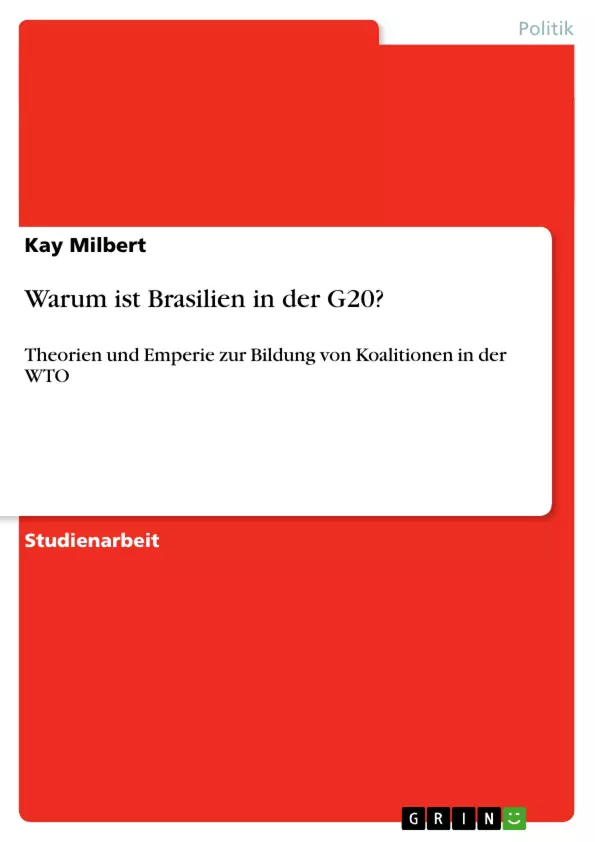Diese Hausarbeit stellt die Frage, warum Brasilien in der G20 ist. G20 meint hierbei eine Gruppe von Entwicklungs - und Agraländern in der WTO. Die Mitgliedschaft in der G20 wird im Hinblick auf das Streben nach Macht und Einfluss Brasilien und der anderen G20-Mitglieder untersucht. Dabei wird wird der Einfluss von Interessegruppen und Verbänden auf Streben nach Macht und Einfluss eingeganben. Außerdem wird überprüft ob die Interessengruppen und Verbände der anderen Mitglieder der G20 ähnliche Interessen verfolgen.
Inhaltsverzeichnis
1 Abkürzungen
2 Einleitung
2.1 Was ist die G 20?
2.2 Fragestellungen und Hypothesen der Seminararbeit
3 Brasiliens streben nach Macht und Einfluss
3.1 Theorie kurz gefasst
3.2 Das Streben nach sozialer und wirtschaftlicher Macht Brasiliens
3.3 Zwischen-Fazit
4 Aussenpolitik als Reflex der Innenpolitik
4.1 Öffnung der Blackbox
4.2 Macht und Einfluss von Verbänden und Interessensgruppen
4.3 Ist die Situation der Landwirtschaft in den anderen G20-Staaten vergleichbar?
5 Ergebnisse der Untersuchung
5.1 Zusammenfassung
5.2 Offene Fragen und Kritik
5.3 Ausblicke
Quellen
1 Abkürzungen
illustration not visible in this excerpt
(Eigene Darstellung: )
2 Einleitung
2.1 Was ist die G 20?
Die G20[1] möchte nach Aussagen der eigenen Internetseite Agrar - und Entwicklungsländer eine stärkere Stimme in der WTO verleihen, da sich die G20 als Interessenvertretung von 70% der von der Landwirtschaft abhängigen Weltbevölkerung und 26% der gesamten Agrarproduktion versteht. Sie hat Mitglieder aus 3 Kontinenten: Asien, Lateinamerika, Afrika. Die Zusammensetzung der Mitglieder ändert sich immer wieder. Die G20 ist also keine feste Gruppe. Zum Zeitpunkt der Verhandlungen in Cancun gehörten folgenden Staaten zur G20[2]: Ägypten, Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, China, Indien, Indonesien, Kuba, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Philippinen, Simbabwe, Südafrika, Tansania, Thailand und Venezuela.
Nach Angaben der G20[3] wurde sie von einigen Schwellenländern während der WTO-Verhandlung in Cancún am 20.08.2003 gegründet, um den Agrar – und Entwicklungsländern eine angemessene Stimme in der WTO zu geben. Die G20[4] schreibt dazu: „The G-20 is a group of developing countries established on 20 August 2003, in the final stages of the preparations for the V Ministerial Conference of the WTO, held in Cancun, from 10 to 14 September 2003. Its focus is on agriculture, the central issue of the Doha Development Agenda.[..]“ Grund für die Entstehung[5] der G20 war ein von der USA und der EU ausgearbeitetes Agrarabkommen zu verhindern, da einige Entwicklungsländer ihre Interessen durch dieses Abkommen nicht ausreichend vertreten sahen. Außerdem verhinderte die G20 erfolgreich die Diskussion der Singapur-Themen[6], wie auf an ihren Forderungskatalog (siehe Tab. 1) deutlich wird. Die Verhandlung dieser Themen scheiterte schon vor der Gründung der G20 – während der Doha-Runde -, an den Widerstand einiger Entwicklungsländer. Ob die G 20 den Anspruch die Entwicklungsländer in der WTO zu vertreten gerecht wird, ist umstritten; so gibt es z.B. eine weitere Interessenvertretung der ärmsten Länder der Erde in der WTO, die G90. Auch Bösl[7] und Reuter weisen darauf hin, dass die G20 als Vertretung der Entwicklungsländer umstritten ist: „[...] Ob sie jedoch Anführer der Entwicklungsländer und somit deren Anwalt sind, ist ungeklärt“ Der Punkt, ob die G20 diesem Anspruch gerecht wird, wird im Rahmen dieser Hausarbeit nicht diskutiert.
Brasilien gehört mit zu der so genannten G3, die als Kopf der G20 gesehen wird. Die G3 sprechen nicht nur in der WTO zum großen Teil mit einer Stimme sondern haben auch weitere gemeinsame machtpolitische Interessen. Zur G3 gehören Brasilien, Indien und Südafrika. Die Staaten der G3 setzen sich zusammen für einen ständigen Sitz für Brasilien und Indien im Weltsicherheitsrat ein.
Wegen der Mitgliedschaft Brasiliens in der G3 und der G20 spielt die Frage nach Macht - und Einfluss-Zugewinn Brasiliens durch Bündnisse eine wichtige Rolle. Die Frage nach Macht und Einfluss durch Bündnisse wird vom Neorealismus theoretisch untersucht.
Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, welche endogene Faktoren in Brasilien zum Bedürfnis führen, mehr Macht und größeren Einfluss zu bekommen.
Die Frage nach dem Grund in der Mitgliedschaft in der G20 ist deshalb wichtig, weil dieses Bündnis in Stande ist zum Scheitern oder Gelingen von WTO-Verhandlungen bei zu tragen, wie sich am Beispiel von Cancun[8] zeigte.
Tab. 1
Forderungen der G20:
l Ein stärkerer Abbau von Exportsubventionen,
direkten Agrarhilfen und Zöllen von der Europäischen
Union (EU) und den Vereinigten Staaten
(USA)
l Keine Behandlung der Singapur-Themen, solange
keine substanziellen Ergebnisse beim Abbau
von Agrarsubventionen erzielt wurden.30)
(Quelle: Bösl, Anton/Reuter, Patrick:Ein Jahr
nach Cancún: War das Scheitern ein Erfolg für die Entwicklungsländer?
Perspektiven für eine marktwirtschaftlich orientierte Entwicklungspolitik)
2.2 Fragestellungen und Hypothesen der Seminararbeit
Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit den Gründen, warum Brasilien in der G20 ist. Die Gründe werden zum einen unter neo-realistischen Gesichtspunkten gesucht, da Brasilien nach Macht und Einfluss strebt, zum anderen wird eine liberalistische Perspektive hinzu gezogen um zu untersuchen, ob innere Faktoren in Brasilien für das Streben nach Macht und Einfluss eine Rolle spielen.
Hypothesen im Bezug auf das Streben nach Macht und Einfluss
H. 1: Die Entwicklungsländer und Schwellenländer bekamen bis 1999[9] bei den Verhandlungen in der WTO und Vorgänger-Organen kaum Möglichkeiten zur Einflussnahme. Auch nach der stärkeren Einbindung der Entwicklungsländer in die WTO wurden die Erwartungen nach Wilhelm Hofmeister[10] der Entwicklungsländer nicht erfüllt. Da sich z. B. die Anteile ihrer Regionen am Welthandel kaum änderten. Um ihren Interessen mehr Gewicht zu geben, schlossen sich die betroffenen Länder in der G20 zusammen.
Als Kopf der G20 wird die G3 gesehen.
Die Mitgliedschaft in der G3 zeigt, das Brasilien nach Macht und Einfluss in der Weltpolitik strebt, da die G3 nicht nur versucht auf die internationale Handelspolitik zu beeinflussen, sondern auch gemeinsame Sicherheitsinteressen hat, wie im nächsten Kapitel deutlich wird.
Die 1. Hypothese ist, das Brasilien und andere Entwicklungsländer nach Einfluss
und Macht streben, weil ihnen der Einfluss lange Zeit fehlte. (s. o,)
H. 2: Da Brasilien eine Demokratie ist, und Demokratien nicht als Blackbox[11] betrachtet werden können, wie an der Kritik am Neo-Realismus deutlich wird, ist anzunehmen, dass die neo-realistische Theorie das Streben nach Macht und Einfluss nicht allein erklären kann. Deshalb ist zu überprüfen, in wie weit im Fall Brasilien, die Außenpolitik ein Reflex der Innenpolitik[12] ist.
H. 3 Brasilien und die anderen G20 Staaten haben ein ähnliches bestreben nach wirtschaftlicher und sozialer Macht und endogene eine ähnliche Struktur von Interessensgruppen und Verbänden. Durch das Bündnis wurden die ähnlichen Interessen gebündelt
Da sich während der Arbeit an den Thema „Warum ist Brasilien in der G20“ erwiesen hat, dass diese Thema für eine Seminararbeit inhaltlich nicht genug her gibt, wird im Kapitel „Ergebnisse der Untersuchung“ im Unterkapitel „Ausblicke“ auf die Auswirkungen eingegangen, die das Bündnis auf den Multilateralismus und den Welthandel hat.
3 Brasiliens streben nach Macht und Einfluss
3.1 Theorie kurz gefasst
Nach der neo-realistischen Theorie von Walz[13] streben alle Staaten nach Macht und Einfluss um im internationalen anarchischen System zu überleben, deshalb sind die Akteure im Internationalen System bestrebt Macht Unterschiede und Bedrohungen aus zu gleichen. Darum gilt die Sicherheit eines Staates aus Sicht dieser Theorie als oberste Priorität aller außenpolitischen Handlungen eines Staates[14]. Alle anderen Felder der Außenpolitik sind unwichtiger als die Wahrung der Sicherheit, auch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den verschiedenen Staaten. Das Streben nach Macht und Einfluss bezieht sich nicht nur auf militärische Macht, sondern auch auf ökonomische und soziale Macht[15]. Da diese Theorie für alle Staaten gilt, egal welche politisches System sie haben wird der Staat als Akteur und die endogenen Faktoren als Blackbox betrachtet. Der Neorealismus geht nicht auf die spezielle Außenpolitik eines Landes ein, sondern stellt allgemeine Zwänge dar.
[...]
[1] vgl. http://www.g-20.mre.gov.br/history.asp letzer Abruf: 28.07.08 19:45
[2] Angaben von Bösl, Anton/Reuter, Patrick: Ein Jahr nach Cancun: War das Scheitern ein Erfolg für die Entwicklungsländer?, KAS-Auslandsinformationen 10.2004 übernommen
[3] vgl. http://www.g-20.mre.gov.br/history.asp letzer Abruf: 28.07.08 19:45
[4] http://www.g-20.mre.gov.br/history.asp Abruf 02.10.2008
[5] vgl. Wiggerthale, Marita: Wo steht die G-20 in den Agrarverhandlungen?, http://www.fairer-agrarhandel.de/mainpool/data/G-20%Unterausschuss.doc Abruf 29.09.2008 19:00
[6] Singapur-Themen: Investionen, Wettbewerb, öffentliches Beschaffungswesen und Wettbewerb. Sollen für eine Regulierung der protektionistischen Maßnahmen auf diesen Gebieten sorgen. Die Themen haben vor allen für die Länder des Südens Bedeutung.
[7] Bösl, Anton/Reuter ,Patrick: Ein Jahr nach Cancun: War das Scheitern ein Erfolg für die Entwicklungsländer?, KAS-Auslandsinformationen 10.2004, http://www-kas.de Abruf 12.06.08 S.1
[8] vgl. Dieter, Herribert: Die Welthandelsorganisation nach Cancun, Berlin 2003 S. 1
[9] vgl. Bösl, Anton/Reuter, Patrick: Ein Jahr nach Cancun: War das Scheitern ein Erfolg für die Entwicklungsländer?, KAS-Auslandsinformationen 10.2004, http://www-kas.de Abruf 12.06.08 S. 62
[10] vgl. Hofmeister, Wilhelm: Lateinamerika nach Cancun und die Position Brasiliens; KAS-Auslandsinformationen 1.2004 http://www-kas.de Abruf 12.06.08
[11] vgl. Schirm, Stefan A.: Einführung in die Internationalen Beziehungen (Folien) S. 3
[12] vgl. Schirm, Stefan A.: Einführung in die Internationalen Beziehungen (Folien) S. 12
[13] vgl. Schörning, Niklas, in: Theorien der Internationalen Beziehungen, Opladen 2003, S. 61-87
[14] vgl. Schirm, Stefan A.: Einführung in die Internationalen Beziehungen (Folien) S. 2
[15] vgl. Schörning, Niklas, in: Theorien der Internationalen Beziehungen, Opladen 2003, S. 61-87
Häufig gestellte Fragen
Was ist die G20 im Kontext der WTO-Verhandlungen?
In diesem Kontext bezeichnet die G20 eine Gruppe von Agrar- und Entwicklungsländern, die sich 2003 zusammengeschlossen haben, um ihre Interessen gegenüber den USA und der EU in der Welthandelsorganisation (WTO) zu vertreten.
Warum ist Brasilien Mitglied der G20?
Brasilien strebt nach mehr Macht und Einfluss in der Weltpolitik. Durch das Bündnis in der G20 kann das Land seine agrarpolitischen Interessen effektiver gegen die Subventionspolitik der Industrieländer durchsetzen.
Was versteht man unter der "G3"?
Die G3 besteht aus Brasilien, Indien und Südafrika. Diese Staaten gelten als "Kopf" der G20 und verfolgen über den Handel hinaus gemeinsame machtpolitische Ziele, wie etwa ständige Sitze im UN-Sicherheitsrat.
Welche Rolle spielt die Landwirtschaft in der G20?
Die Landwirtschaft ist das zentrale Thema der G20. Die Mitglieder fordern den Abbau von Exportsubventionen und Zöllen in den Industrienationen, um faire Wettbewerbsbedingungen für ihre eigenen Produzenten zu schaffen.
Wie beeinflusst die Innenpolitik Brasiliens seine Rolle in der G20?
Die Arbeit untersucht, inwieweit die brasilianische Außenpolitik ein Reflex der Innenpolitik ist, wobei der Einfluss mächtiger Agrar-Verbände und Interessengruppen eine entscheidende Rolle spielt.
- Quote paper
- Kay Milbert (Author), 2008, Warum ist Brasilien in der G20?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137915