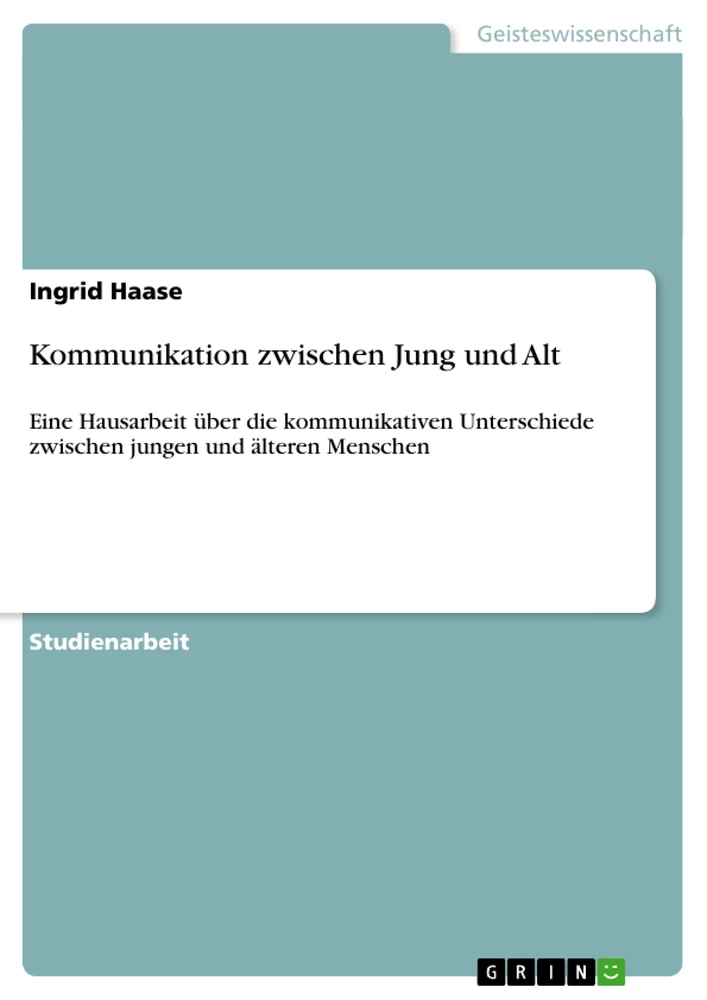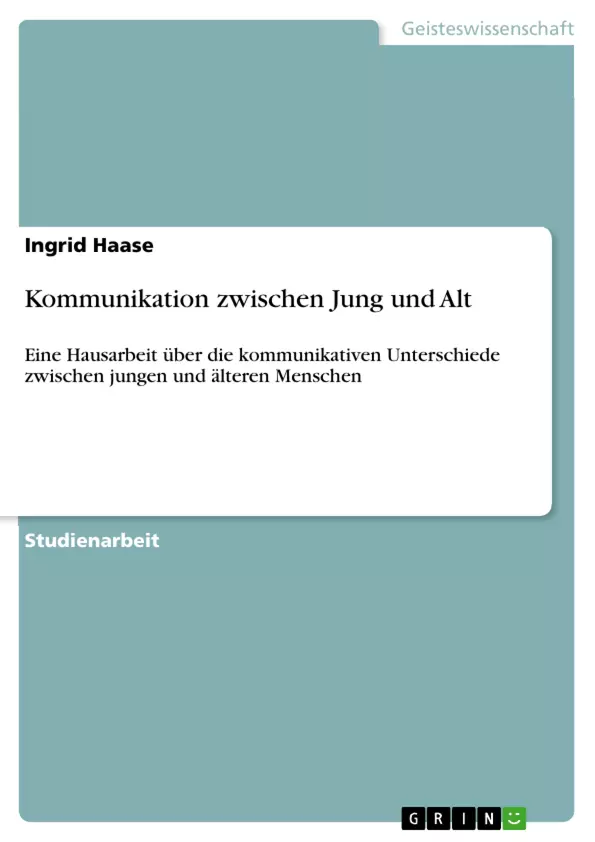Zum Thema “Der Dialog zwischen Jung und Alt” gibt es drei, einander ergänzende Forschungsrichtungen. Die erste befasst sich mit der Frage inwieweit sich ältere Menschen in Bezug auf Sprache, Sprechverhalten und nonverbale Kommunikation zu Jüngeren unterscheiden. Die zweite Forschungshypothese betont den Einfluss des negativen Altersstereotyps. Es wird untersucht welche stereotypen Annahmen bei jüngeren über ältere Menschen bestehen und wie sie sich auf das Sprachverhalten auswirken. Dadurch konnten spezifische Sprechmuster im Umgang mit älteren Menschen identifiziert werden auf die später noch eingegangen wird.
Neue Forschungsarbeiten betonen, Kommunikation sei ein dynamisches Geschehen bei dem sich beide Interaktionspartner wechselseitig beeinflussen.
Die Hausarbeit über die Kommunikation zwischen jungen und alten Menschen beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Strategien, die Junge und Alte in der Kommunikation verwenden, sowie mit auftretenden Kommunikationsproblemen zwischen den beiden Altersgruppen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Perspektiven der Erforschung des Dialogs zwischen Alt und Jung
- 1.1 “Communication predicament of aging Model” (Ryan, Giles, Bartolucci, Henwood, 1986)
- 2. Alterzeichen in der Sprachproduktion und -Rezeption
- 3. Wahrnehmungen älterer “echter” Sprecher
- 4. Gedächtnis, Wortschatz und Sprache
- 5. Strategien sprachlicher Anpassung von Jung und Alt
- 5.1 Kommunikationsverhalten jüngerer Menschen im Dialog mit Älteren
- 5.2 Kommunikationsmuster und Strategien älterer Menschen
- 6. Kommunikationsmuster innerhalb von Institutionen
- 6.1 Determinanten institutioneller Sprech- und Kommunikationsmuster
- 7. Bewertung der Effekte des Kommunikationsverhaltens jüngerer Menschen gegenüber älteren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat untersucht die Kommunikation zwischen jungen und alten Menschen. Es beleuchtet verschiedene Forschungsperspektiven, analysiert altersbedingte Veränderungen in der Sprachproduktion und -rezeption und betrachtet die Rolle von Stereotypen und Anpassungsstrategien im Dialog zwischen den Generationen.
- Unterschiede in der Sprachproduktion und -rezeption zwischen jungen und alten Menschen
- Das "Communication Predicament of Aging Model" und der Teufelskreis der misslungenen Kommunikation
- Einfluss von Altersstereotypen auf das Kommunikationsverhalten
- Anpassungsstrategien im Dialog zwischen Jung und Alt
- Kommunikationsmuster in institutionellen Kontexten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Perspektiven der Erforschung des Dialogs zwischen Alt und Jung: Das Kapitel präsentiert drei Forschungsansätze zum Dialog zwischen Jung und Alt. Der erste fokussiert auf sprachliche und kommunikative Defizite älterer Menschen als Ursache von Verständigungsproblemen. Der zweite betont den Einfluss negativer Altersstereotypen auf das Kommunikationsverhalten Jüngerer. Der dritte Ansatz betrachtet Kommunikation als dynamisches Geschehen, in dem sich beide Interaktionspartner wechselseitig beeinflussen. Situative Wahrnehmungen und stereotype Annahmen spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Die verschiedenen Perspektiven liefern ein umfassendes Bild der Komplexität des Themas.
1.1 “Communication predicament of aging Model” (Ryan, Giles, Bartolucci, Henwood, 1986): Dieses Kapitel beschreibt das "Communication predicament of aging Model", welches einen Teufelskreis aus Altersstereotypen und misslungenen Anpassungsversuchen Jüngerer darstellt. Ausgehend von der Kommunikations-Akkomodationstheorie, wird gezeigt, wie die Wahrnehmung von "Alterszeichen" zu stereotypen Zuschreibungen und übertriebener Anpassung des Sprachverhaltens durch Jüngere führt. Dies wiederum beeinträchtigt das Selbstbild Älterer, was zu sozialem Rückzug und einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung führen kann. Kritische Anmerkungen zum Modell werden ebenfalls einbezogen, die seine Pauschalität und die begrenzte Übertragbarkeit auf natürliche Umgebungen hervorheben.
2. Alterzeichen in der Sprachproduktion und -Rezeption: Dieses Kapitel behandelt altersbedingte Veränderungen im nonverbalen und paraverbalen Bereich. Im nonverbalen Bereich erschwert die Veränderung von Haut und Muskulatur die Interpretation mimischer Ausdrücke. Paraverbale Veränderungen betreffen vor allem die Stimme, mit abnehmender Stimmhöhe bei Männern, Frequenzschwankungen und Veränderungen im Sprechrhythmus. Die Ursachen hierfür werden auf körperliche (z.B. veränderte Kehlkopfkontrolle) und psychische (z.B. erhöhte Anspannung) Faktoren zurückgeführt. Es wird herausgestellt, dass diese Veränderungen nicht zwangsläufig mit beeinträchtigter kommunikativer Kompetenz gleichzusetzen sind.
3. Wahrnehmungen älterer “echter” Sprecher: Dieses Kapitel analysiert die Wahrnehmungen von älteren Sprechern durch jüngere Personen. Studien zeigen, dass ältere Sprecherinnen häufiger als zurückhaltend und passiv, ältere Männer als weniger flexibel eingeschätzt werden. Ältere Personen in Interviews werden als verwirrter und ungenauer wahrgenommen als jüngere. Diese Ergebnisse unterstreichen den Einfluss von Altersstereotypen auf die Interpretation von Kommunikation.
4. Gedächtnis, Wortschatz und Sprache: Das Kapitel widerlegt die Annahme, dass altersbedingte Veränderungen automatisch mit beeinträchtigter kommunikativer Kompetenz einhergehen. Studien belegen, dass ältere und jüngere Menschen eine vergleichbare Organisation des mentalen Lexikons aufweisen. Ältere erzielen mitunter sogar bessere Leistungen bei Worterkennungsaufgaben. Altersdifferenzen treten vor allem unter erhöhten Anforderungen auf, wobei paraverbale Zeichen für ältere Menschen in solchen Situationen eine besondere Bedeutung erlangen.
Schlüsselwörter
Kommunikation, Alter, Sprachproduktion, Sprachrezeption, Altersstereotypen, Anpassungsstrategien, Kommunikationsprädikat des Alterns, Gedächtnis, Wortschatz, Interaktion, Verständigungsprobleme.
Häufig gestellte Fragen zum Referat: Kommunikation zwischen Jung und Alt
Was sind die Hauptthemen des Referats?
Das Referat untersucht die Kommunikation zwischen jungen und alten Menschen. Es beleuchtet verschiedene Forschungsperspektiven, analysiert altersbedingte Veränderungen in der Sprachproduktion und -rezeption und betrachtet die Rolle von Stereotypen und Anpassungsstrategien im Dialog zwischen den Generationen. Schwerpunkte sind Unterschiede in der Sprachproduktion und -rezeption, das "Communication Predicament of Aging Model", der Einfluss von Altersstereotypen, Anpassungsstrategien, und Kommunikationsmuster in institutionellen Kontexten.
Welche Forschungsansätze werden im Referat vorgestellt?
Das Referat präsentiert drei Forschungsansätze: Der erste fokussiert auf sprachliche und kommunikative Defizite älterer Menschen als Ursache von Verständigungsproblemen. Der zweite betont den Einfluss negativer Altersstereotypen auf das Kommunikationsverhalten Jüngerer. Der dritte Ansatz betrachtet Kommunikation als dynamisches Geschehen, in dem sich beide Interaktionspartner wechselseitig beeinflussen.
Was ist das "Communication Predicament of Aging Model"?
Das "Communication Predicament of Aging Model" beschreibt einen Teufelskreis aus Altersstereotypen und misslungenen Anpassungsversuchen Jüngerer. Es zeigt, wie die Wahrnehmung von "Alterszeichen" zu stereotypen Zuschreibungen und übertriebener Anpassung des Sprachverhaltens durch Jüngere führt. Dies beeinträchtigt das Selbstbild Älterer, was zu sozialem Rückzug führen kann. Das Modell wird kritisch hinterfragt bezüglich seiner Pauschalität und begrenzten Übertragbarkeit.
Welche altersbedingten Veränderungen in der Sprachproduktion und -rezeption werden diskutiert?
Das Referat behandelt altersbedingte Veränderungen im nonverbalen (mimische Ausdrücke) und paraverbalen Bereich (Stimme, Sprechrhythmus). Es wird betont, dass diese Veränderungen nicht zwangsläufig mit beeinträchtigter kommunikativer Kompetenz gleichzusetzen sind.
Wie werden ältere Sprecher von jüngeren Personen wahrgenommen?
Studien zeigen, dass ältere Sprecherinnen häufiger als zurückhaltend und passiv, ältere Männer als weniger flexibel eingeschätzt werden. Ältere Personen in Interviews werden als verwirrter und ungenauer wahrgenommen als jüngere. Dies unterstreicht den Einfluss von Altersstereotypen.
Gibt es altersbedingte Unterschiede im Gedächtnis und Wortschatz?
Das Referat widerlegt die Annahme, dass altersbedingte Veränderungen automatisch mit beeinträchtigter kommunikativer Kompetenz einhergehen. Ältere und jüngere Menschen weisen eine vergleichbare Organisation des mentalen Lexikons auf. Altersdifferenzen treten vor allem unter erhöhten Anforderungen auf.
Welche Anpassungsstrategien werden im Dialog zwischen Jung und Alt verwendet?
Das Referat analysiert die Kommunikationsstrategien sowohl jüngerer als auch älterer Menschen im Umgang miteinander. Es beleuchtet, wie jüngere Menschen ihre Kommunikation an ältere anpassen und welche Strategien ältere Menschen im Dialog einsetzen.
Wie sieht die Kommunikation in institutionellen Kontexten aus?
Das Referat untersucht die Kommunikationsmuster in Institutionen und die Determinanten dieser Muster. Es analysiert, wie institutionelle Rahmenbedingungen die Kommunikation zwischen Jung und Alt beeinflussen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren das Referat?
Schlüsselwörter sind: Kommunikation, Alter, Sprachproduktion, Sprachrezeption, Altersstereotypen, Anpassungsstrategien, Kommunikationsprädikat des Alterns, Gedächtnis, Wortschatz, Interaktion, Verständigungsprobleme.
- Citation du texte
- Ingrid Haase (Auteur), 2004, Kommunikation zwischen Jung und Alt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137960