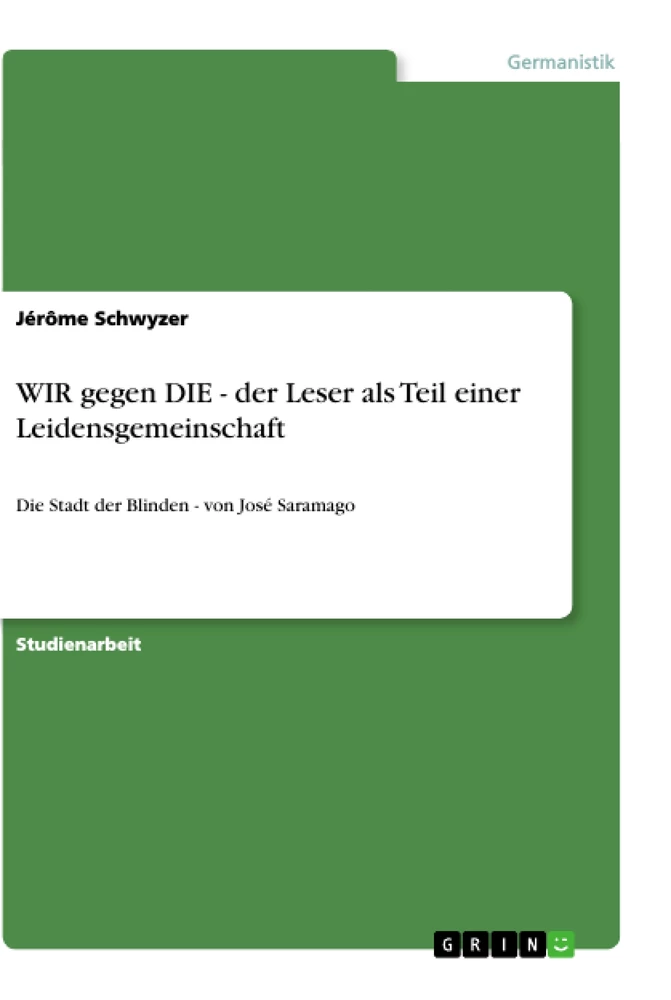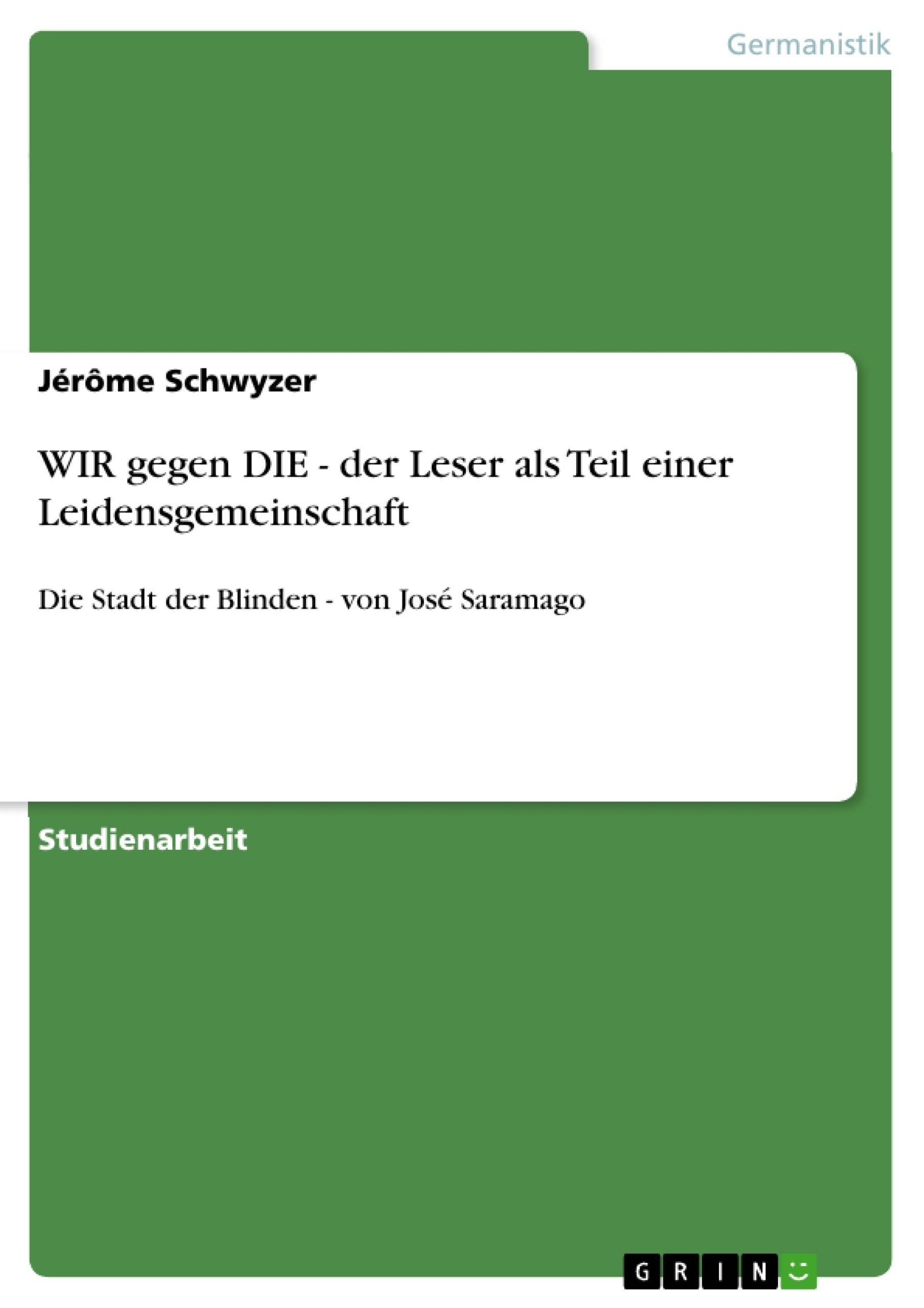Wie schafft es der Erzähler des Werkes "Die Stadt der Blinden", den Leser zu einem Verbündeten einer Gruppe zu machen, welche in gewissen Punkten durchaus amoralisch handelt. Was für eine Rolle spielt die sehende Frau unter den Blinden? Weshalb schaut sie untätig zu, wenn Unrecht geschieht.
Das Buch von Saramago - kürzlich verfilmt - hat an Aktualität nicht eingebüsst und muss als Klassiker der fremdsprachigen Literatur bezeichnet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Kurze Inhaltsangabe
- Betrachtung der Erzählstruktur
- Der Bericht als Relief - verschiedene Perspektiven des Erzählers
- Erzählform
- Point of view
- Sichtweisen
- Erzählverhalten
- Erzählhaltung und Arten der Darbietung
- Unsere Gruppe
- Die Identitätslosigkeit der Figuren
- Die Vorgeschichte der Primären Gruppe
- Die Sehende Frau als Hauptidentifikationsfigur
- Das wirkungsästhetische Verhältnis zwischen Innen- und Aussensicht
- Das Verhältnis des Narrators zum Leser
- Wir erleben etwas
- Der Narrator als moralisch-mahnende Stimme
- Der Wertekonflikt zwischen Leser und Narrator
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Erzählstruktur von José Saramagos „Die Stadt der Blinden“ und analysiert, wie der Erzähler ein intimes Verhältnis zum Leser aufbaut und dessen Sympathie für eine bestimmte Gruppe von Blinden lenkt. Der Fokus liegt auf den erzählerischen Mitteln, die zur Wertevermittlung und zur Schaffung einer Leidensgemeinschaft zwischen Leser und Figuren beitragen.
- Analyse der Erzählstruktur und des Erzählers in "Die Stadt der Blinden"
- Untersuchung der Sympathielenkung des Erzählers
- Die Rolle der Wir-Perspektive in der Erzählung
- Der Vergleich von Innen- und Außensicht der Figuren
- Entwicklung eines neuen moralischen Wertemassstabs im Kontext der Blindheit
Zusammenfassung der Kapitel
Kurze Inhaltsangabe: Der Roman beschreibt eine rätselhafte Blindheitsepidemie, die eine Stadt heimsucht. Die Betroffenen werden in einer Irrenanstalt unter Quarantäne gestellt, wo Chaos und Anarchie ausbrechen. Eine Gruppe, zu der die Frau des erblindeten Arztes gehört – die einzige Sehende – bildet sich und kämpft ums Überleben. Die plötzliche Blindheit und ihre ebenso plötzliche Auflösung bleiben unerklärt.
Betrachtung der Erzählstruktur: Dieses Kapitel analysiert die Erzähltechnik Saramagos. Es untersucht die verschiedenen Perspektiven des Erzählers, die Erzählform, den Point of View und das Erzählverhalten. Die Analyse beleuchtet, wie die Erzählhaltung und die Arten der Darbietung zur Gestaltung der Geschichte beitragen und den Leser in die Handlung einbeziehen. Der Fokus liegt auf der Erforschung der erzählerischen Mittel, die Saramago einsetzt, um eine Atmosphäre von Unsicherheit und Chaos zu erzeugen.
Unsere Gruppe: Hier wird die zentrale Gruppe von Blinden innerhalb der Irrenanstalt untersucht. Die Analyse fokussiert auf die Identitätslosigkeit der einzelnen Figuren inmitten des Chaos, die Vorgeschichte der Gruppe und die besondere Rolle der sehenden Frau des Arztes. Der Text analysiert, wie die Kontrastierung von Innen- und Außensicht die Sympathie des Lesers für die Gruppe lenkt und die moralischen Werte in Frage stellt. Die Sehende Frau fungiert als Identifikationsfigur für den lesenden Zuschauer und verkörpert Hilfsbereitschaft und Aufopferung.
Das Verhältnis des Narrators zum Leser: Dieser Abschnitt untersucht die Beziehung zwischen Erzähler und Leser. Die häufige Verwendung der Wir-Anrede schafft Nähe und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Der Erzähler fungiert als moralisch-mahnende Stimme, doch es entsteht ein Wertekonflikt zwischen dem sehenden Leser und dem Erzähler, der die Perspektive der Blinden einnimmt. Die Analyse fokussiert darauf, wie diese Dynamik die Leserefahrung prägt und zur Identifikation mit den Figuren beiträgt. Der Kontrast zwischen der "sehenden" und der "blinden" Welt führt zur Herausbildung eines neuen, wohlwollenden moralischen Beurteilungskatalogs der Handlungen der Figuren.
Schlüsselwörter
José Saramago, Die Stadt der Blinden, Erzählstruktur, Sympathielenkung, Wir-Perspektive, Innen- und Aussensicht, Blindheit, Moral, Wertekonflikt, Leidensgemeinschaft, Identifikation, Erzähler-Leser-Beziehung.
Häufig gestellte Fragen zu José Saramagos „Die Stadt der Blinden“
Was ist der Inhalt dieser literaturwissenschaftlichen Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Erzähltechnik und die Leserlenkung in José Saramagos Roman „Die Stadt der Blinden“. Sie untersucht, wie der Erzähler die Sympathie des Lesers für eine bestimmte Gruppe von Blinden lenkt und wie er dabei erzählerische Mittel einsetzt, um moralische Werte zu vermitteln und eine Leidensgemeinschaft zwischen Leser und Figuren zu schaffen. Die Analyse konzentriert sich auf die Erzählstruktur, die Perspektiven des Erzählers, das Verhältnis zwischen Erzähler und Leser, und die Rolle der Innen- und Außensichten der Figuren.
Welche Aspekte der Erzählstruktur werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte der Erzählstruktur, darunter die verschiedenen Perspektiven des Erzählers (Bericht als Relief, verschiedene Sichtweisen), die Erzählform, den Point of View, das Erzählverhalten, die Erzählhaltung und die Arten der Darbietung. Der Fokus liegt darauf, wie diese Elemente zur Gestaltung der Geschichte und zur Atmosphäre von Unsicherheit und Chaos beitragen.
Wie wird die Sympathielenkung des Erzählers analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die Mittel, mit denen der Erzähler die Sympathie des Lesers für die Gruppe der Blinden, insbesondere für die sehende Frau des Arztes, lenkt. Hierbei wird die Kontrastierung von Innen- und Außensicht der Figuren und die Rolle der sehenden Frau als Identifikationsfigur untersucht. Der Text analysiert, wie diese Techniken die moralischen Werte in Frage stellen und einen neuen moralischen Wertemassstab im Kontext der Blindheit entwickeln.
Welche Rolle spielt die Wir-Perspektive?
Die häufige Verwendung der Wir-Anrede durch den Erzähler schafft Nähe und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zwischen Erzähler und Leser. Diese Wir-Perspektive trägt maßgeblich zur Identifikation des Lesers mit den blinden Figuren bei und beeinflusst die Wahrnehmung der Ereignisse.
Wie wird das Verhältnis zwischen Erzähler und Leser beschrieben?
Die Arbeit untersucht die komplexe Beziehung zwischen Erzähler und Leser. Der Erzähler fungiert als moralisch-mahnende Stimme, doch es entsteht ein Wertekonflikt zwischen dem sehenden Leser und dem Erzähler, der die Perspektive der Blinden einnimmt. Dieser Konflikt prägt die Leserefahrung und trägt zur Reflexion über Moral und Werte bei.
Welche Schlüsselthemen werden behandelt?
Schlüsselthemen sind die Analyse der Erzählstruktur und des Erzählers, die Sympathielenkung, die Wir-Perspektive, der Vergleich von Innen- und Außensicht, Blindheit als Metapher, Moral und Wertekonflikte, Leidensgemeinschaft und Identifikation mit den Figuren, sowie die Erzähler-Leser-Beziehung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu einer kurzen Inhaltsangabe, der Betrachtung der Erzählstruktur, der Analyse der zentralen Gruppe von Blinden, dem Verhältnis zwischen Erzähler und Leser, und einem Fazit. Jedes Kapitel analysiert spezifische Aspekte des Romans im Hinblick auf die oben genannten Schlüsselthemen.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Die Zusammenfassung fasst die Handlung des Romans kurz zusammen und beschreibt den Inhalt und die analytische Perspektive jedes Kapitels detailliert. Sie gibt einen Überblick über die wichtigsten analytischen Punkte und die Ergebnisse der Untersuchung.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser und Studierende der Literaturwissenschaft, die sich für die Erzähltechnik von José Saramago und die Analyse literarischer Texte interessieren. Sie eignet sich insbesondere für die Auseinandersetzung mit den Themen Erzählperspektive, Leserlenkung und die Konstruktion von Moral in der Literatur.
- Citar trabajo
- Jérôme Schwyzer (Autor), 2009, WIR gegen DIE - der Leser als Teil einer Leidensgemeinschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137982