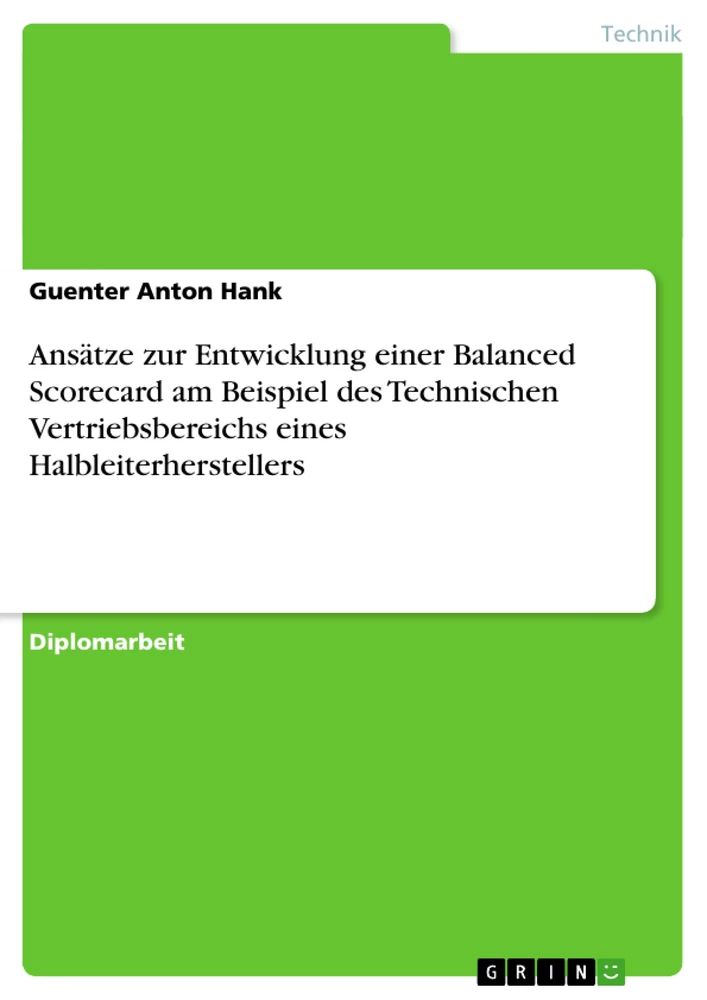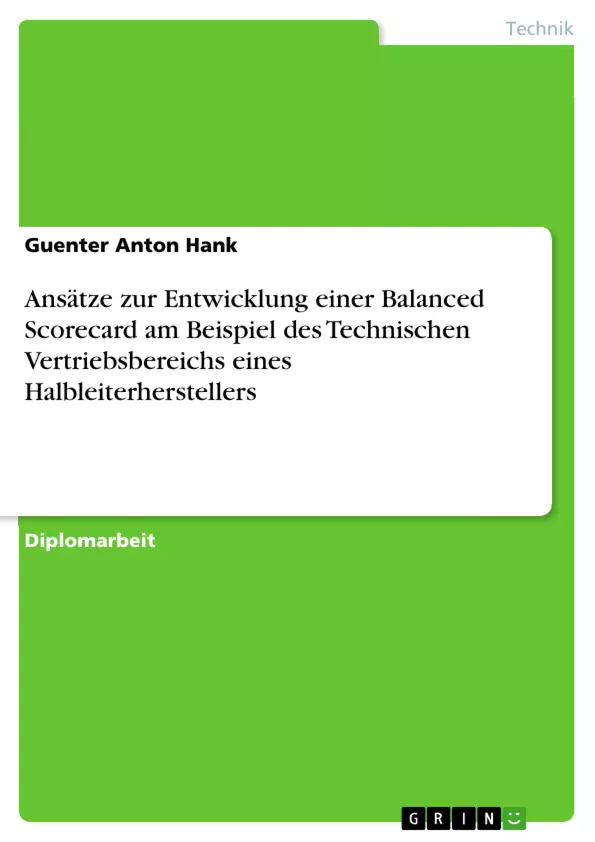Zusammenfassung:
Die Balanced Scorecard ist eine Management-Methode mit Ursprung in den Vereinigten Staaten. Sie dient zur Formulierung, Kommunikation und Umsetzung der Unternehmensstrategie mit dem Ziel, dass sich alle Mitarbeiter motiviert und zielgerichtet für den Erfolg ihres Unternehmens einsetzen.
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich zunächst mit einigen grundlegenden Begriffen, grenzt dann die Methode „Balanced Scorecard“ in Bezug auf andere – schon länger praktizierte - Managementsysteme ab. Dabei wird auf Total Quality Management (TQM), European Foundation for Quality Management (EFQM) und Business Reegineering eingegangen und die Unterschiede kurz dargelegt.
Anschließend wird die Entwicklung einer Balanced Scorecard aufgezeigt. Dabei bezieht sich der Verfasser auf Erfahrungen seiner Tätigkeit bei General Semiconductor, einem amerikanischen Unternehmen aus der Halbleiterbranche.
Nach der klassischen Auffassung (Norton/Kaplan) besteht die Balanced Scorecard aus den vier Perspektiven Finanzen, Kunden, interne Prozesse und Lernen. Im Zentrum der vier Ebenen steht die Vision und die Strategie des Unternehmens.
Ausgehend von diesem Modell entwickelte der Verfasser für die Abteilung „Technical Sales Europe“ für jede dieser vier Perspektiven ein Kennzahlentableau, welches auf die Strategie fokussiert. Dabei werden die jeweilige Zielsetzung, die strategische Kennzahl, Vorgaben und Maßnahmen erläutert, aber auch eventuelle Problematiken diskutiert und mögliche Lösungsansätze besprochen.
Im weiteren werden die vier Perspektiven in einer Ursache-Wirkungskette verknüpft und die Beziehungen der Wertetreiber der verschiedenen Ebenen diskutiert. Eine Korrelationsanalyse wird an einem praktischen Beispiel erläutert.
Da die Mitarbeiter konkrete Zielvorgaben erhalten, ist es sinnvoll, den Grad der Zielerreichung an die Gehaltsfindung bzw. Gehaltsanpassung zu koppeln. Zwei Möglichkeiten werden kurz vorgestellt.
Inhalt der kritischen Würdigung ist die bestehende kritische Sichtweise des Controlling mit Blick auf Ressourceneinsatz und Zielerreichung. Zum Abschluß werden danach die möglichen Nachteile einer Abteilungs-Balanced Scorecard dargestellt und Lösungsansätze vorgeschlagen.
Inhaltsverzeichnis
-
Einleitung:
- Aktueller Bezug
- Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
-
Grundlagen:
- Historie der BSC
- Begriffe und Definitionen:
- Ziele und Eigenschaften
- BSC und wertorientierte Unternehmensführung
- Die Perspektiven
- Balanced und Scorecard
- Weitere Begriffe
- Skizzierung des Unternehmens General Semiconductor
- Die Abteilung „Technical Sales Europe“
Abgrenzung in Bezug auf andere Managementsysteme
- Vergleich TQM - BSC
- Vergleich EFQM - BSC
- Vergleich Business Reengineering - BSC
Entwicklung und Aufbau der Team-BSC
- Mitarbeiterperspektive
- Erfolgspotential/Ziel: Höherqualifizierung des Teams
- Erfolgspotential/Ziel: Teamproduktivität steigern
- Zusammenfassung
- Erfolgspotential/Ziel: Mehr Geschäft mit kundenspezifischen Lösungen
- Erfolgspotential/Ziel: Mehr verwertbare Kundenwünsche identifizieren
- Erfolgspotential/Ziel: Erschließung des MOS-FET Marktes
- Zusammenfassung
- Erfolgspotential/Ziel: Neuproduktfreigaben bei bestehendem Direktkundenstamm forcieren
- Erfolgspotential/Ziel: Motivation der Händler steigern
- Erfolgspotential/Ziel: Gewinn durch kundenspezifische Lösungen steigern
- Erfolgspotential/Ziel: MOSFET Umsätze in Zielsegmenten steigern
- Zusammenfassung
- Erfolgspotential/Ziel: Innovator-Image durch Neuproduktgeschäft
- Erfolgspotential/Ziel: Neuproduktumsatz /Gewinn in den Kundensegmenten steigern
- Erfolgspotential/Ziel: Überdurchschnittliche Profitabilität
- Zusammenfassung
Ursache-Wirkungskette
- Ursache-Wirkungsbeziehungen
- Korrelationsanalyse und strategischer Lernprozess
Verknüpfung von Zielerreichung und Gehaltsanpassung
Kritische Würdigung und Ausblick
- Ressourceneinsatz und Zielererreichung
- Mögliche Nachteile einer Abteilungs-BSC
- Lösungsansätze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Entwicklung einer Balanced Scorecard im Kontext eines technischen Vertriebsbereichs eines Halbleiterherstellers. Sie analysiert die Anwendung der Balanced Scorecard-Methode zur strategischen Steuerung und Zielerreichung.
- Die Analyse und Abgrenzung der Balanced Scorecard-Methode von anderen Managementsystemen wie TQM, EFQM und Business Reengineering.
- Die Entwicklung einer Balanced Scorecard auf Basis der vier Perspektiven Finanzen, Kunden, interne Prozesse und Lernen.
- Die Verknüpfung der Perspektiven durch eine Ursache-Wirkungskette und die Analyse der Beziehungen der Wertetreiber.
- Die Integration von Zielvorgaben und deren Einfluss auf Gehaltsanpassung.
- Die kritische Würdigung der Balanced Scorecard-Methode im Hinblick auf Ressourcenallokation und Zielerreichung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert einen aktuellen Bezug zum Thema und definiert die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die Grundlagen der Balanced Scorecard, einschließlich ihrer Historie, der Definition wichtiger Begriffe und der Darstellung der vier Perspektiven. Kapitel 3 analysiert und grenzt die Balanced Scorecard von anderen Managementsystemen wie TQM, EFQM und Business Reengineering ab. Kapitel 4 konzentriert sich auf die Entwicklung und den Aufbau einer Team-Balanced Scorecard, wobei jede der vier Perspektiven detailliert betrachtet wird. Kapitel 5 untersucht die Ursache-Wirkungskette und die Beziehungen der Wertetreiber in den verschiedenen Perspektiven. Kapitel 6 analysiert die Verknüpfung von Zielerreichung und Gehaltsanpassung. Kapitel 7 bietet eine kritische Würdigung der Balanced Scorecard und diskutiert potenzielle Nachteile sowie Lösungsansätze.
Schlüsselwörter
Balanced Scorecard, Managementsystem, strategische Steuerung, Zielerreichung, Finanzen, Kunden, interne Prozesse, Lernen, Ursache-Wirkungskette, Wertetreiber, Gehaltsanpassung, Ressourceneinsatz, TQM, EFQM, Business Reengineering, Halbleiterindustrie, Technical Sales, Vertrieb.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Balanced Scorecard (BSC)?
Die BSC ist ein strategisches Managementsystem, das Visionen und Strategien in konkrete Kennzahlen über verschiedene Perspektiven hinweg übersetzt.
Welche vier Standardperspektiven gibt es in der BSC?
Die klassischen Perspektiven nach Kaplan und Norton sind Finanzen, Kunden, interne Prozesse sowie Lernen und Entwicklung.
Wie grenzt sich die BSC von TQM ab?
Während TQM (Total Quality Management) den Fokus auf die Qualität aller Prozesse legt, konzentriert sich die BSC primär auf die Umsetzung der Unternehmensstrategie.
Was ist eine Ursache-Wirkungskette in der BSC?
Sie beschreibt den logischen Zusammenhang, wie Verbesserungen (z.B. im Lernen) zu besseren Prozessen, zufriedeneren Kunden und schließlich finanziellem Erfolg führen.
Kann die BSC die Gehaltsfindung beeinflussen?
Ja, die Arbeit diskutiert Modelle, bei denen die Erreichung strategischer Ziele aus der BSC direkt an variable Gehaltsbestandteile gekoppelt wird.
- Citar trabajo
- Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtschaftsing. Guenter Anton Hank (Autor), 2002, Ansätze zur Entwicklung einer Balanced Scorecard am Beispiel des Technischen Vertriebsbereichs eines Halbleiterherstellers, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13830