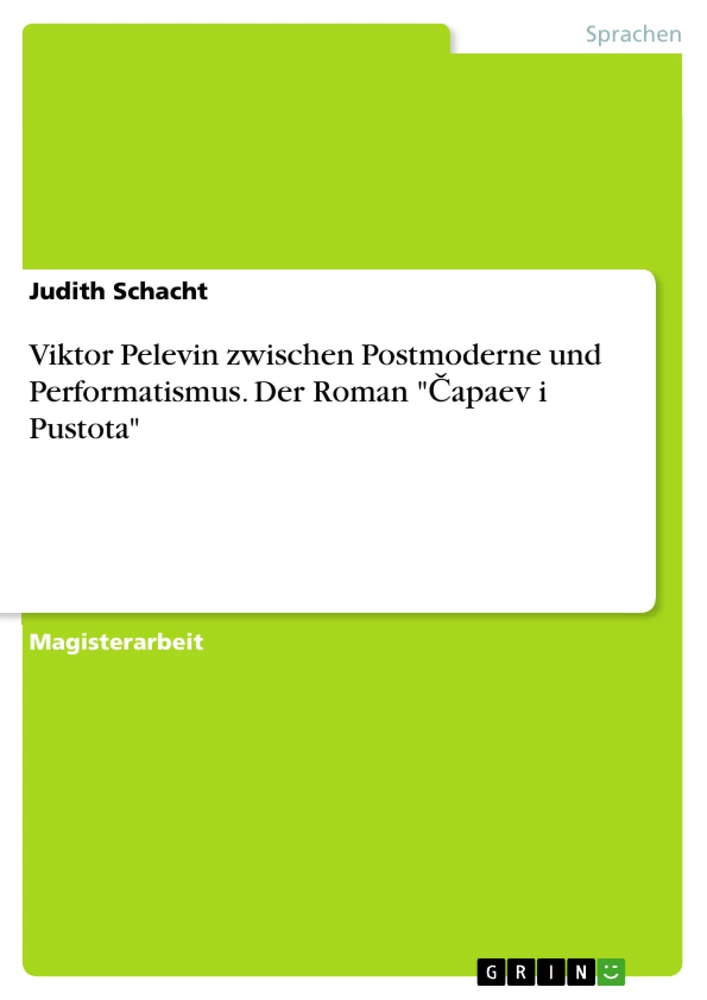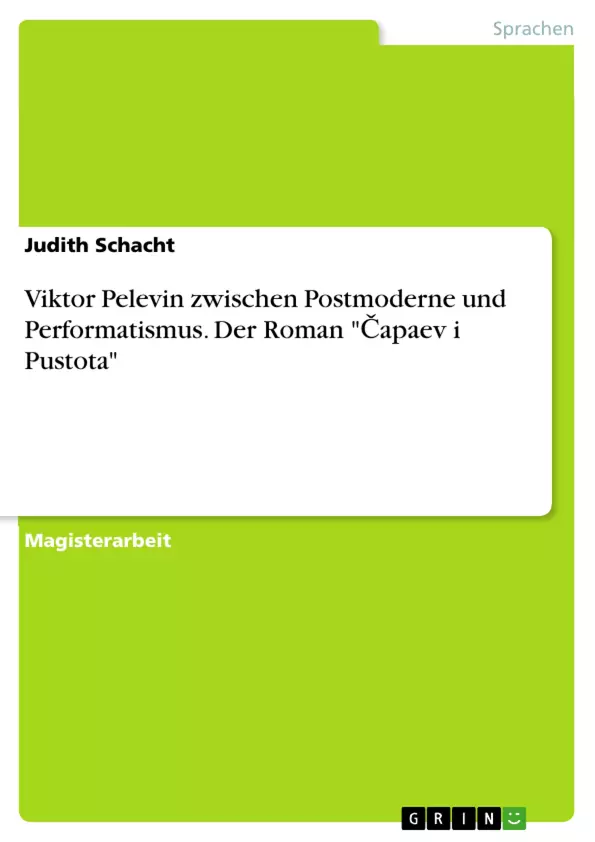Untersuchungsgegenstand dieser Magisterarbeit soll jenes Meisterwerk "Čapaev i Pustota", so lautet der russische Originaltitel, des literarischen Jungstars Viktor Pelevin sein. Seit zwölf Jahren ist das Werk Gegenstand von Rezeption und unerschöpft kontroverser Diskussion.
Einige sehen in Pelevin einen Schreiber der Postmoderne par excellence. Andere Rezipienten hingegen problematisieren diese Einordnung im Hinblick auf gravierende formale und inhaltliche Abweichungen. Da die Postmoderne sich dieses zeitgenössisch tragende Werk nicht mehr ohne weiteres einzuverleiben vermag, erhärtet sich der Verdacht, dass die zahlreich werdenden Rufe über das Ende der Epoche, wie sie beispielsweise auf den Literaturseiten der Zeit laut werden, durchaus ihre Berechtigung haben.
Über eine grundsätzliche Annäherung an den Roman hinaus, wird daher versucht jene Merkmale von Pelevins Schreiben herauszuarbeiten, die über eine Epochenzugehörigkeit Aufschluss geben können. Es soll der Frage nachgegangen werden, weshalb sich für das Werk von Pelevin so leicht keine Kategorie finden lässt. Zunächst wird der theoretische Rahmen, der für die Analyse nötig ist, definiert. Der komplexe und differierende Begriff der Postmoderne kann anhand der Schwerpunktmerkmale des Zeichens, des Subjekts und des Zeit- und Geschichtskonzepts greifbar gemacht werden. Anschließend wird der Performatismus, das Nachfolgekonzept des Literaturwissenschaftlers Raoul Eshelman in seinen Grundzügen vorgestellt.
Eine neue Haltung zu Zeichen, Subjekt, sowie Zeit- und Geschichtlichkeit steht in Wechselwirkung mit der Performanz, der doppelten Rahmung und dem Theismus; allesamt zentrale Strukturmerkmale des Performatismus. Diese theoretischen Rahmenkonzepte der Postmoderne und des Performatismus sollen einander in der Analyse von ČiP gegenüber gestellt werden. Um den Hinweisen auf beide Epochenkonzepte ausreichend folgen zu können, ist die Betrachtung der Erzählanordnung, der Weltenkonstruktion, der Bezüge zum Čapaev-Mythos und zum Buddhismus notwendig. Diese Ergebnisse führen hin zu einer Gegenüberstellung des konträren Verständnis von Zeitlichkeit-, Subjekt- und Zeichen in Postmoderne und Performatismus, mit dem Ziel, Grenzen und Anknüpfungspunkte sichtbar zu machen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Postmoderne
- Das Zeichen
- Der Hintergrund des Zeichengebrauchs
- Die Merkmale des Zeichengebrauchs
- Die Zitation
- Die Betonung der Mittelbarkeit
- Die Ästhetik
- Zusammenfassung des Zeichenbegriffs
- Das Subjekt
- Das Verschwinden des Subjekts
- Die Konsequenzen für das Subjekt
- Das Zeit- und Geschichtskonzept der Postmoderne
- Die Postmoderne in Russland
- Der Russische Konzeptualismus
- Der Performatismus
- Das monistische Zeichenkonzept
- Die doppelte Rahmung
- Die Performance
- Das performatistische Subjekt
- Die performatistische Zeit und Geschichtlichkeit
- Der Theismus
- Die Analyse von Čapaev i Pustota
- Viktor Pelevin
- Die Erzählanordnung
- Die Erzählsituation nach Franz K. Stanzel
- Die postmodernen Elemente
- Die theistische Ausstattung der Figur Čapaev
- Die Zusammenfassung zur Erzählsituation
- Der Čapaev-Mythos
- Das Subjekt in Čapaev i Pustota
- Die Psychiatrie
- Die Seinszustände (Drogen, Wachen, Schlafen)
- Zusammenfassung zum Subjekt
- Die performistischen Elemente
- Die Beschaffenheit der Realität
- Das Wesen der Seele und des Selbst
- Die postmodernen Elemente
- Die buddhistischen Elemente in Čapaev i Pustota
- Die Erleuchtung
- Die Dimensionen Zeit und Raum
- Die Weltenkonstruktion
- Pelevinsches Weltmodell nach Marco Klüh
- Erweiterung des Weltmodells
- Das Zeit- und Geschichtskonzept in Čapaev i Pustota
- Das Zeichen bei Pelevin
- Die postmodernen Merkmale des Zeichengebrauchs
- Die Zitation
- Die Hyperrealitäten der Sowjet-Ideologie und der Massenmedien
- Die Mittelbarkeit des Zeichens
- Die Ästhetik
- Die Merkmale eines performistischen Zeichengebrauchs
- Die Performance
- Die Hinweise auf einen monistischen Zeichenbegriff
- Die Synthese: Pustota - Die Leere
- Die Leere in der postmodernen Tradition Russlands
- Die Leere im Sinne des Buddhismus
- Die Leere im Sinne des Performatismus
- Die Merkmale des Zeichens in der Postmoderne
- Die Rolle des Subjekts in der Postmoderne
- Die Performanz und das performatistische Subjekt
- Die Weltenkonstruktion in Čapaev i Pustota
- Die Relevanz des Buddhismus im Werk
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht Viktor Pelevins Roman Čapaev i Pustota (1996), um dessen Einordnung zwischen Postmoderne und Performatismus zu ergründen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Merkmale von Pelevins Werk zu analysieren, die über eine Epochenzugehörigkeit Aufschluss geben.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen für die Analyse von Čapaev i Pustota, insbesondere die Definition der Postmoderne anhand des Zeichens, des Subjekts und des Zeit- und Geschichtsbegriffs. Kapitel zwei beleuchtet den Performatismus als Nachfolgekonzept der Postmoderne und stellt dessen zentrale Merkmale wie die Performanz, die doppelte Rahmung und den Theismus vor. Die Analyse von Čapaev i Pustota in Kapitel drei fokussiert auf die Erzählanordnung, die Weltenkonstruktion, die Bezüge zum Čapaev-Mythos und zum Buddhismus. Kapitel vier schließlich setzt sich mit dem zentralen Motiv der Leere („Pustota“) auseinander und erörtert, welche Theorie einen Schlüssel zum umfassenden Verständnis des Romans liefert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Postmoderne, Performatismus, Viktor Pelevin, Čapaev i Pustota, Zeichen, Subjekt, Performanz, Buddhismus, Leere (Pustota).
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Viktor Pelevins Roman "Čapaev i Pustota"?
Der Roman verknüpft verschiedene Realitätsebenen (russischer Bürgerkrieg und Psychiatrie) und thematisiert Identität, Buddhismus und die Natur der Realität.
Was ist der Unterschied zwischen Postmoderne und Performatismus?
Während die Postmoderne das Subjekt auflöst und auf Mittelbarkeit setzt, strebt der Performatismus nach einer neuen Einheit von Zeichen und Subjekt durch "doppelte Rahmung".
Welche Rolle spielt der Buddhismus im Werk Pelevins?
Buddhistische Konzepte wie die "Leere" (Pustota) und die Erleuchtung sind zentrale Motive zur Deutung der Weltenkonstruktion des Romans.
Wer war Raoul Eshelman?
Ein Literaturwissenschaftler, der das Konzept des Performatismus als Nachfolgeepoche der Postmoderne definierte.
Warum lässt sich Pelevins Werk schwer kategorisieren?
Es enthält sowohl Merkmale der postmodernen Zitation als auch performatistische Elemente einer neuen, transzendenten Sinnstiftung.
- Citation du texte
- Judith Schacht (Auteur), 2008, Viktor Pelevin zwischen Postmoderne und Performatismus. Der Roman "Čapaev i Pustota", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1389372