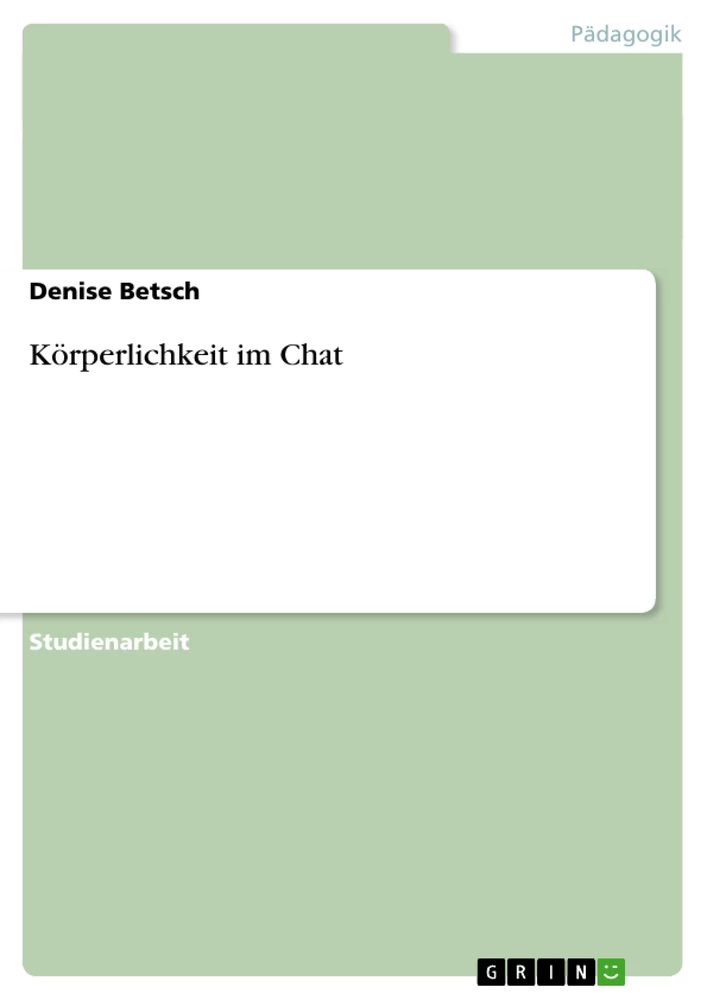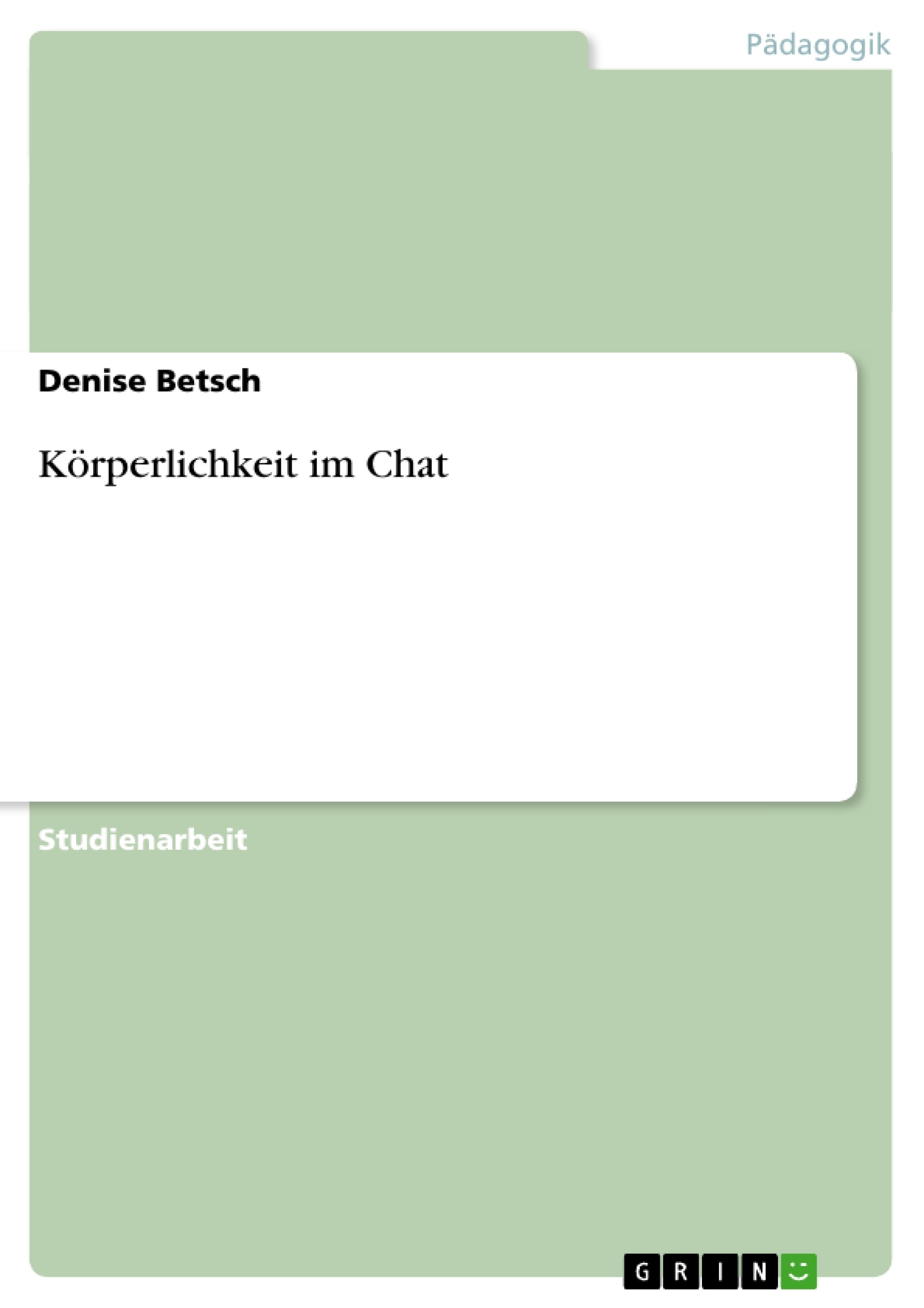Das Internet ist im Laufe der Zeit zum Interessengebiet zahlreicher Wissenschaften avanciert. Unter diesem Neuen Medium versteht man „[…] eine elektronische Verbindung von Rechnernetzwerken, mit dem Ziel Verbindungen zwischen einzelnen Computern herzustellen und so Daten auszutauschen“ . Demnach fungiert das Internet als Kommunikationsmedium. Es vermag ‚alte’ Formen der Kommunikation zu integrieren, eröffnet dagegen auch verschiedenartige neue Kommunikationsmöglichkeiten. Diese haben klare Vorteile gegenüber den konventionellen Kommunikationsformen. Zum Beispiel bringt die Informationsübertragung via Email den Vorzug der Geschwindigkeit mit sich. Das ist lediglich ein Grund, warum man heutzutage eher eine Email sendet als einen Brief zu verfassen.
Die vorliegende Arbeit richtet ihren Blick auf den anthropologischen Aspekt von Internetkommunikation. Mithilfe der Kommunikationsform Chat soll herausgefunden werden, inwiefern der menschliche Körper im virtuellen Raum des Internet (noch) existent ist. Funken behauptet nämlich, dass die direkte, interaktive Kommunikation allmählich vom Körper getrennt wurde. Ihrer Meinung nach findet im Internet körperlose Interaktion ohne Bezug zu Raum und Zeit statt. Diese Auflösung des Körpers würde unsere bisherige Auffassung von Körperlichkeit vollkommen infrage stellen.
Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit theoretischen Grundlagen zur Anthropologie der Neuen Medien. In diesem Zusammenhang wird ein Auszug aus McLuhans Medientheorie vorgestellt. Mittelpunkt des zweiten Teils bildet die computervermittelte Kommunikationsform Chat. Nach einer allgemeinen Definition zur computervermittelten Kommunikation folgt eine Gegenüberstellung von computervermittelter Kommunikation und Face-to-face-Kommunikation. Im Anschluss daran dreht es sich im Speziellen um den Chat, den Nickname als seine Zugangsvoraussetzung sowie seine Rolle als virtueller sozialer Handlungsraum. Der letzte Teil der Arbeit widmet sich der Existenz von Körperlichkeit im Chat. Zunächst sollen realer und virtueller Körper voneinander abgegrenzt werden. Das darauf folgende Kapitel klärt die Frage, ob das Thema Geschlecht für den Verlauf eines Chats von Bedeutung ist. Abschließend werden die verschiedenen Möglichkeiten der virtuellen Körpersprache dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung
2 Anthropologie - Medienanthropologie - McLuhan
3 Chat als synchrone computervermittelte Kommunikationsform
3.1 Computervermittelte Kommunikation
3.2 Computervermittelte Kommunikation versus Face-to-face-Kommunikation
3.3 Was ist Chat?
3.4 Nickname
3.5 Chat als virtueller sozialer Handlungsraum
4 Die Rolle des Körpers im Chat
4.1 Realer und virtueller Körper
4.2 Bedeutung von Geschlecht
4.3 Virtuelle Körpersprache
5 Schlussbetrachtung
6 Literaturverzeichnis
1 Einführung
Das Internet ist im Laufe der Zeit zum Interessengebiet zahlreicher Wissenschaften avanciert. Unter diesem Neuen Medium versteht man „[…] eine elektronische Verbindung von Rechnernetzwerken, mit dem Ziel Verbindungen zwischen einzelnen Computern herzustellen und so Daten auszutauschen“1. Demnach fungiert das Internet als Kommunikationsmedium. Es vermag ‚alte’ Formen der Kommunikation zu integrieren, eröffnet dagegen auch verschiedenartige neue Kommunikationsmöglichkeiten. Diese haben klare Vorteile gegenüber den konventionellen Kommunikationsformen. Zum Beispiel bringt die Informationsübertragung via Email den Vorzug der Geschwindigkeit mit sich. Das ist lediglich ein Grund, warum man heutzutage eher eine Email sendet als einen Brief zu verfassen.
Die vorliegende Arbeit richtet ihren Blick auf den anthropologischen Aspekt von Internetkommunikation. Mithilfe der Kommunikationsform Chat soll herausgefunden werden, inwiefern der menschliche Körper im virtuellen Raum des Internet (noch) existent ist. Funken2 behauptet nämlich, dass die direkte, interaktive Kommunikation allmählich vom Körper getrennt wurde. Ihrer Meinung nach findet im Internet körperlose Interaktion ohne Bezug zu Raum und Zeit statt. Diese Auflösung des Körpers würde unsere bisherige Auffassung von Körperlichkeit vollkommen infrage stellen.
Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit theoretischen Grundlagen zur Anthropologie der Neuen Medien. In diesem Zusammenhang wird ein Auszug aus McLuhans Medientheorie vorgestellt. Mittelpunkt des zweiten Teils bildet die computervermittelte Kommunikations- form Chat. Nach einer allgemeinen Definition zur computervermittelten Kommunikation folgt eine Gegenüberstellung von computervermittelter Kommunikation und Face-to-face-Kommu- nikation. Im Anschluss daran dreht es sich im Speziellen um den Chat, den Nickname als sei- ne Zugangsvoraussetzung sowie seine Rolle als virtueller sozialer Handlungsraum. Der letzte Teil der Arbeit widmet sich der Existenz von Körperlichkeit im Chat. Zunächst sollen realer und virtueller Körper voneinander abgegrenzt werden. Das darauf folgende Kapitel klärt die Frage, ob das Thema Geschlecht für den Verlauf eines Chats von Bedeutung ist. Abschlie- ßend werden die verschiedenen Möglichkeiten der virtuellen Körpersprache dargestellt.
2 Anthropologie - Medienanthropologie - McLuhan
Anthropologie ist die Lehre vom Menschen. Sie versucht, seine Eigenschaften und Verhaltensweisen in der Umwelt wissenschaftlich zu erläutern. Die Ursprünge der Anthropologie stammen aus der Philosophie, wo der Mensch im 18. Jahrhundert zum zentralen Gegenstand wurde.3 Heutzutage finden sich anthropologische Ansätze sowohl in geisteswissenschaftlichen als auch in naturwissenschaftlichen Disziplinen.
Bei der Medienanthropologie handelt es sich ebenso um einen interdisziplinären Forschungsansatz. Einerseits ordnet man sie der Medienpädagogik zu, andererseits wird sie als Teilgebiet der Kulturanthropologie gesehen. Die Medienanthropologie untersucht, inwiefern sich der Mensch und das Menschenbild in einer Gesellschaft, die durch Medien geprägt ist, wandeln.4 Ihr Forschungsgebiet geht auch aus folgender Frage hervor: „Was machen die Medien mit dem Menschen und wie kann der Mensch seine Autonomie und Handlungsfähigkeit gegenüber der (vermuteten) Medienwirkung erhalten?“5
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Medien Informationsüberträger sind. McLuhan bezeichnet alle Medien als Metaphern, „welche als ‚Ausweitungen unserer eigenen Personen… unsere natürlichen Körper mittels elektrischer Medien in unser erweitertes Nervensystem hineinverlegen’“6. Für ihn bildet der Mensch sowohl als Individuum als auch in der Gruppe Systeme, die wiederum an ein Medium gebunden sind.7
Als Teil seiner Medien- und Kulturtheorie unterscheidet McLuhan zwischen heißen und küh- len Medien. Er bezieht sich damit auf unser Wahrnehmungsverm]ögen. Heiße Medien erwei- tern nur einen der Sinne, bis etwas detailreich ist. Detailreichtum besteht dann, wenn viele Daten oder Einzelheiten vorliegen. Ein weiteres Kennzeichen heißer Medien ist die geringe, erforderliche Beteiligung oder Vervollständigung auf Seiten des Publikums. Als Beispiele wären das Radio oder ein Kinofilm zu nennen. Kühle Medien zeichnen sich durch genau ge- genteilige Eigenschaften aus. Sie sind detailarm, weil sie alle Sinne erweitern. Um ihren In- halt vollständig verstehen zu können, muss man die nötigen Informationen zum Teil ergän- zen. Daher verlangen sie große Aufmerksamkeit vom Rezipienten. Beispiele für kühle Me- dien sind das Telefon und die Sprache.8
Da McLuhans Medientheorie aus den 60er Jahren stammt, berücksichtigt sie noch nicht die technischen Neuentwicklungen der so genannten Neuen Medien. Diese Arbeit bezieht sich jedoch auf die Neuen Medien, insbesondere das Internet. Mit der Frage, ob das Internet heiß oder kühl ist, hat sich Sandbothe9 auseinander gesetzt. Dabei ist er zu folgendem Schluss ge- kommen: Wenn man die drei Kennzeichen Sinneserweiterung, Detailreichtum bzw. -armut und erforderliche Beteiligung betrachtet, kann das Internet heiß, aber genauso auch kühl sein. Hier muss man gebrauchsabhängig differenzieren. Wird das Internet etwa als digitales Foto- album genutzt, hat es die Funktion eines heißen Mediums. „In allen interaktiven Anwendun- gen wie in Chat-Rooms […], bei Spielen oder bei hypertextuellen Anwendungen ist die Mög- lichkeit zur aktiven persönlichen Beteiligung groß“10, sodass man in diesem Zusammenhang von einem kühlen Medium spricht.
3 Chat als synchrone computervermittelte Kommunikationsform
3.1 Computervermittelte Kommunikation
Bei der computervermittelten Kommunikation (CVK) handelt es sich um eine Kommunikationsform, die an das Medium Computer als technisches Verbreitungsmittel gebunden ist. Die Kommunikation erfolgt in der Regel durch den Austausch von Textbotschaften, ohne dass sich die Kommunikationspartner sehen.
Nach Falckenberg11 ist die CVK durch folgende Merkmale gekennzeichnet: 1. kann man sich mit mehreren oder sogar sehr vielen Kommunikationspartnern parallel verständigen, 2. ken- nen sich die Kommunikationspartner normalerweise nicht, sondern finden einander erst durch gemeinsame Interessen, 3. ist der Aufenthaltsort des Kommunikationspartners insofern irrele- vant, als eine größere Entfernung keine höheren Internetkosten verursacht und somit einer wiederholten Kommunikation nichts im Wege steht und 4. wird die Bandbreite stark einge- schränkt, da die Kommunikation meist textbasiert ist und Informationen wie Mimik oder Äu- ßerlichkeiten nicht übertragen werden.
Um CVK erfolgreich zu durchlaufen, sollten laut Lübke diese Voraussetzungen gegeben sein:
„Die Interagierenden definieren die Situation als ‚real’ und vertrauen den Zeichen. Die Text- eingaben sind ihrer Bedeutung nach komplementär zueinander und, soll eine Kommunikation dauerhaft fortgeführt werden, verhalten sich die Interagierenden kompetent zu ihren medialen Darstellungen.“12
Man unterscheidet zwischen asynchroner und synchroner CVK. Asynchron bedeutet, dass die Informationen erst mit zeitlicher Verzögerung den Kommunikationspartner erreichen. Beispiele dafür sind Emails oder Internetforen.
Bei der synchronen CVK werden „[…] die Textbotschaften […] in dialogischer Form nahezu zeitgleich (synchron) produziert, rezipiert und beantwortet […]“13. Es kommt also zu einer wechselseitigen Kommunikation, bei der die Teilnehmer im gleichen Moment agieren. Zur synchronen CVK zählen textbasierte Rollenspiele - die so genannten MUDs (Multi User Dimensions) - und die für diese Arbeit relevanten Chats.
[...]
1 Wikipedia (2007): „Internet“. URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Internet [Stand: 6. März 2007]
2 vgl. Funken, Christiane (2005): „Der Körper im Internet“. In: Schroer, Markus (Hg.) (2005): Soziologie des Körpers 1. Auflage. Frankfurt am Main: Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 217
3 vgl. Meyers Lexikonredaktion (Hg.) (1996): Duden. Das Neue Lexikon in zehn Bänden, Band 1. 3. Auflage Mannheim u. a.: Dudenverlag, 170f.
4 vgl. Wikipedia (2006) URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Medienanthroplogie [Stand: 29. April 2006]
5 McLuhan, Marshall/Powers, Bruce R. (1995): The global village: der Weg der Mediengesellschaft in das 21. Jahrhundert (Medienanthropologie). Paderborn: Junfermann Verlag, 225
6 ebd., 226
7 vgl. ebd.
8 vgl. McLuhan, Marshall (1968): Die magischen Kanäle. Düsseldorf/Wien: Econ-Verlag, 29ff.
9 vgl. Scheibmayr, Werner (2001): „das internet - ein heißes oder ein kaltes medium?“ URL: http://www.lrz- muenchen.de/~piiseminar/0102internetheiss-kalt.htm [Stand: 30. April 2007]
10 Scheibmayr, Werner (2001)
11 vgl. Falckenberg, Christian (1994): „Internet - Spielzeug oder Werkzeug?“. URL: http://www.dfv.rwth- aachen.de/chf/Studienarbeit/internet.html [Stand: 3. Mai 2007]
12 Lübke, Valeska (2005): CyberGender. Geschlecht und Körper im Internet. Königstein/Taunus: Ulrike Helmer Verlag, 73
13 Döring, Nicola (1999): Sozialpsychologie des Internet. Die Bedeutung des Internet für Kommunikationsprozesse, Identitäten, soziale Beziehungen und Gruppen. Göttingen: Hogrefe Verlag, 91
Häufig gestellte Fragen
Existiert der menschliche Körper im virtuellen Raum des Chats?
Die Arbeit untersucht, ob die Kommunikation im Internet wirklich "körperlos" ist oder ob der Körper durch Nicknames und virtuelle Körpersprache präsent bleibt.
Was ist der Unterschied zwischen heißem und kühlem Medium laut McLuhan?
Heiße Medien (wie Radio) sind detailreich und fordern wenig Beteiligung; kühle Medien (wie Telefon oder Chat) sind detailarm und verlangen hohe Aufmerksamkeit und Ergänzung durch den Nutzer.
Was ist virtuelle Körpersprache?
Dazu zählen Emoticons, Aktionswörter (z. B. *lacht*) oder die gezielte Nutzung von Satzzeichen, um Mimik und Gestik im Text-Chat zu ersetzen.
Welche Rolle spielt der Nickname?
Der Nickname fungiert als Zugangsvoraussetzung und als "Ersatzkörper" im virtuellen Raum, über den Identität und Geschlecht signalisiert werden.
Ist das Internet ein heißes oder kühles Medium?
Das ist gebrauchsabhängig: Als Fotoalbum ist es eher heiß, in interaktiven Anwendungen wie Chats ist es ein kühles Medium.
- Citar trabajo
- Denise Betsch (Autor), 2007, Körperlichkeit im Chat, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139319