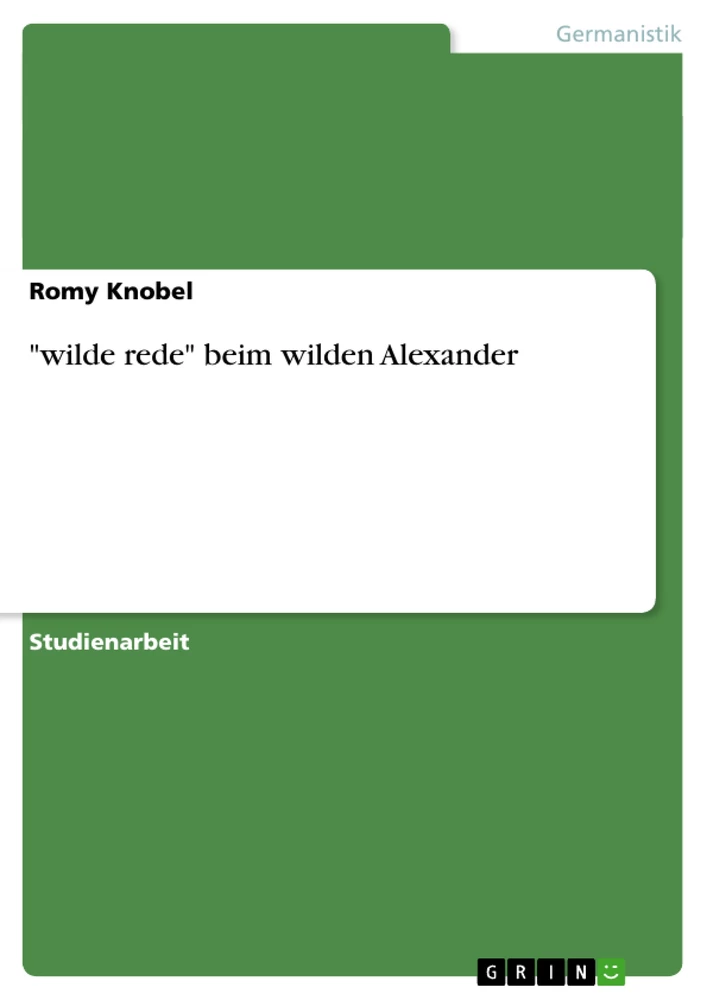Wilde, wilt adj.: nicht von Menschen gepflegt und veredelt, wüst, ungezähmt, irre, unwahr, sinnlos, fremd, unheimlich Dies sind einige Bedeutungsvarianten des mittelhochdeutschen Wörterbuches für wilde. Die inhaltliche Vielfalt der Übersetzungsmöglichkeiten macht es sehr schwer dieses Wort zu fassen. Wie also ist die Platzierung von wilde im Namen eines Schriftstellers zu bewerten? Die Rede ist vom Wilden Alexander. Dieser heißt nicht nur wild, sondern artikuliert sich in seinen Texten auch mit Hilfe von wilder rede. Der Aufsatz „Wie dunkel ist wilde rede?“ von Sabine Schmolinsky beschäftigt sich damit, was genau sich hinter dieser Begrifflichkeit verbergen könnte. Sie meint, dass wilde rede „deutungsbedürftige Rede“ bzw. „allegorisches Sprechen“ mit „geistliche[r] Konnotation[…]“ umschreibt. Allerdings liegt dabei das Hauptaugenmerk ihrer Untersuchung auf nur einem Text Alexanders, „des richen küniges kint“(S.7; V.1), in dem wortwörtlich die Formulierung „wilde[…] rede“ vom Autor verwendet wird. Die Frage die sich zwangsläufig stellt, ist ob dieses Prinzip der Textgestaltung auch auf andere Texte anwendbar ist. Sabine Schmolinsky spricht sich eher dagegen aus. „Wieweit Alexander seinen Begriff der wilden rede auf seine anderen Spruchstrophen hätte ausgedehnt wissen wollen, lässt sich nicht ermessen.“ Vielleicht könnte man aber doch Belege finden, die den vorgestellten Ansatz der wilden rede auch in anderen Texten nachweisen. Der Suche nach solchen Parallelen will diese Hausarbeit sich zuwenden. Dazu erfolgt zuerst der Versuch am Königskindertext zu untersuchen, inwieweit das Adjektiv „deutungsbedürftig“ zutrifft und wie stark der biblische Einfluss tatsächlich ausgeprägt ist. Danach wird die Untersuchung auf weitere Texte ausgedehnt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Deutungsbedürftige Rede
- Des richen küniges kint
- Weitere Textbelege
- Der trügehaft Antikrist
- Kindheitslied
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verwendung des Begriffs "wilde rede" im Werk des Wilden Alexander. Ziel ist es, die von Sabine Schmolinsky vorgeschlagene Interpretation als "deutungsbedürftige Rede" auf weitere Texte Alexanders anzuwenden und deren Gültigkeit zu überprüfen. Die Arbeit analysiert den Begriff "wilde rede" im Kontext der Textgestaltung und beleuchtet den Einfluss biblischer Motive und Allegorien.
- Analyse des Begriffs "wilde rede" bei dem Wilden Alexander
- Untersuchung der "deutungsbedürftigen Rede" als interpretatives Verfahren
- Bedeutung biblischer Einflüsse und Allegorien in Alexanders Werk
- Vergleichende Analyse verschiedener Texte des Wilden Alexander
- Verbindung zwischen Textgestaltung und inhaltlicher Botschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und definiert den Begriff "wilde" anhand verschiedener Bedeutungsvarianten aus dem mittelhochdeutschen Wörterbuch. Sie stellt die Frage nach der Bedeutung des Namens "Der Wilde Alexander" und der Verwendung von "wilder rede" in seinen Texten. Die Arbeit von Sabine Schmolinsky wird als Ausgangspunkt vorgestellt, in der "wilde rede" als "deutungsbedürftige Rede" bzw. "allegorisches Sprechen" mit geistlicher Konnotation interpretiert wird. Die Arbeit stellt sich die Frage, ob dieses Prinzip auf andere Texte Alexanders anwendbar ist und kündigt die Vorgehensweise an, zunächst den Königskindertext zu untersuchen und dann die Analyse auf weitere Texte auszudehnen.
Deutungsbedürftige Rede: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse des Gedichts "Des richen küniges kint". Der Text wird als eine Allegorie interpretiert, die von zwei Königstöchtern erzählt, die ihr behütetes Leben verlassen und auf die schiefe Bahn geraten. Die Metaphorik des Textes, insbesondere die Unterscheidung zwischen äußerer Handlung und innerer Bedeutung, wird im Detail untersucht. Der Vergleich mit biblischen Gleichnissen und Parabeln, insbesondere dem Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen, wird gezogen, um die Deutungsbedürftigkeit und den allegorischen Charakter des Textes zu belegen. Die Arbeit diskutiert dabei die Übernahme von Motiven und die Abweichungen in der konkreten Handlung vom biblischen Vorbild, analysiert die Symbolik von Hochzeit, Königsschloss und Tal sowie die Bedeutung der "unstäten" Königstöchter im Kontext christlicher Moraltheologie.
Schlüsselwörter
Wilde Rede, Deutungsbedürftige Rede, Allegorie, Der Wilde Alexander, Bibel, Gleichnis, Parabel, Mittelhochdeutsch, Königskinder, Christliche Moraltheologie, Textanalyse, Interpretationsverfahren.
Häufig gestellte Fragen zu "Der Wilde Alexander"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert die Verwendung des Begriffs "wilde rede" im Werk des mittelhochdeutschen Autors "Der Wilde Alexander". Im Mittelpunkt steht die Überprüfung der von Sabine Schmolinsky vorgeschlagenen Interpretation von "wilder rede" als "deutungsbedürftige Rede" anhand verschiedener Texte Alexanders.
Welche Texte werden untersucht?
Die Arbeit untersucht primär das Gedicht "Des richen küniges kint" als Beispiel für "deutungsbedürftige Rede". Zusätzlich werden weitere Texte des Wilden Alexander, wie "Der trügehaft Antikrist" und ein "Kindheitslied", vergleichend analysiert, um die Reichweite und Gültigkeit der Interpretation zu überprüfen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Analyse verwendet interpretative Verfahren, die sich auf die Untersuchung der Textgestaltung, der Metaphorik und der Symbolik konzentrieren. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich mit biblischen Motiven, Gleichnissen und Parabeln, um den allegorischen Charakter der Texte und deren Deutungsbedürftigkeit herauszuarbeiten. Die Arbeit berücksichtigt auch die Bedeutung christlicher Moraltheologie im Kontext der analysierten Texte.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind "wilde Rede", "deutungsbedürftige Rede", "Allegorie", "Der Wilde Alexander", "Bibel", "Gleichnis", "Parabel", "Mittelhochdeutsch", "Königskinder", "Christliche Moraltheologie", "Textanalyse" und "Interpretationsverfahren".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur "deutungsbedürftigen Rede" mit Fokus auf "Des richen küniges kint", ein Kapitel zu weiteren Textbelegen ("Der trügehaft Antikrist" und "Kindheitslied") und eine Zusammenfassung. Die Einleitung definiert den Begriff "wilde rede" und stellt die Arbeit von Sabine Schmolinsky vor, die als Ausgangspunkt der Analyse dient.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, die Anwendbarkeit des Interpretationsansatzes von Sabine Schmolinsky ("deutungsbedürftige Rede") auf weitere Texte des Wilden Alexander zu überprüfen und den Begriff "wilde rede" im Kontext der Textgestaltung und im Lichte biblischer Einflüsse zu analysieren. Die Arbeit untersucht die Verbindung zwischen Textgestaltung und inhaltlicher Botschaft.
Wie wird "Des richen küniges kint" interpretiert?
Das Gedicht "Des richen küniges kint" wird als Allegorie interpretiert, die die Geschichte zweier Königstöchter erzählt, welche ihr behütetes Leben verlassen und in moralisch fragwürdige Situationen geraten. Die Analyse konzentriert sich auf die Metaphorik, die Unterscheidung zwischen äußerer Handlung und innerer Bedeutung und den Vergleich mit biblischen Gleichnissen (z.B. das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen).
- Citation du texte
- Romy Knobel (Auteur), 2008, "wilde rede" beim wilden Alexander, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139337