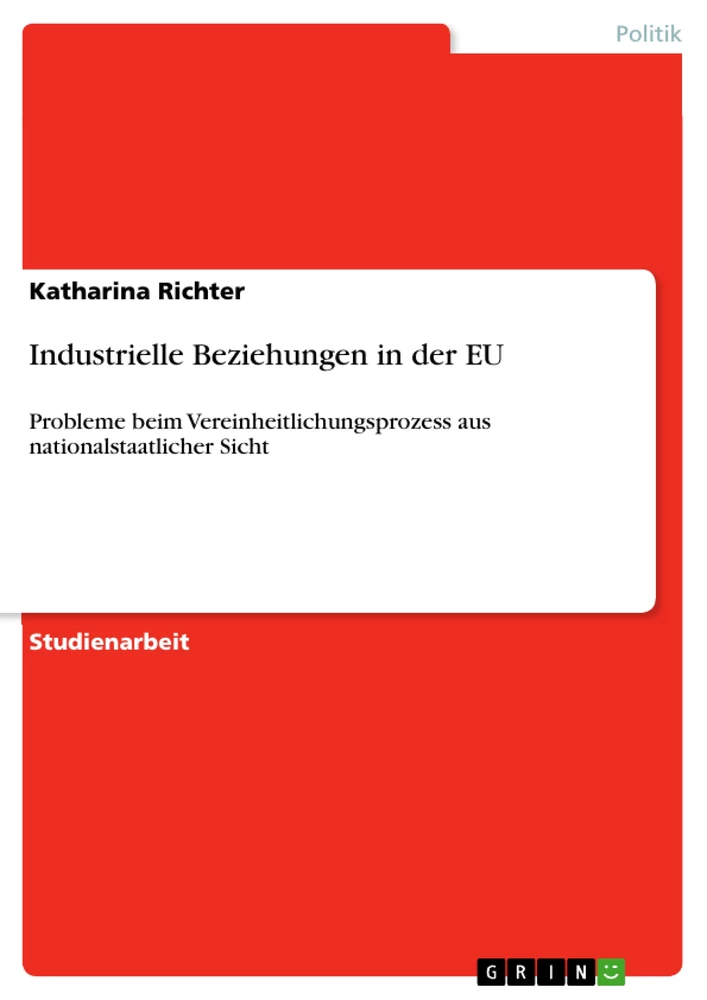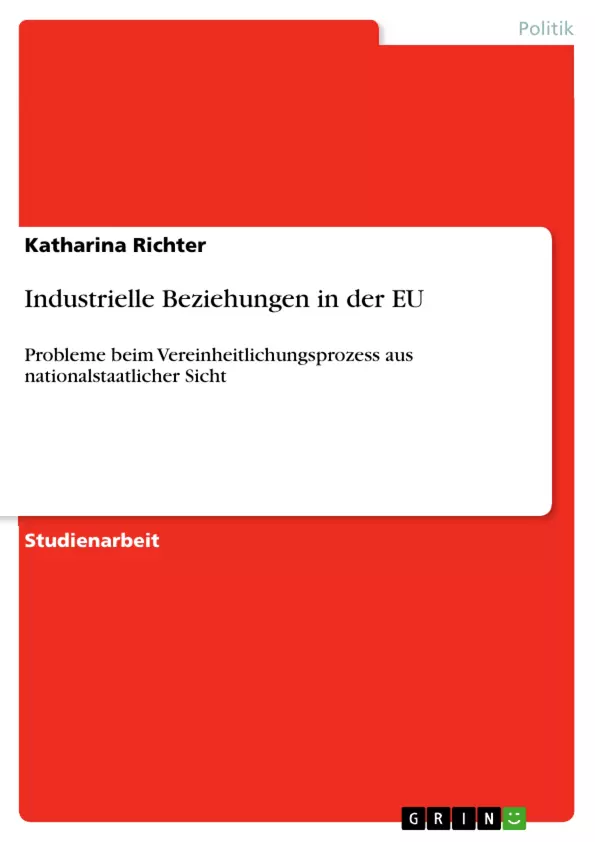Die Europäische Union ist in ihrem Prinzip als partnerschaftlicher politischer Staatenbund von unterschiedlichen Politiken geprägt. Im Zuge des Zusammenschlusses und des weiteren Zusammenwachsens Europas ergibt sich an verschiedenen Stellen die Notwendigkeit, Bündnisse einzugehen und die Politiken zu harmonisieren. Diese Arbeit wird sich damit befassen, welche Rahmenbedingungen und Problemfelder die Angleichung industrieller Beziehungen berühren.
Der zweite Abschnitt der Arbeit wird auf die Struktur industrieller Beziehungen eingehen. Das politische Terrain der Industriellen Beziehungen befasst sich generell mit den Rechten der Parteien in den Arbeitsbeziehungen, der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite. Diese Parteien werden auf EU-Ebene repräsentiert durch organisierte Dachverbände, in denen wiederum die Dachverbände der einzelnen Staaten inkorporiert sind. Auf EU-Ebene heißt hier vornehmlich unter dem Einbezug und der Kontrolle von EU-Organen, im Falle der Industriellen Beziehungen ist die EU-Kommission dieser politischer dritte Hauptakteur.
Diesen Austausch zwischen Arbeitsparteien und politischen dritten Instanzen nennt man den Sozialen Dialog. Der Soziale Dialog stellt das Herzstück industrieller Beziehungen, vor Allem deren Modernisierung und Wandel im Angleichungsprozess, dar. Da der Soziale Dialog eine wesentliche Rolle einnimmt, wird im dritten Teil darauf eingegangen.
Es soll im vierten Teil gezeigt werden, inwiefern der fortgeschrittene Zustand der Wirtschaftsunion mit der noch ausbaufähigen Sozialunion korreliert. Zudem wird auf die verschiedenen Sozialmodelle Europas eingegangen werden und welche Beiträge die EU in der Vergangenheit zur Schaffung eines Europäischen Sozialmodells geleistet hat.
In diesem Zusammenhang sollen Potenziale und Schlupflöcher bestehender Abkommen untersucht werden. Der Fokus liegt letztendlich auf dem von der EU gesetzten Möglichkeit der Gründung Europäischer Betriebsräte (EBR) als Institutionen des Sozialen Dialogs. Praxisnahe Beispiele aus dem Bereich der EBR sollen im fünften Teil der Arbeit die Probleme beleuchten, die bei der praktischen Durchführung von EU-Abkommen auf staatlicher Ebene entstehen.
Die Kommission gibt Handlungsempfehlungen zwecks der Harmonisierung der Sozialmodelle an die Staaten ab. Deren Praktikabilität werden im Schlussteil aufgegriffen und im sechsen Abschnitt am Beispiel Deutschland objektiv interpretiert. Ein Fazit fasst im siebten Abschnitt die gesammelten Ergebnisse zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hypothese und Fragestellung
- Ergänzende Bemerkungen zur Herkunft und Struktur der Arbeit
- Was sind industrielle Beziehungen?
- Der Soziale Dialog – Das Herzstück industrieller Beziehungen
- Industrielle Beziehungen im Europäischen Wirtschaftsraum
- Die vier Sozialmodelle Europas
- Der Wirtschaftsraum Europa
- Vertrag zur Gründung der europäischen Gemeinschaft
- Argumentationsketten der Lissabon-Strategie
- Von der Divergenz zur Konvergenz durch supranationale Regelungen
- Der Europäische Betriebsrat – Das Herzstück des Sozialen Dialogs
- Probleme bei der Vereinheitlichung des Sozialen Dialogs am Beispiel Europäischer Betriebsräte
- Fall Bofrost: Verweigerung von Informationen über die Konzernstruktur
- Fall Kühne+Nagel: Aktiver Boykott des EBR / Mitbestimmungsablehnung
- Der Fall Nokia: Messlatte für den Zustand des Europäischen Sozialmodells?
- Das Europäische Sozialmodell – Versuche der internationalen Angleichung
- Flexicurity an Hand der Offenen Methode der Koordinierung
- Auswirkungen von Flexicurity in Deutschland
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rahmenbedingungen und Problemfelder der Angleichung industrieller Beziehungen in der Europäischen Union. Sie beleuchtet die Rolle des Sozialen Dialogs als Herzstück industrieller Beziehungen und analysiert die Herausforderungen der Vereinheitlichung dieses Dialogs im Kontext der unterschiedlichen Sozialmodelle Europas.
- Die verschiedenen Sozialmodelle in Europa
- Die Bedeutung des Sozialen Dialogs für die Harmonisierung industrieller Beziehungen
- Die Rolle des Europäischen Betriebsrats im Sozialen Dialog
- Die Herausforderungen der transnationalen Stärkung des Sozialen Dialogs
- Die Auswirkungen von EU-Abkommen auf nationaler Ebene
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Hypothese und Fragestellung der Arbeit vor und beschreibt die Struktur des Textes.
- Kapitel 2 definiert den Begriff der industriellen Beziehungen und beleuchtet die Akteure und ihre Rolle in der Sozialpartnerschaft.
- Kapitel 3 erläutert den Sozialen Dialog als Herzstück industrieller Beziehungen und beschreibt dessen Zweck sowie die Beteiligung der Dialogpartner auf EU-Ebene.
- Kapitel 4 beleuchtet den Europäischen Wirtschaftsraum und seine Auswirkungen auf industrielle Beziehungen. Es behandelt die vier Sozialmodelle Europas und die Bemühungen der EU, ein gemeinsames Sozialmodell zu etablieren.
- Kapitel 5 fokussiert auf den Europäischen Betriebsrat als Institution des Sozialen Dialogs und analysiert anhand von Fallbeispielen die Probleme bei der praktischen Durchführung von EU-Abkommen auf nationaler Ebene.
- Kapitel 6 diskutiert die Auswirkungen von Flexicurity und der Offenen Methode der Koordinierung auf die Harmonisierung der Sozialmodelle in Europa.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Themenfeld der industriellen Beziehungen in der EU, dem Sozialen Dialog, den verschiedenen Sozialmodellen Europas, dem Europäischen Betriebsrat, der Vereinheitlichung des Sozialen Dialogs, den Herausforderungen der transnationalen Stärkung des Sozialen Dialogs, den Auswirkungen von EU-Abkommen auf nationaler Ebene und der Harmonisierung der Sozialmodelle.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Soziale Dialog in der EU?
Er ist das Herzstück industrieller Beziehungen und beschreibt den Austausch zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und EU-Organen.
Welche Rolle spielen Europäische Betriebsräte (EBR)?
Der EBR dient als Institution des Sozialen Dialogs auf Unternehmensebene zur Information und Konsultation in transnationalen Konzernen.
Was versteht man unter dem Begriff „Flexicurity“?
Es ist ein arbeitsmarktpolitisches Konzept, das Flexibilität für Arbeitgeber mit sozialer Sicherheit für Arbeitnehmer verbinden soll.
Welche Probleme gibt es bei der Umsetzung von EBR-Abkommen?
Anhand von Fällen wie Bofrost oder Nokia zeigt die Arbeit Schwierigkeiten wie Informationsverweigerung oder Boykott der Mitbestimmung auf.
Gibt es ein einheitliches Europäisches Sozialmodell?
Nein, die Arbeit unterscheidet vier verschiedene Sozialmodelle in Europa, die durch die EU harmonisiert werden sollen.
- Citar trabajo
- Katharina Richter (Autor), 2009, Industrielle Beziehungen in der EU, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139626