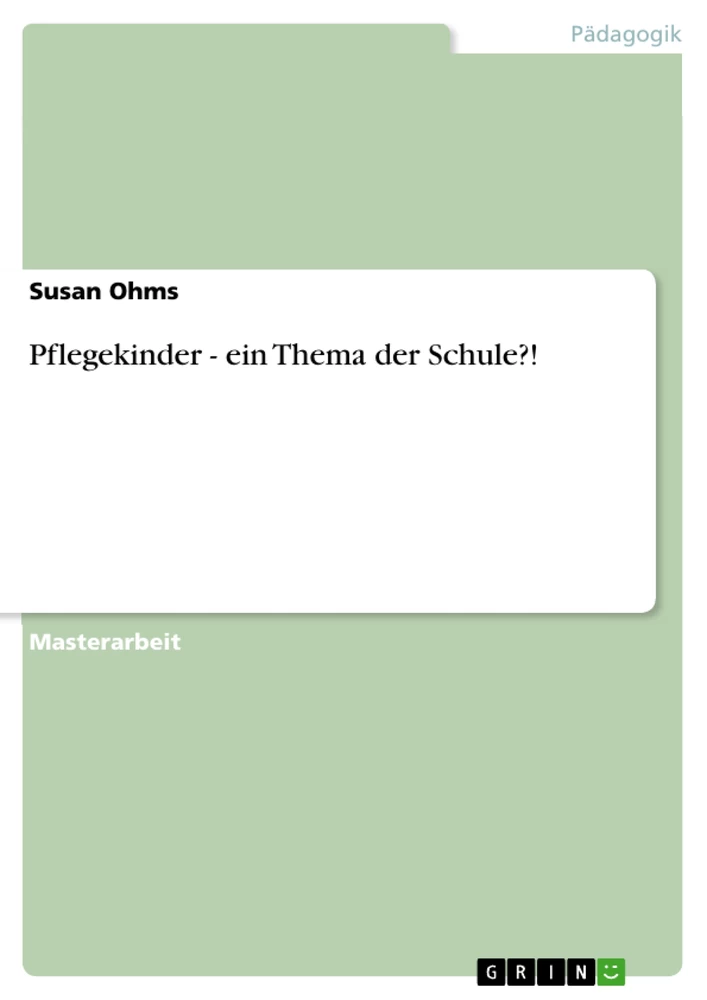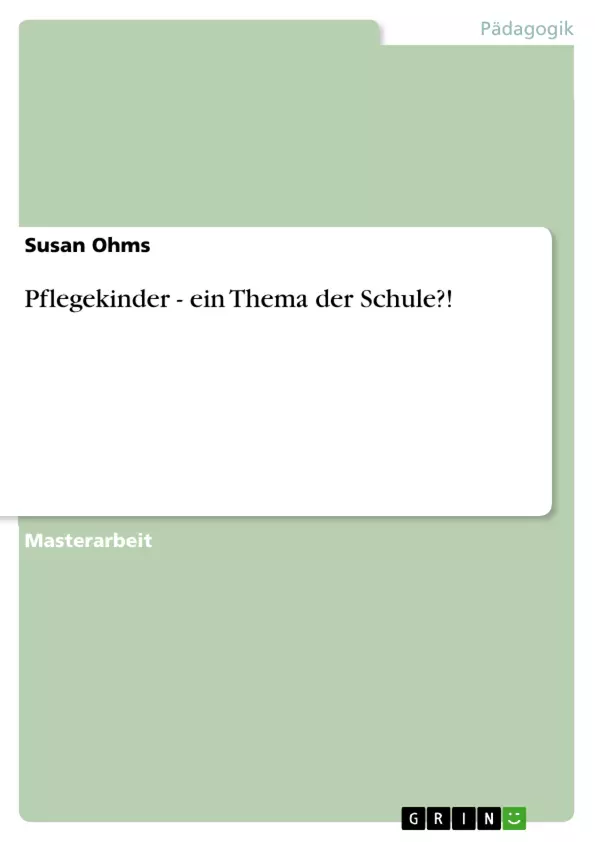In der vorliegenden Masterarbeit zum Thema „Pflegekinder – ein Thema der Schule?!“ soll der Frage auf den Grund gegangen werden, ob Pflegekinder schlechtere Bildungschancen haben. Durch statistische Daten wird erhoben, in welchem Umfang Kinder betroffen und was die Gründe für eine Fremdplatzierung sind. Daraus entwickelt sich die Hypothese, dass Pflegekinder sowohl von sozial emotionalen Problemen als auch kognitiven Beeinträchtigungen in hohem Maße betroffen sind. Das wirft im Rahmen der Inklusion die Frage auf, inwieweit der aktuelle pädagogisch – wissenschaftliche Diskurs die schulische Situation von Pflegekindern abbildet? Es wird die Hypothese aufgestellt, dass in diesem Bereich wenig empirische Forschungsdaten zu finden sind.
Um diese Frage beantworten zu können wird eine systematische Literaturrecherche durchgeführt. In ausgewählten Datenbanken werden knapp 5.000 Datensätze überprüft, woraus sich sechs Studien identifizieren lassen. Die Auswertung der Ergebnisse der Studien bestätigt die Hypothese, dass Pflegekinder in hohem Maße von negativen Schulerfahrungen, geringeren schulischen Leistungen, eingeschränkter physischer und psychischer Gesundheit, einer retardierten sozial emotionalen Entwicklung und hohen Belastungserfahrungen betroffen sind. Risiko- und Schutzfaktoren lassen sich nur in geringem Maße in den Studien wiederfinden, doch können positive Schulerfahrungen, eine hohe Bildungsaspiration und die Vermeidung von schulischer Instabilität als Schutzfaktoren identifiziert werden.
Auch die zweite Hypothese wird bestätigt. Für den deutschsprachigen Raum konnten nur zwei Studien gefunden werden, die sich mit diesem Thema befassen. Es besteht großer Forschungsbedarf, sowohl was die Schulerfahrungen, Schulleistungen, Gesundheit und die sozial emotionale Entwicklung von Pflegekindern in Deutschland betrifft. Vor allem jedoch müssen Schutzfaktoren und Maßnahmen identifiziert werden, die Pflegekindern helfen, im Rahmen einer Bildungsgerechtigkeit, ihr Potenzial voll ausschöpfen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Analyse der Situation von Pflegekindern in Deutschland
- 2.1 Definition
- 2.2 statistische Daten
- 2.3 Bedeutung für das Kind
- 3. Präzisierung der Forschungsfrage
- 3.1 Überlegungen zur Forschungsfrage
- 3.2 Formulierung der Forschungsfrage
- 3.3 Begründung
- 4. Methodisches Vorgehen
- 4.1 Auswahl der relevanten Datenbanken
- 4.2 Suchbegriffe
- 4.3 Suchstring
- 4.4 Ein- und Ausschlusskriterien
- 4.5 Identifizierte Arbeiten
- 5. Auswertung
- 5.1 Studie 1: Evans
- 5.2 Studie 2: Burley, Halpern
- 5.3 Studie 3: McMillen et.al.
- 5.4 Studie 4: Projektgruppe Pflegekinderhilfe
- 5.5 Studie 5: Shin
- 5.6 Studie 6: Wiesch
- 6. Ergebnisse der Auswertung
- 6.1 Formale Auswertung
- 6.2 Inhaltliche Auswertung
- 7. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Frage, ob Pflegekinder in Deutschland schlechtere Bildungschancen haben. Sie analysiert die Situation von Pflegekindern anhand statistischer Daten und entwickelt eine Hypothese, die auf sozial-emotionale und kognitive Beeinträchtigungen bei Pflegekindern im Kontext der Inklusion verweist. Die Arbeit untersucht, inwieweit der wissenschaftliche Diskurs die schulische Situation von Pflegekindern abbildet, und stellt die Hypothese auf, dass es wenig empirische Forschungsdaten in diesem Bereich gibt. Die Arbeit zielt darauf ab, die Hypothese mithilfe einer systematischen Literaturrecherche zu bestätigen oder zu widerlegen und den Forschungsbedarf in Bezug auf die schulischen Erfahrungen, Leistungen, Gesundheit und die sozial-emotionale Entwicklung von Pflegekindern in Deutschland aufzuzeigen.
- Situation von Pflegekindern in Deutschland
- Einfluss von Pflegeverhältnissen auf Bildungschancen
- Forschungsstand zur schulischen Situation von Pflegekindern
- Identifikation von Risiko- und Schutzfaktoren
- Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung der Bildungschancen von Pflegekindern
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Masterarbeit "Pflegekinder - ein Thema der Schule?!" ein und erläutert die Motivation für die Untersuchung. Sie stellt den Forschungsgegenstand dar und beschreibt die Vorgehensweise der Arbeit.
- Kapitel 2: Analyse der Situation von Pflegekindern in Deutschland: Dieses Kapitel beleuchtet die aktuelle Situation von Pflegekindern in Deutschland. Es definiert den Begriff "Pflegekind" und analysiert statistische Daten zum Umfang der Betroffenen sowie zu den Gründen für eine Fremdplatzierung. Es werden die Auswirkungen von Pflegeverhältnissen auf das Kind und die Bedeutung des Themas im Kontext der Inklusion diskutiert.
- Kapitel 3: Präzisierung der Forschungsfrage: Hier wird die Forschungsfrage der Arbeit präzisiert. Es werden Überlegungen zur Forschungsfrage angestellt und die Formulierung sowie die Begründung der Forschungsfrage erläutert.
- Kapitel 4: Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es werden die Auswahl der relevanten Datenbanken, die verwendeten Suchbegriffe, der Suchstring, die Ein- und Ausschlusskriterien sowie die identifizierten Arbeiten erläutert.
- Kapitel 5: Auswertung: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der systematischen Literaturrecherche ausgewertet. Es werden die sechs identifizierten Studien vorgestellt und ihre Ergebnisse hinsichtlich der schulischen Erfahrungen, Leistungen, Gesundheit und der sozial-emotionalen Entwicklung von Pflegekindern analysiert.
- Kapitel 6: Ergebnisse der Auswertung: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Auswertung zusammen. Es werden sowohl die formalen als auch die inhaltlichen Ergebnisse der Studien dargestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Pflegekinder, Bildungschancen, Inklusion, schulische Situation, sozial-emotionale Entwicklung, wissenschaftlicher Diskurs, empirische Forschung, systematische Literaturrecherche, Risiko- und Schutzfaktoren, Bildungsgerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Haben Pflegekinder in Deutschland schlechtere Bildungschancen?
Studien bestätigen, dass Pflegekinder häufiger von negativen Schulerfahrungen, geringeren Leistungen und kognitiven Beeinträchtigungen betroffen sind.
Welche Rolle spielt das Thema Inklusion für Pflegekinder?
Im Rahmen der Inklusion stellt sich die Frage, wie die Schule auf die spezifischen sozial-emotionalen Belastungen dieser Kinder reagieren kann, um Bildungsgerechtigkeit zu fördern.
Wie ist der aktuelle Forschungsstand zu diesem Thema?
Die Arbeit zeigt auf, dass es im deutschsprachigen Raum einen großen Forschungsbedarf gibt, da nur sehr wenige empirische Studien zur schulischen Situation von Pflegekindern existieren.
Was sind bekannte Schutzfaktoren für den Schulerfolg von Pflegekindern?
Als Schutzfaktoren gelten eine hohe Bildungsaspiration, positive Schulerfahrungen und die Vermeidung von häufigen Schulwechseln (schulische Instabilität).
Welche Belastungen erleben Pflegekinder besonders häufig?
Pflegekinder sind oft von einer retardierten sozial-emotionalen Entwicklung sowie eingeschränkter psychischer und physischer Gesundheit betroffen.
- Quote paper
- Susan Ohms (Author), 2022, Pflegekinder - ein Thema der Schule?!, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1399072