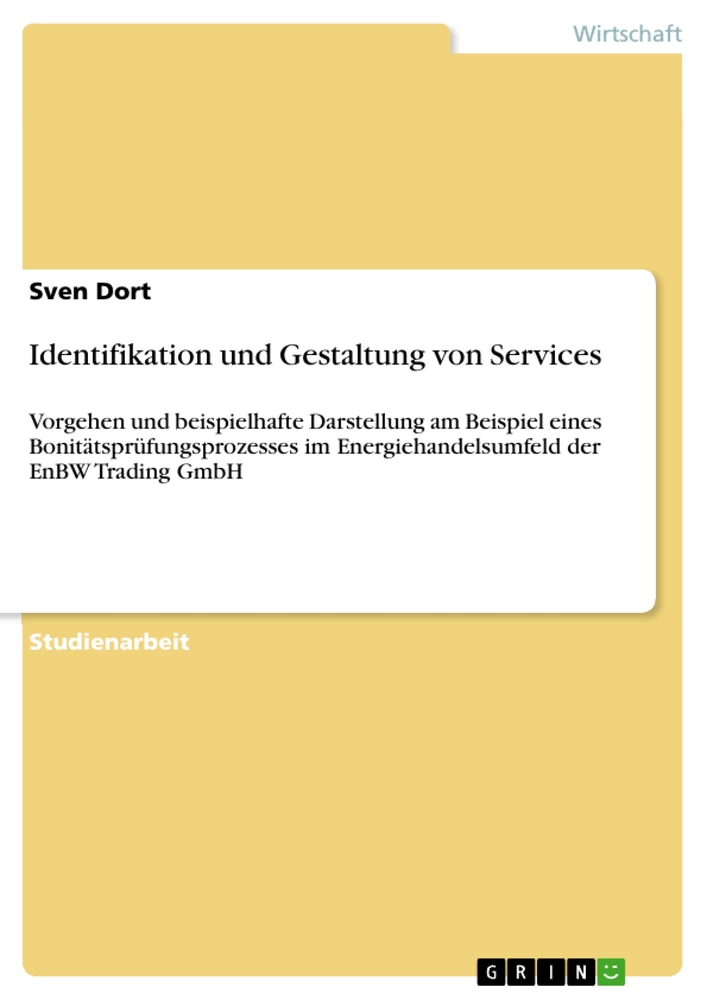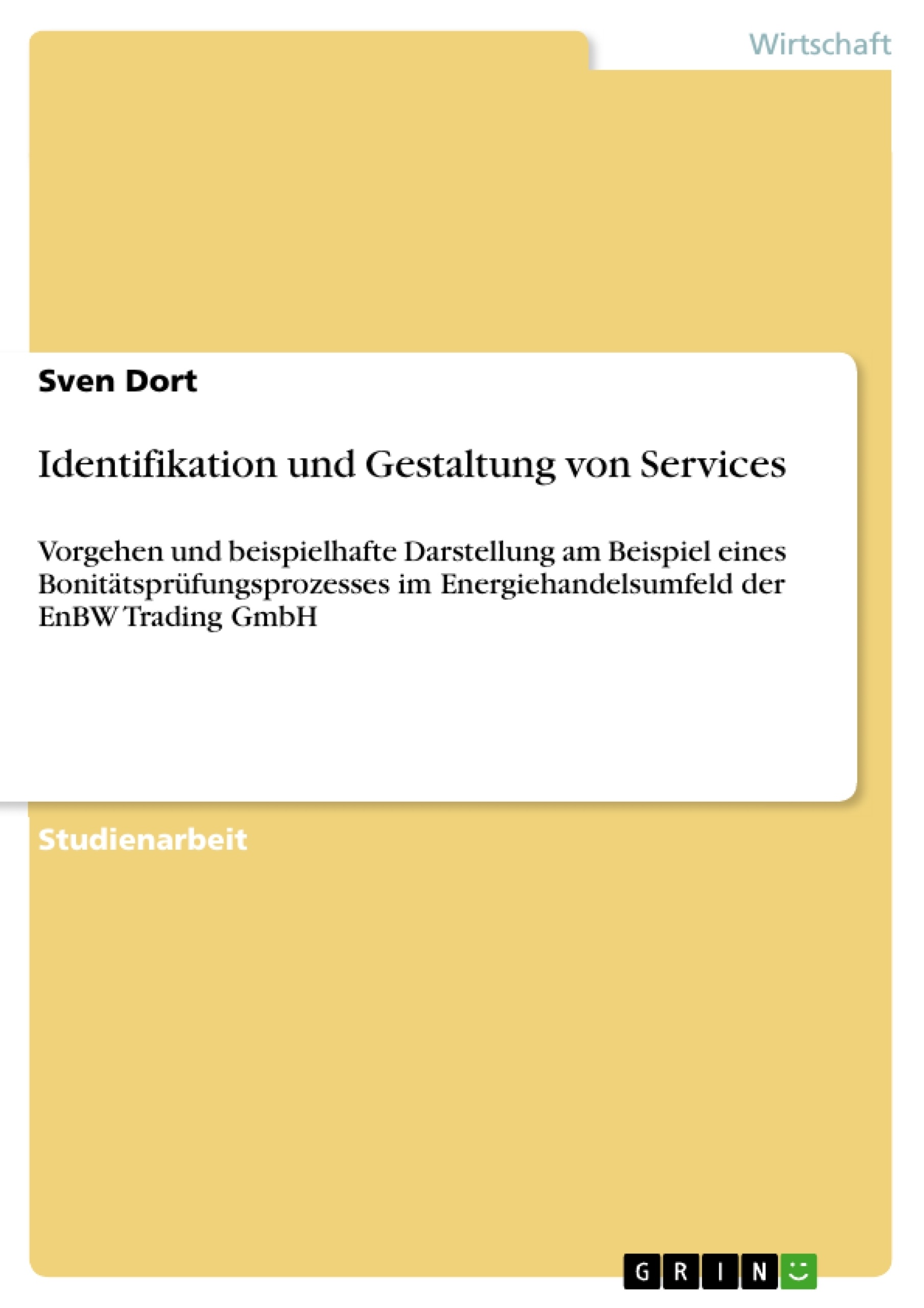Die Finanzkrise ist in aller Munde. Auch die Energiehandelsbranche ist in diesem Zuge einem starken Wandel unterzogen. Wo noch vor kurzer Zeit kaum auf die Bonität der Handelspartner geachtet wurde - man vertraute sich - braucht es nun wirksame Mechanismen zur Risikobegrenzung beim Abschluss von Energiehandelsgeschäften.
Unter dem genannten Aspekt bestehen hohe Anforderungen an die Flexibilität der eingesetzten Systeme, vor allem hinsichtlich schneller Funktionsimplementierung und Wartung, welche die häufig eingesetzten Monolithen nicht erfüllen. Ein weiterer Knackpunkt findet sich in der heterogenen Systemlandschaft, die sich bei Energiehandelsunternehmen, historisch gewachsen, im Einsatz befindet. Diese Punkte schlagen sich häufig durch redundant implementierte Funktionen nieder, die dazu oft noch inkonsistent realisiert sind.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Ziele und Vorgehensweise
2 theoretische Grundlagen
2.1 SOAim Überblick
2.2 Kriterien der Bonitätsermittlung
3 Identifikation von Services
3.1 Analyse der Geschäftsprozesse
3.2 Identifikation von potenziellen Services
4 fachgerechte Gestaltung von Services
4.1 konkrete Serviceinhalte festlegen
4.2 konkrete Serviceinhalte überprüfen
5 technische Umsetzung einer SOA
6 Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Prinzip einer Servicenutzung
Abbildung 2: Ablauf Serviceidentifikation und -gestaltung
Abbildung 3: Geschäftsprozessanalyse für die Serviceidentifikation
Abbildung 4: Vereinfachter Geschäftsprozess nach Serviceidentifikation
Abbildung 5: Gestaltung konkreter Serviceinhalte
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Bonitätskriterien beim Abschluss von Energiehandelsgeschäften
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Die Finanzkrise ist in aller Munde. Auch die Energiehandelsbranche ist in diesem Zuge einem starken Wandel unterzogen. Wo noch vor kurzer Zeit kaum auf die Bonität der Handelspartner geachtet wurde - man vertraute sich - braucht es nun wirksame Mechanismen zur Risikobegrenzung beim Abschluss von Energiehandelsgeschäften.
Unter dem genannten Aspekt bestehen hohe Anforderungen an die Flexibilität der eingesetzten Systeme, vor allem hinsichtlich schneller Funktionsimplementierung und Wartung, welche die häufig eingesetzten Monolithen nicht erfüllen. Ein weiterer Knackpunkt findet sich in der heterogenen Systemlandschaft, die sich bei Energiehandelsunternehmen, historisch gewachsen, im Einsatz befindet. Diese Punkte schlagen sich häufig durch redundant implementierte Funktionen nieder, die dazu oft noch inkonsistent realisiert sind.
Deutlich wird dies bei der vielfach eingesetzten Funktion der Bonitätsprüfung. Immer wenn am Markt ein Energiehandelsgeschäft abgeschlossen werden soll, ist die Bonität des Handelspartners anhand verschiedener Parameter zu prüfen. Da auch diese Größen einer steten Dynamik unterliegen, ist eine Implementierung der sich ändernden Bonitätsprüfungsparameter in allen vorhandenen Handelssystemen notwendig. Das bedingt vor allem einen ressourcenintensiven Umgang mit zeitlichen, humanen und monetären Größen.
Lösung für die genannten Probleme verspricht der Ansatz der serviceorientierten Architektur, kurz SOA. Eine serviceorientierte Architektur beruht auf der losen Kopplung wiederverwendbarer Services. Ein solcher Service bietet Dienstleistungen an [...], z. B. die angesprochene Bonitätsprüfung, [die] bei Bedarf [...] dynamisch von vorhandenen Anwendungen aufgerufen werden [können].1 „Applikationen sollen sich dadurch an geänderte Anforderungen leichter und schneller anpassen lassen.“2
1.2 Ziele und Vorgehensweise
Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, wie bei Identifikation und Gestaltung solcher Services, die nach den Prinzipien einer SOA zur Verfügung gestellt werden sollen, vorgegangen werden kann.
Zur beispielhaften Darstellung der Ausführungen dient in dieser Darstellung die Energiehandelsbranche. Zur konkreten Ausarbeitung wird die Problematik der Bonitätsermittlung beim Abschluss von Handelsgeschäften verwendet. Im Vergleich zur bisher im allgemeinem veröffentlichen Literatur, fokussiert diese Arbeit vor allem die fachliche, nicht die technische, Seite bei der Ausgestaltung von Services. Dennoch wird die technische Seite im Verlauf grobe Erwähnung finden.
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert. Nach der Einleitung werden im zweiten Kapitel die Grundlagen einer SOA im Überblick, sowie die Anforderungen an einen Service dargestellt. Weiterhin findet sich in diesem Kapitel eine Erläuterung zu typischen Kriterien für eine Bonitätsermittlung beim Abschluss von Energiehandelsgeschäften. Kapitel drei umfasst die praktischen Ausführungen für die Identifikation von Services am konkreten Beispiel der Bonitätsermittlung für den Abschluss von Handelsgeschäften bei Energiehandelsunternehmen. Kapitel vier beschäftigt sich mit der Servicegestaltung, also den festzulegenden Inhalten des zuvor identifizierten Service. Daneben wird hier die Ausprägung des Service überprüft. Kapitel fünf beschäftigt sich kurz mit einer zusammenfassenden Darstellung des technischen Aufbau einer SOA. Kapitel sechs schließt die Arbeit mit einer kritischen Würdigung und einem Ausblick ab.
2 theoretische Grundlagen
2.1 SOA im Überblick
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sei folgende Definition gegeben:
„Eine Service-orientierte Architektur ist ein Framework für die Integration von Geschäftsprozessen und unterstützender IT-Infrastruktur in Form von sicheren, standardisierten Komponenten - Services -, die sich wiederverwenden und kombinieren lassen, um wechselnde Geschäftsanforderungen abzubilden.“3
Technisch betrachtet, lässt sich SOA wie folgt beschreiben:
SOA ist eine unternehmensweite IT-Architektur, die die lose Kopplung, Wiederverwendung und Interoperabilität zwischen Systemen unterstützt.”4
Das Prinzip einer Servicenutzung ist schematisch in Abbildung 1 dargestellt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Prinzip einerServicenutzung
Die Anwendung, die einen bestimmten Service nutzen möchte, heißt Service Requestor. Dazu wird in einem Verzeichnisdienst, dem Service Broker, nach einem entsprechenden Service gesucht (finden). Ähnlich den gelben Seiten werden vom Service Broker alle Services aufgelistet, die im Netz verfügbar sind. Die Anbieter heißen bei einer SOA Service Provider (anbieten). Der Service Broker vermittelt dem Service Requestor den passenden Service Provider. Der Service Requestor kann den passenden Service nun koppeln (binden) und damit verwenden.5
Unter einen Service versteht man speziell folgendes:
„Services sind Softwarekomponenten, die so konstruiert sind, dass sie sich auf einfache Weise mit anderen Softwarekomponenten verbinden lassen. Die Idee dahinter: Software soll in Komponenten (Services) dargestellt werden, die nicht nur für Programmierer, sondern auch für Mitarbeiter aus Fachabteilungen verständlich sind.“6 Letzteres verdeutlicht den Drang hin zur Fachlichkeit und weg von einer allzu technischen Betrachtung.
Ein wie oben beschriebener Service muss nun folgenden Anforderungen gerecht werden:
1. „Er soll übergreifend über mehrere Ausprägungen einer Problemstellung einsetzbar sein.
2. „Er soll die redundante Implementierung von Funktionalitäten weitgehend vermeiden.“
3. „Er soll möglichst schnell und unkompliziert genutzt werden können.“7
2.2 Kriterien derBonitätsermittlung
Quantitative Beurteilungskriterien lassen sich in der Regel auf zwei unterschiedliche Arten finden. Zum einen ist ein Rückgriff auf bereits vorhandenes, externes Sekundärmaterial möglich, beispielsweise die Ratings der Gesellschaften Mody's oder Standard & Poors. Dieses Material soll nicht im Fokus der Betrachtung dieser Darstellung stehen und wird deshalb nicht weiter vertieft. Zum anderen lässt sich ein unternehmensinternes Rating, welches mit eigens dafür bestimmten Beurteilungskriterien ausgestattet ist, erstellen. Auf dem zuletzt genannten wird der Blick dieserVorstellung gerichtet sein.
Grundlage für die Bonitätsermittlung von Handelspartnern bildet stets der Jahresabschluss des zu ratenden Unternehmens. Aus diesen Daten werden verschiedene quantitative Kennzahlen abgeleitet, die sich aus den folgenden Bereichen ergeben: Unternehmensgröße, Vermögen, Verschuldung und Tilgung, Fristenkongruenz, Rentabilität und Entwicklungstendenzen des Unternehmens.8
Aus Vereinfachungsgründen und einer bestehenden Nichtveröffentlichungsklausel für unternehmensinterne Dokumente der EnBW Trading GmbH wird im weiteren Verlauf folgende Definition für die Ermittlung der Bonität gelten:
„Eine der wichtigsten Kenngrößen für die Ermittlung der Handelsbonität für externe Geschäftspartner ist die Eigenkapitalquote. Die Eigenkapitalquote ergibt sich aus dem Verhältnis von Gesamtkapital zum Fremdkapital eines Handelspartners.“9
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bonitätsbewertungsgrundlage lassen sich in der dargestellten Formel deutlich erkennen: Fremdkapital und Gesamtkapital des zu ratenden Unternehmens.
Die Höhe der Eigenkapitalquote ist ausschlaggebend für die Höhe der eingeräumten Bonität. Eine Eigenkapitalquote unter einem bestimmten Schwellwert verlangt die Hinterlegung einer Sicherungsleistung, [...] welche auch in Form einer Bankgarantie erfolgen kann [...] und so ebenfalls zu ausreichender Handelsbonität führt.10
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Bonitätskriterien beim Abschluss von Energiehandelsgeschäften
3 Identifikation von Services
Es hat sich gezeigt, dass sich anhand von Anwendungen konkretisierte Geschäftsprozesse in der Regel aus mehreren Teilfunktionen - potenzielle Services - zusammensetzen. Um die eingangs erwähnten Applikationen nun serviceorientiert zu gestalten, ist es erforderlich, vorhandene bzw. neu zu gestaltende Geschäftsprozesse auf die Fähigkeit zur Ausprägung von Services hin zu untersuchen und danach (Kapitel 4) die identifizierten Services fachlich auszugestalten.
Abbildung 2 zeigt das folgend beschriebene Vorgehen in Kürze:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: AblaufServiceidentifikation und -gestaltung
3.1 AnalysederGeschäftsprozesse
Als Ausgangspunkt dienen die in Geschäftsprozessen zusammengefassten Vorgänge verschiedener Handelsgeschäftsarten (kurz-, mittel-, langfristig). Man analysiert die Geschäftsprozesse dafür stufenweise, um herauszufinden wie die Aktionen im einzelnen aussehen. Einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung ist es dabei, eine geeignete Granularität für die Analyse der
Geschäftsprozesse zu finden.11 Die Erfahrung zeigt, dass sich dafür jedoch keine allgemeingültige Regelung treffen lässt, sondern die Analysetiefe an der jeweiligen Situation auszurichten ist.
Abbildung 3 macht das am hier besprochenen Beispiel deutlich.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Geschäftsprozessanalyse für die Serviceidentifikation
3.2 Identifikation von potenziellen Services
Zur Identifikation der Services bietet sich an, die bereits erstellten Geschäftsprozessdiagramme zu vereinfachen. Mehrfach modellierte Aktionen werden zusammengefasst. Es ist darauf zu achten, dass die Aktionen gleich benannt werden, um spätere Fehlinterpretationen auszuschließen.12 Am konkreten Beispiel bedeutet dies, den Prozess der Bonitätsermittlung aus Abbildung 3 vereinfacht darzustellen. Abbildung 4 macht dies deutlich.
[...]
1 vgl. http://www.symposion.de/7cmslesen/q0002140_27870101_14.02.2009
2 http://www2.informationweek.de/soa/_14.02.2009
3 http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/faq/_15.02.2009
4 ebd._15.02.2009
5 vgl. STAUD, JOSEF: Wirtschaftsinformatik - Eine Übersicht, o. O., 2006, S. 30
6 http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/faq/_15.02.2009
7 WINKLER, VERONIKA: Identifikation und Gestaltung von Services in Wirtschaftsinformatik, Bd. 49, 2007, S. 257
8 vgl. BIERHALS, RONNY / VON OERTZEN, JULIA / SCHWANINGER, OLAF: internes Konzept Kreditrisikomanagement EnBW Trading GmbH, Karlsruhe, 2008, S. 19
9 ebd., S. 23
10 vgl. ebd., S. 26
11 http://act-consulting.de/act-consulting/DE/Unternehmen/Publikationen.htm_15.02.2009
12 vgl. WINKLER, VERONIKA: Identifikation und Gestaltung von Services in Wirtschaftsinformatik, Bd. 49, 2007, S. 257
- Citar trabajo
- Sven Dort (Autor), 2009, Identifikation und Gestaltung von Services, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140015