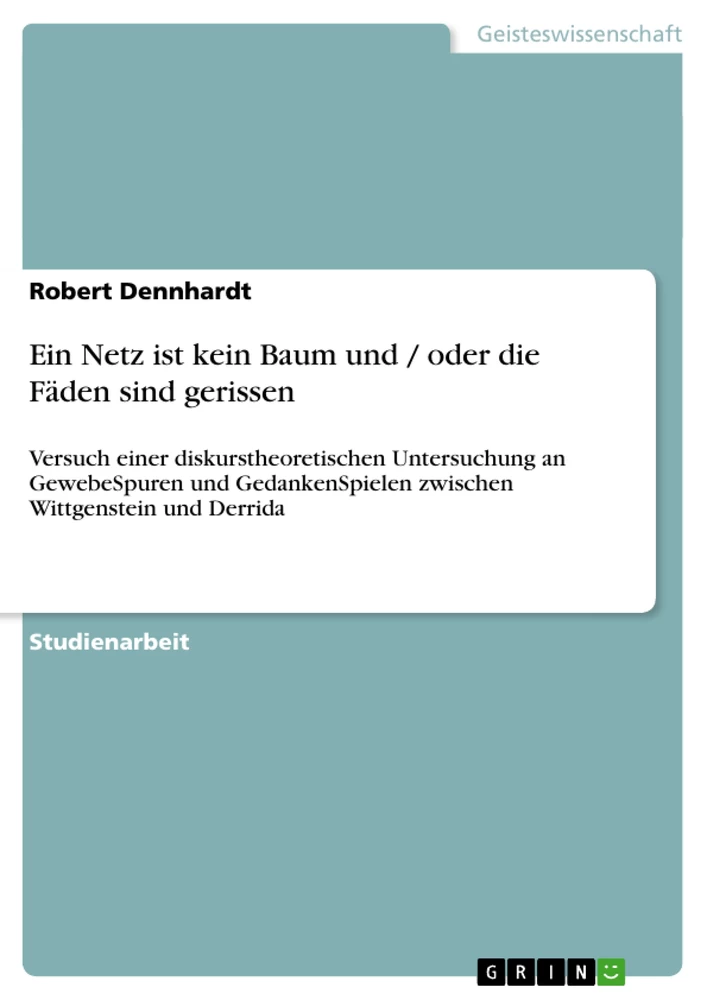Im ersten Teil sei der Versuch unternommen, einen metaphorologischen Übergang nachzuzeichnen als Folge eines epistemologisch-methodischen Bruchs im Denken Wittgensteins. Einen ersten Hinweis auf das Mißtrauen seiner Worte und Begriffe im Tractatus gegenüber dem Sprechen seines Textes als ein Netz oder Labyrinth (Eco) gibt Wittgenstein in seinem 1945 geschriebenen Vorwort zu den Philosophischen Untersuchungen, und eine Vermutung über den Stil des Philosophierens überhaupt wagte er schließlich als Notiz zu seinen Untersuchungen:
"Philosophie dürfte man eigentlich nur dichten. Daraus muß sich, scheint mir, ergeben, wie weit mein Denken der Gegenwart, Zukunft oder Vergangenheit angehört: Denn ich habe mich damit auch als einen bekannt, der nicht ganz kann, was er zu können glaubt." (Wittgenstein)
Der zweite Teil wird versuchen, die verführerische und scheinbar universale Macht der geometrisch-topologischen Metaphern bei Derrida aufzuzeigen. In diesem Zusammenhang nähere ich mich einem zentralen Problemfeld in Derridas Denken und Schaffen. Von Philosophen und Literaturwissenschaftlern gleichermaßen vorgeworfen wird ihm vor allem diskurstheoretische Beliebigkeit und interpretatorische Willkür. Als eine Hauptursache dafür sei Derridas Verwendung von topologisch kongruenten Metaphern bezüglich jeder diskursiven Skalierung als metaphorologische Selbstähnlichkeit herausgearbeitet. Damit lehnt er vor allem jede traditionell-philosophische Rede ab, die sich ausschließlich „entlang der diskursiven Lineariät einer Ordnung von Begründungen verschiebt.“ (Derrida) Eine entscheidende strategische Ursache ist, daß Derrida nach Lévi-Strauss vor allem auf die identisch-zentalen Episteme der klassischen wissenschaftlichen oder philosophischen Diskurse verzichten möchte:
"Im Gegensatz zum epistemischen Diskurs muß der strukturelle Diskurs über die Mythen, der mytho-logische Diskurs selbst mythomorph sein. Er muß die Form dessen haben, worüber er spricht [also ausdrücklich selbstähnlich]." (Derrida)
Inhaltsverzeichnis
- Überblick und Eingang
- I Wittgensteins SchnurGerade ins Netz
- Wir sind halluzinierende Automaten, die beim Schwimmen im Ozean einer ewigen und gesetzmäßigen Welt nur eine Richtung kennen.
- II Derridas SpurenSpiel im Meer
- Seid mit euren elysischen Träumen zufrieden, denn auf der Erde ist ein erfüllter Traum ohne-hin bloß ein wiederholter.
- AnSchlüsse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text befasst sich mit der diskurstheoretischen Untersuchung von Gedankenspuren und GewebeSpuren zwischen Wittgenstein und Derrida. Er untersucht den epistemologischen Bruch im Denken Wittgensteins und die Verwendung von topologisch kongruenten Metaphern bei Derrida. Darüber hinaus werden die verführerische Macht der geometrisch-topologischen Metaphern, die diskurstheoretische Beliebigkeit und interpretatorische Willkür bei Derrida, sowie der epistemologische Status und strukturalen Modus des Gedankens an sich beleuchtet.
- Die epistemologischen Brüche im Denken Wittgensteins
- Die Verwendung von topologisch kongruenten Metaphern bei Derrida
- Die diskurstheoretische Beliebigkeit und interpretatorische Willkür bei Derrida
- Der epistemologische Status und strukturalen Modus des Gedankens an sich
- Die Beziehung zwischen Denken, Schreiben und Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
Überblick und Eingang
Der Einleitungsteil stellt die Problematik des Denkens in Form von Linien, Feldern und Netzen dar und erläutert die Notwendigkeit einer Orientierung im Labyrinth der Gedanken, die sich aus dem Schreiben ergibt. Der Text verweist auf die Schriften von Wittgenstein und Derrida als Ausgangspunkt für die Untersuchung.
I Wittgensteins SchnurGerade ins Netz
Dieser Abschnitt beleuchtet die Entwicklung des Denkens Wittgensteins vom Tractatus zu den Philosophischen Untersuchungen. Er zeigt die Veränderung von der logischen Klärung der Gedanken hin zum Kampf gegen die Verwirrung des Verstandes durch die Sprache. Dabei wird der Stil des Philosophierens als ein eher literarisch-aphoristischer Stil beschrieben, der dem Prozeßhaften im „Sprechen der Sprache” näherkommt.
II Derridas SpurenSpiel im Meer
Dieser Abschnitt untersucht die Verwendung von Metaphern bei Derrida, insbesondere die geometrisch-topologischen Metaphern, die für seine diskurstheoretische Beliebigkeit und interpretatorische Willkür verantwortlich gemacht werden. Der Text verdeutlicht, wie Derrida durch die Verwendung von Metaphern traditionelle philosophische Diskurse in Frage stellt und eine alternative Form des Denkens vorschlägt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Wittgenstein, Derrida, Diskurs, Metapher, Topologie, Sprache, Denken, Schreiben, Epistemologie, Struktur, Selbstähnlichkeit, Rhizom, Netz, Labyrinth, Schifffahrt, Gedankenlinie, Gedankenbündel, SpurenSpiel, GewebeSpuren.
- Citar trabajo
- Robert Dennhardt (Autor), 2000, Ein Netz ist kein Baum und / oder die Fäden sind gerissen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140828