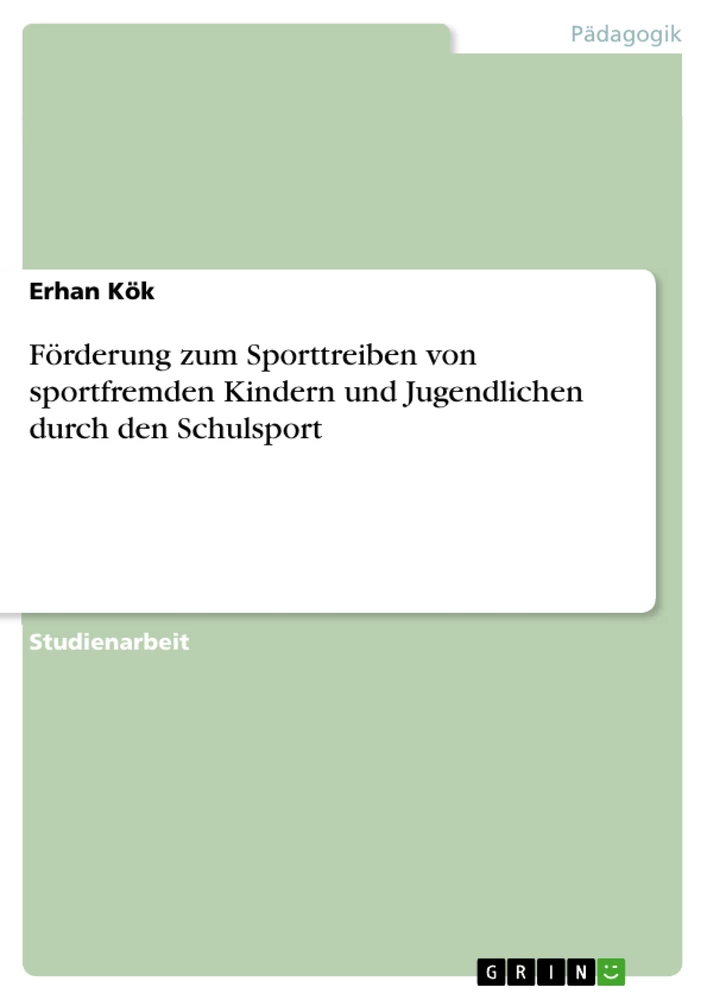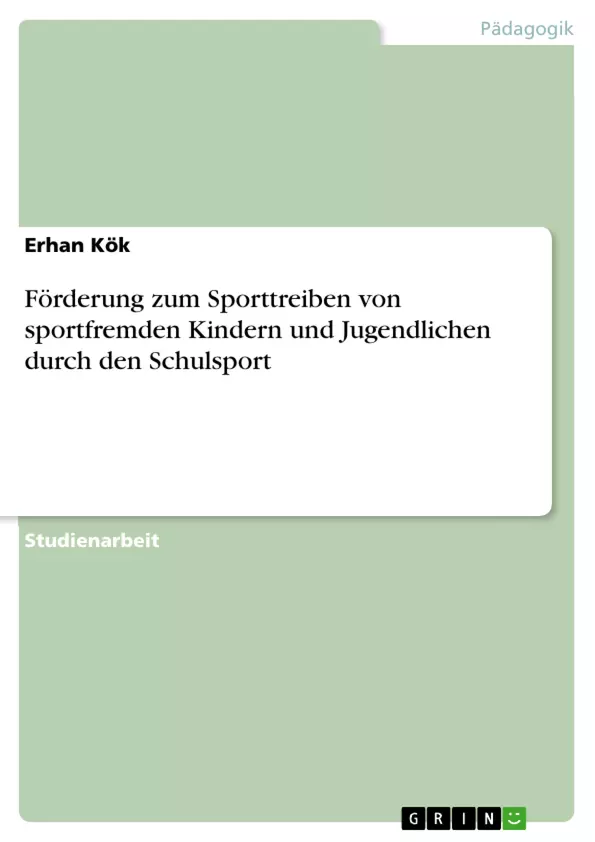Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage: "Was kann der Schulsport leisten, um die sportfernen Kinder und Jugendliche zu einem Sporttreiben zu motivieren?" Um diese Fragestellung zu beantworten, wird zunächst auf theoretische Grundlagen der Sozialisation im Sport eingegangen. Dadurch soll ein Einblick in Sozialisationsprozesse im Sport gewährt werden. Auch das Selbstkonzept im Sport spielt hierfür eine Rolle.
Außerdem soll durch empirische Befunde anhand des Vereinssports erarbeitet werden, welche Kinder und Jugendliche sportlich aktiv sind und welche eher weniger. Mögliche Gründe für das Fernbleiben von sportlicher Aktivität bestimmter Personengruppen sollen beleuchtet werden, um anschließend Lösungsansätze für den Schulsport zu formulieren.
Die Sozialisation ist "der Prozeß der Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit in wechselseitiger Abhängigkeit von der gesellschaftlich vermittelten sozialen und materiellen Umwelt. Vorrangig thematisch ist dabei die Frage, wie der Mensch sich zu einem gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekt bildet". In einer weiteren Definition wird sich weniger auf das Individuum, sondern eher auf die sozialen Interaktionen bezogen. Bei dieser Definition geht es um das Zusammenleben von Menschen, die dabei ausgetauschten und kultivierten Erfahrungen und Fertigkeiten und das geteilte Wissen. Beide dieser Definitionen basieren auf interaktionalen Sozialisationstheorien, welche seit den 1960er Jahren einen Eingang in die Sozialisationsforschung gefunden haben. Die interaktionalen Sozialisationstheorien befassen sich mit den Spannungsverhältnissen zwischen den vorherrschenden sozialen Strukturen und der eigenständigen individuellen Persönlichkeit. Sozialisationsprozesse können geplant und beabsichtigt werden, jedoch finden sie häufig auch unbewusst statt. Zudem finden diese Prozesse lebenslang statt.
In dieser Arbeit soll es speziell um die sportbezogenen Sozialisationsprozesse gehen. Die Körper- und Bewegungssozialisation umfassen Bewegungstätigkeiten, die gesellschaftlich als Sport definiert werden. Es werden hierfür verschiedenste Bewegungstätigkeiten in Betracht gezogen. Hierzu zählen unter anderem explorative, spielerische, expressive, impressive und instrumentelle Bewegungstätigkeiten. Kinder und Jugendliche erwerben durch diese Formen der Bewegungstätigkeit Körper- und Bewegungserfahrungen, welche den Zugang zu Sporttätigkeiten eröffnen und auch die zukünftige Zuwendung zum Sport beeinflussen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlage
- 2.1 Sozialisation im Sport
- 2.2 Selbstkonzept im Sport
- 3. Wer findet den Weg in den Sportverein und wer nicht?
- 4. Erklärung zur Sportbeteiligung von unterrepräsentierten Gruppen
- 4. 1 Kulturelle Differenzen
- 4. 2 Sozioökonomische Ungleichheit
- 4.3 Ethnische Diskriminierung
- 4.4 Geschlechtertypisierung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, wie der Schulsport dazu beitragen kann, sportferne Kinder und Jugendliche zur sportlichen Aktivität zu motivieren. Sie analysiert dazu theoretische Grundlagen der Sozialisation im Sport und beleuchtet das Selbstkonzept im Sport. Anhand empirischer Befunde zum Vereinssport werden die Gründe für die unterschiedliche Sportbeteiligung verschiedener Personengruppen untersucht, um Lösungsansätze für den Schulsport zu entwickeln.
- Sozialisation im Sport: Einflussfaktoren, Prozesse und Herausforderungen
- Selbstkonzept im Sport: Die Rolle der sportlichen Aktivität für die Selbstwahrnehmung
- Ursachen für Sportfernbleiben: Kulturelle Differenzen, sozioökonomische Ungleichheit, ethnische Diskriminierung und Geschlechtertypisierung
- Lösungsansätze für den Schulsport: Förderung der Sportmotivation und Inklusion
- Zusammenfassung der empirischen Befunde zur Sportbeteiligung verschiedener Gruppen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Ziele der Arbeit dar. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Sozialisation im Sport, wobei die Interaktion zwischen Umwelt und Person sowie die Rolle verschiedener Sozialisationsinstanzen (z.B. Familie, Schule, Peer-Gruppe) im Mittelpunkt stehen. Kapitel 2.2 beschäftigt sich mit dem Selbstkonzept im Sport und den Auswirkungen von sportlicher Aktivität auf die Selbstwahrnehmung. Kapitel 3 analysiert die Faktoren, die den Zugang zum Sportverein beeinflussen, während Kapitel 4 unterschiedliche Ursachen für das Sportfernbleiben von unterrepräsentierten Gruppen untersucht. Die Arbeit schließt mit einem Fazit, das die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Sozialisation im Sport, Selbstkonzept, Sportmotivation, Sportfernbleiben, Sportbeteiligung, unterrepräsentierte Gruppen, Kulturelle Differenzen, Sozioökonomische Ungleichheit, Ethnische Diskriminierung, Geschlechtertypisierung, Schulsport, Inklusion, empirische Befunde.
- Citar trabajo
- Erhan Kök (Autor), 2020, Förderung zum Sporttreiben von sportfremden Kindern und Jugendlichen durch den Schulsport, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1417541