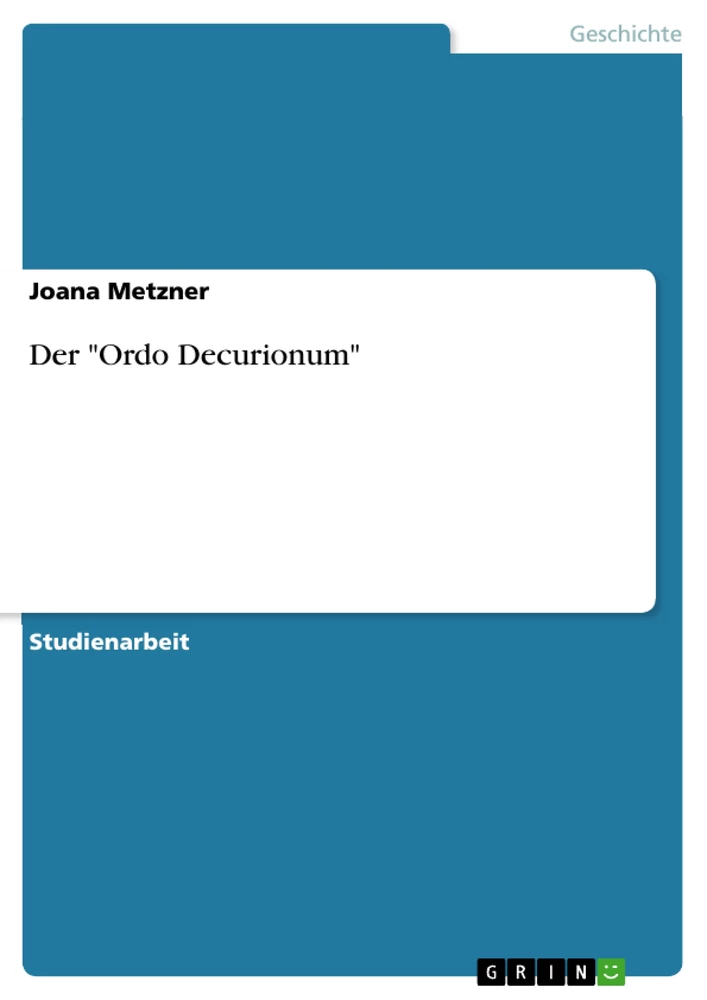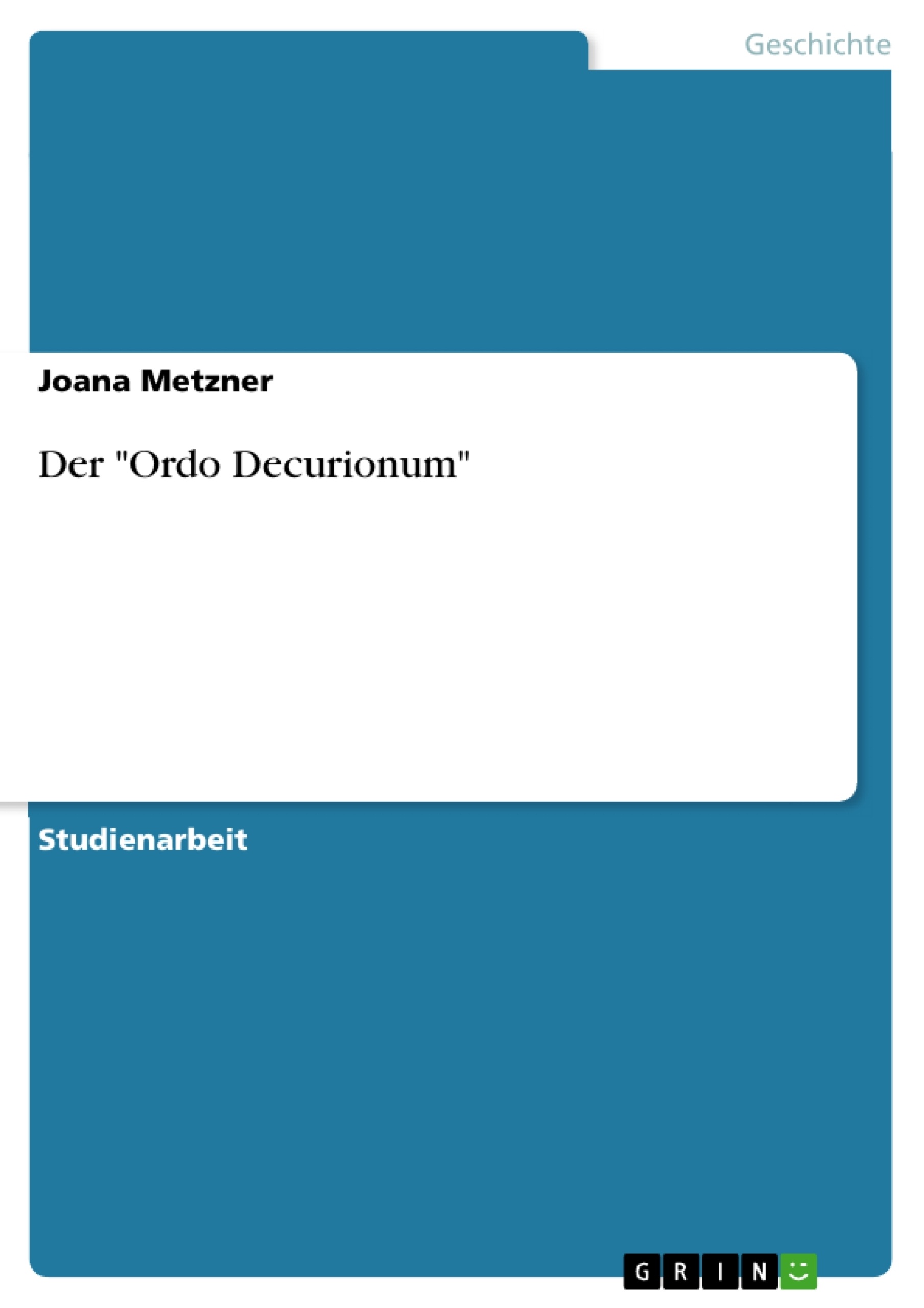Das Städtewesen sollte Gebiete und Menschen in das römische Leben
integrieren und zwar auf politischer, sozialer und wirtschaftlicher Ebene. Somit konnten ungünstige Faktoren aufgelockert und sogar beseitigt werden. Dafür wurden Ämter geschaffen, denn mit diesen waren nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte und finanzielle Anreize verbunden, welche das Leben außerhalb Roms sonst nicht geboten hätte.2
Wichtig hierbei war jedoch, dass den Städten ein gewisses Maß an libertas, an innenpolitischer Selbständigkeit, verliehen wurde. Zwar waren die Städte des Römischen Imperiums der Stadt Rom nachempfunden, doch im Einzelnen verfügten sie über eine Verwaltung, welche der jeweiligen Stadt entsprach.
Aus diesem Grund wurde die Administration auch nur da neu aufgebaut, wo sie noch nicht vorhanden war. Die Selbstverwaltung der Städte sollte so von statten gehen, dass sie dem Reich diente. Erst in der Spätantike kam es verstärkt zu eingriffen in die Autonomie der Städte und das vor allem durch die Institutionen des curators und defensors.3
[...]
1 Rupprecht, G.: Untersuchungen zum Dekurionenstand in den Nordwestlichen Provinzen des römischen Reiches, 1975, S. 33.
2 Vgl. Ebd. S.39.
3 Rupprecht, G.: Untersuchungen zum Dekurionenstand in den Nordwestlichen Provinzen des römischen Reiches, 1975, S. 41.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der ordo decurionum in der hohen Kaiserzeit
- Soziale Struktur und Herkunft
- Qualifikation zum Dekurionenamt
- Rechtliche Grundlagen
- Ämter und Zuständigkeiten
- Soziale Struktur und Herkunft
- Wandel in der späten Kaiserzeit: von der Selbstbestimmung zur Zwangsverpflichtung des Dekurionenstandes
- Ämter der Dekurionen
- Munera und Steueraufkommen
- curator rei publicae und der defensor
- Plinius der Jüngere: exemplarisches Beispiel für den rechtlichen Wandel im Dekurionenrat
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rolle und den Wandel des Dekurionenstandes im Römischen Reich. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung vom ordo decurionum in der hohen Kaiserzeit hin zur späten Kaiserzeit und den damit verbundenen Veränderungen in der sozialen Struktur, den Aufgaben und der rechtlichen Grundlage dieses wichtigen Gremiums.
- Die soziale Struktur und Herkunft der Dekurionen in der hohen Kaiserzeit
- Die rechtlichen Grundlagen und Qualifikationen für das Dekurionenamt
- Die Aufgaben und Zuständigkeiten des Dekurionenstandes
- Der Wandel des Dekurionenstandes in der späten Kaiserzeit, insbesondere die Einführung der Zwangsverpflichtung
- Die Rolle des curator rei publicae und des defensor bei der Eingriffe in die Autonomie der Städte
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Einleitung und stellt die Bedeutung der römischen Städte im Rahmen des römischen Reiches dar. Es zeigt die Notwendigkeit der inneren Autonomie, die den Städten zugestanden wurde, und die Rolle des ordo decurionum bei der Verwaltung der Städte.
Kapitel Zwei befasst sich mit dem ordo decurionum in der hohen Kaiserzeit. Es analysiert die soziale Struktur, die Herkunft der Dekurionen und die Qualifikation zum Dekurionenamt.
Im dritten Kapitel wird der Wandel in der späten Kaiserzeit untersucht. Es geht um die Veränderungen im Dekurionenstand, die Einführung der Zwangsverpflichtung und die zunehmende Eingriffe in die Autonomie der Städte durch die Institutionen des curators und des defensors.
Das vierte Kapitel präsentiert ein exemplarisches Beispiel für den rechtlichen Wandel im Dekurionenrat am Beispiel von Plinius dem Jüngeren.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Konzepte der Arbeit sind ordo decurionum, Selbstverwaltung, innere Autonomie, soziale Struktur, Herkunft, Qualifikation, Zwangsverpflichtung, curator rei publicae, defensor, Römisches Reich, hohe Kaiserzeit, späte Kaiserzeit, Stadtverwaltung.
Häufig gestellte Fragen
Was war der „Ordo Decurionum“?
Der Ordo Decurionum war der Rat der städtischen Oberschicht im Römischen Reich, der für die lokale Selbstverwaltung verantwortlich war.
Wie qualifizierte man sich für das Dekurionenamt?
Voraussetzungen waren in der Regel ein gewisses Mindestvermögen, ein unbescholtener Ruf und die Zugehörigkeit zur lokalen Elite.
Wie veränderte sich der Stand in der Spätantike?
Von einem erstrebenswerten Ehrenamt wandelte sich die Position zur Zwangsverpflichtung, da die Dekurionen persönlich für das Steueraufkommen hafteten.
Wer waren der „Curator“ und der „Defensor“?
Dies waren kaiserliche Beamte, die zunehmend in die Autonomie der Städte eingriffen und die lokale Verwaltung überwachten.
Welche Rolle spielten die Städte für das Römische Reich?
Städte dienten als Instrumente der Integration, um Menschen politisch, sozial und wirtschaftlich in das römische Leben einzugliedern.
- Quote paper
- Joana Metzner (Author), 2008, Der "Ordo Decurionum", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141887