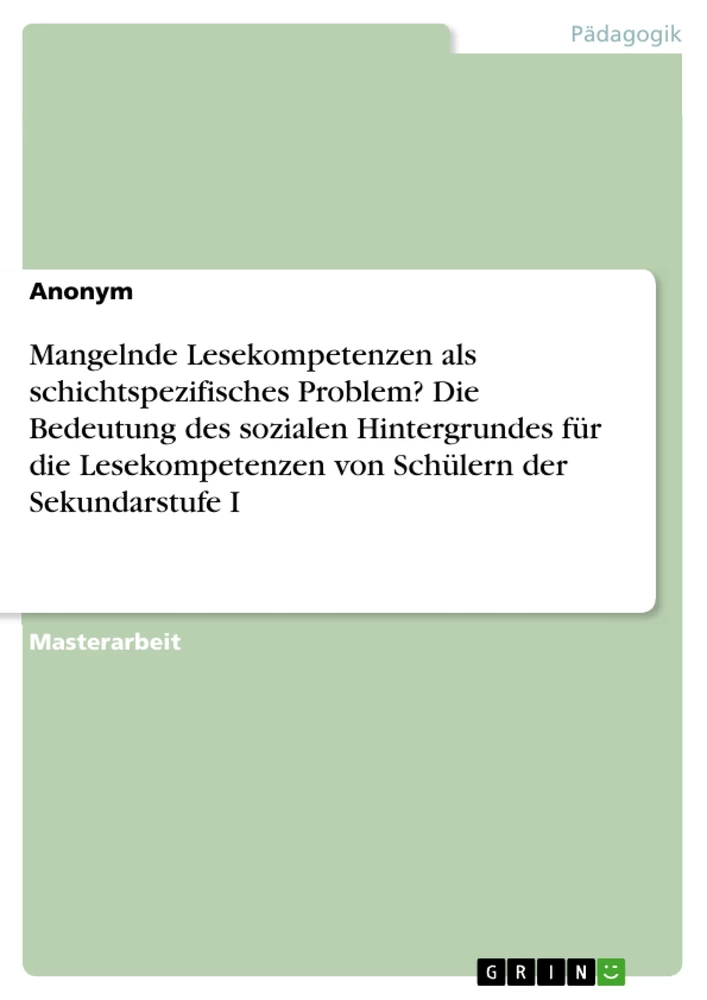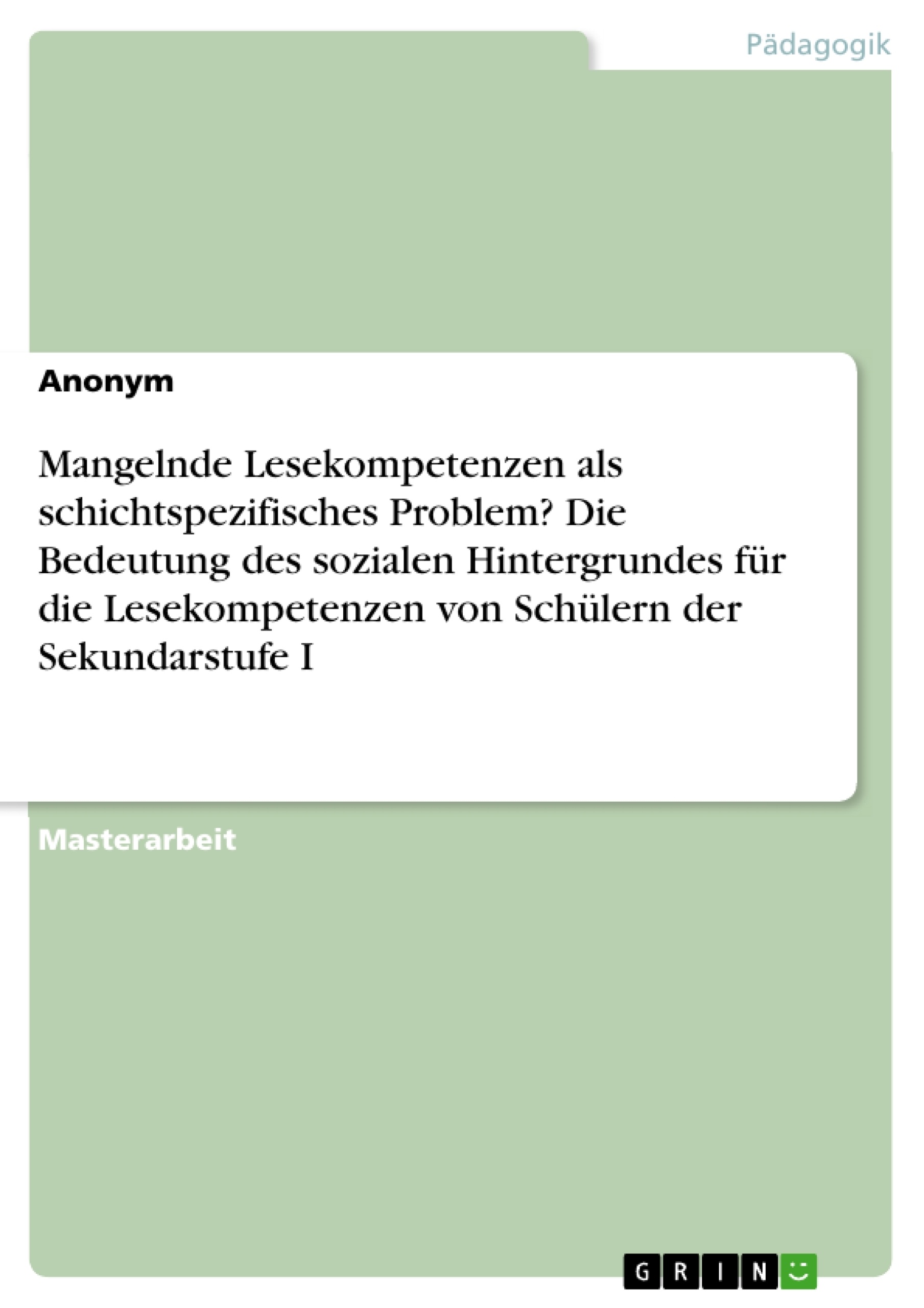Zu Beginn der Arbeit wird das allgemeine Kompetenzkonzept erläutert. Hierbei wird speziell mit Blick auf die zweite Forschungsfrage zunächst grundlegend dargestellt, welche Bedeutung dem sozialen Umfeld beim Kompetenzerwerb zukommt. Zudem wird explizit festgelegt, was in der vorliegenden Arbeit unter dem Begriff der Kompetenz verstanden werden soll.
Im darauffolgenden Kapitel wird die Bedeutung des sozialen Umfeldes beim Kompetenzerwerb nun konkret auf den Aspekt der Lesekompetenz übertragen. Zu diesem Zweck wird zunächst die Lesesozialisation definiert und anschließend aufgezeigt, inwieweit das theoretische Konstrukt der Lesesozialisation wissenschaftlich eingeordnet werden kann. Abschließend wird der Prozess der Lesesozialisation anhand dreier Modellierungen veranschaulicht.
Im vierten Kapitel wird dargelegt, was unter dem Aspekt der Lesekompetenz zu verstehen ist. Hierzu wird anfangs der kulturwissenschaftlich-orientierte Ansatz der Lesesozialisationsforschung präsentiert; im Anschluss erfolgt eine Darstellung der Ansätze in den PISA-Studien zur Erfassung von Lesekompetenz.
Im darauffolgenden Kapitel werden anhand der Arbeiten von Bourdieu, Coleman sowie Boudon die grundlegenden Ursachen und Mechanismen für allgemeine schichtspezifische Kompetenzunterschiede erläutert. Dabei wird insbesondere aufgezeigt, welche Synergien wirken und wie diese sich wechselseitig bedingen und potenzieren. Es sollen also die Wirkungs- und Reproduktionsprozesse der in der Empirie verwendeten Indikatoren zur Klassifizierung des sozialen Hintergrundes verdeutlicht werden.
Hierauf aufbauend werden im sechsten Kapitel die aktuellen empirischen Ergebnisse zur Relevanz des sozialen Umfeldes auf die Lesekompetenz für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I präsentiert. Dabei erfolgt auch für die Bedeutung des sozialen Parameters des Migrationshintergrundes eine dezidierte Betrachtung. Hierbei finden die PISA1-Daten der OECD Verwendung. An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass die PISA-Studien ausschließlich in der 9. Klassenstufe durchgeführt werden; eine dezidierte Untersuchung aller Klassenstufen der Sekundarstufe I erfolgt in dieser Arbeit nicht.
Schlussendlich werden in Kapitel sieben die Ursachen und Mechanismen für schichtspezifische Lesekompetenzdisparitäten für die Sekundarstufe I in Deutschland erörtert. Im Schlussteil erfolgt eine zusammenfassende Betrachtung sowie die Beantwortung der Forschungsfragen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Forschungsfragen
- 1.2. Aufbau der Arbeit
- 2. Das allgemeine Kompetenzkonzept
- 2.1. Das Kompetenzkonzept in den Entwicklungs- und Sozialisationstheorien
- 2.1.1. Chomskys nativistisch geprägter Kompetenzbegriff
- 2.1.2. Die Ansätze sozialer Lerntheorien
- 2.2. Zwischenfazit - Was soll in dieser Arbeit unter Kompetenz verstanden werden?
- 2.1. Das Kompetenzkonzept in den Entwicklungs- und Sozialisationstheorien
- 3. Lesesozialisation
- 3.1. Ein Einordnungsversuch des theoretischen Konstrukts der Lesesozialisation
- 3.2. Das prototypische Verlaufsschema einer gelingenden Lesesozialisation
- 3.2.1. Die primäre literarische Initiation
- 3.2.2. Der Schriftspracherwerb
- 3.2.3. Die lustvolle Kinderlektüre
- 3.2.4. Die Buch- bzw. literarische Lesekrise
- 3.2.5. Die Überwindung der Lesekrise
- 3.2.6. Die sieben Lesemodi des Erwachsenenalter
- 3.3. Kritik und Reaktionen hinsichtlich des prototypischen Verlaufsschemas einer gelingenden Lesesozialisation
- 3.3.1. Das Mehrebenenmodell der Ko-Konstruktion
- 3.3.2. Das Erwartungs-X-Wert-Modell
- 3.4. Zwischenfazit zur Bedeutung der Lesesozialisation
- 4. Lesekompetenz
- 4.1. Der kulturwissenschaftlich-orientierte Ansatz der Lesesozialisationsforschung
- 4.1.1. Die kognitiven Elemente des Leseprozesses
- 4.1.1.1. Hierarchieniedrige Leseprozessebene
- 4.1.1.1.1. Aufbau der propositionalen Textrepräsentation
- 4.1.1.1.2. Lokale Kohärenzbildung
- 4.1.1.2. Hierarchiehohe Leseprozessebene
- 4.1.1.2.1. Globale Kohärenzbildung
- 4.1.2. Herausbildung der Superstrukturen
- 4.1.3. Identifizierung von Darstellungsstrategien
- 4.1.4. Motivational-emotionale Aspekte des Leseprozesses
- 4.1.5. Reflexionen und Anschlusskommunikation
- 4.1.6. Das Mehrebenenmodell des Lesens
- 4.1.6.1. Prozessebene
- 4.1.6.2. Subjektebene
- 4.1.6.3. Soziale Ebene
- 4.1.1.1. Hierarchieniedrige Leseprozessebene
- 4.1.1. Die kognitiven Elemente des Leseprozesses
- 4.2. Das kognitionspsychologisch-orientierte Lesekompetenzmodell der PISA-Studien
- 4.3. Das modifizierte Lesekompetenzmodell der PISA-Studie
- 4.3.1. Leseflüssigkeit – Basale Leseprozesse
- 4.3.2. Leseprozess – Komplexe Textverarbeitung
- 4.3.2.1. Lokalisieren von Informationen
- 4.3.2.2. Textverstehen
- 4.3.2.3. Bewerten und Reflektieren
- 4.3.3. Aufgabenmanagement
- 4.3.4. Situative und texttypologische Aspekte der Lesekompetenzdiagnostik der PISA-Studie
- 4.3.5. Die Lesekompetenzstufen der PISA-Studie 2018
- 4.4. Zwischenfazit zur Bedeutung der Lesekompetenz
- 4.1. Der kulturwissenschaftlich-orientierte Ansatz der Lesesozialisationsforschung
- 5. Ursachen und Mechanismen für allgemeine schichtspezifische Kompetenzdisparitäten
- 5.1. Die Bedeutung der Merkmale des sozialen Hintergrundes
- 5.1.1. Die Kapitaltheorie
- 5.1.1.1. Das ökonomische Kapital
- 5.1.1.2. Das kulturelle Kapital
- 5.1.1.3. Das soziale Kapital
- 5.1.2. Primäre und sekundäre Herkunftseffekte
- 5.1.1. Die Kapitaltheorie
- 5.2. Zwischenfazit
- 5.1. Die Bedeutung der Merkmale des sozialen Hintergrundes
- 6. Empirische Ergebnisse zur Bedeutung des sozialen Hintergrundes für die Lesekompetenz
- 6.1. Forschungshistorie zur Bedeutung der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg
- 6.2. Methodische Orientierungen zur Erfassung des sozialen Hintergrundes
- 6.2.1. Berufe der Elternteile bzw. der Erziehungsberechtigten
- 6.2.1.1. Bewertungsmaßstäbe im internationalen Vergleich
- 6.2.1.2. Bewertungsmaßstäbe im nationalen Vergleich
- 6.2.2. Sozioökonomischer und soziokultureller Status
- 6.2.3. Klassifizierung des Migrationshintergrundes
- 6.2.1. Berufe der Elternteile bzw. der Erziehungsberechtigten
- 6.3. Ergebnisse und Befunde
- 6.3.1. Zusammenhang zwischen dem sozialen Hintergrund und der Lesekompetenz im internationalen Vergleich
- 6.3.1.1. Beziehung zwischen dem höchsten sozioökonomischen beruflichen Status der Eltern (HISEI) und der Lesekompetenz
- 6.3.1.2. Beziehung zwischen Index of Economics, Social, and Cultural Status (ESCS) und der Lesekompetenz
- 6.3.1.3. Vergleich zu vorherigen Ergebnissen
- 6.3.2. Zusammenhang zwischen dem sozialen Hintergrund und der Lesekompetenz in Deutschland
- 6.3.2.1. Die Merkmale des sozialen Hintergrundes
- 6.3.2.2. Merkmale des sozialen Hintergrundes bei lesestarken und leseschwachen Untersuchungspersonen
- 6.3.2.3. Quantifizierung der Lesekompetenz nach EGP-Klassen im nationalen Vergleich seit PISA 2000
- 6.3.3. Zusammenhang zwischen einem Migrationshintergrund und der Lesekompetenz in Deutschland
- 6.3.3.1. Zuwanderungsbedingte Disparitäten hinsichtlich der Merkmale der sozialen Herkunft sowie der zuhause gesprochenen Sprache in Deutschland
- 6.3.3.2. Verteilung auf die Stufen der Lesekompetenz nach Zuwanderungsstatus
- 6.3.1. Zusammenhang zwischen dem sozialen Hintergrund und der Lesekompetenz im internationalen Vergleich
- 6.4. Zwischenfazit
- 7. Erklärungen für schichtspezifische Lesekompetenzdisparitäten in der Sekundarstufe I in Deutschland
- 7.1. Befundlage in der Ungleichheits- und der Lesesozialisationsforschung
- 7.2. Bedeutung des Migrationshintergrundes für Lesekompetenzdisparitäten von Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I in Deutschland
- 8. Zusammenfassung und Beantwortung der Forschungsfragen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Bedeutung des sozialen Hintergrundes für die Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I. Die Arbeit analysiert die Ursachen und Mechanismen, die zu schichtspezifischen Disparitäten in der Lesekompetenz führen können. Dabei werden theoretische Modelle der Lesesozialisation und der Lesekompetenz herangezogen, um die Entwicklung von Lesekompetenzen in unterschiedlichen sozialen Kontexten zu erklären.
- Die Entwicklung von Lesekompetenz in unterschiedlichen sozialen Kontexten
- Die Bedeutung des sozialen Hintergrundes für die Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I
- Die Rolle von Primär- und Sekundäreffekten bei der Bildung von Lesekompetenzdisparitäten
- Der Einfluss des Migrationshintergrundes auf die Lesekompetenz
- Empirische Ergebnisse zu den Zusammenhängen zwischen dem sozialen Hintergrund und der Lesekompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel stellt die Forschungsfragen und den Aufbau der Arbeit vor. Es beleuchtet die gesellschaftliche Bedeutung von Lesekompetenz und die Notwendigkeit, allen Schülerinnen und Schülern gleiche Bildungschancen zu ermöglichen.
- Kapitel 2: Das allgemeine Kompetenzkonzept
Dieses Kapitel untersucht verschiedene Ansätze zur Definition von Kompetenz im Kontext von Entwicklungs- und Sozialisationstheorien, darunter der nativistische Kompetenzbegriff Chomskys und Ansätze sozialer Lerntheorien.
- Kapitel 3: Lesesozialisation
Dieses Kapitel erörtert das theoretische Konstrukt der Lesesozialisation und beleuchtet das prototypische Verlaufsschema einer gelingenden Lesesozialisation in verschiedenen Phasen. Es werden auch kritische Stimmen zum prototypischen Modell und alternative Ansätze zur Erklärung von Lesesozialisationsprozessen vorgestellt, wie das Mehrebenenmodell der Ko-Konstruktion und das Erwartungs-X-Wert-Modell.
- Kapitel 4: Lesekompetenz
Dieses Kapitel analysiert verschiedene Ansätze zur Definition und Erfassung von Lesekompetenz, darunter der kulturwissenschaftlich-orientierte Ansatz der Lesesozialisationsforschung und das kognitionspsychologisch-orientierte Lesekompetenzmodell der PISA-Studien. Es wird auch ein modifiziertes Lesekompetenzmodell vorgestellt, das die verschiedenen Aspekte der Lesekompetenz detailliert beschreibt, wie Leseflüssigkeit, Textverarbeitung, Bewertung und Reflektieren sowie Aufgabenmanagement.
- Kapitel 5: Ursachen und Mechanismen für allgemeine schichtspezifische Kompetenzdisparitäten
Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Merkmale des sozialen Hintergrundes für die Entstehung von Kompetenzdisparitäten, insbesondere im Kontext der Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu. Es werden die unterschiedlichen Arten von Kapital (ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital) und ihre Bedeutung für den Bildungserfolg diskutiert. Außerdem werden die Konzepte von Primär- und Sekundäreffekten im Zusammenhang mit sozialen Herkunftseffekten erläutert.
- Kapitel 6: Empirische Ergebnisse zur Bedeutung des sozialen Hintergrundes für die Lesekompetenz
Dieses Kapitel präsentiert empirische Ergebnisse zu den Zusammenhängen zwischen dem sozialen Hintergrund und der Lesekompetenz, sowohl im internationalen Vergleich (PISA-Studien) als auch in Deutschland. Es werden verschiedene Indikatoren zur Erfassung des sozialen Hintergrundes vorgestellt und deren Beziehung zur Lesekompetenz analysiert. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass der soziale Hintergrund ein wesentlicher Prädiktor für die Lesekompetenz ist.
- Kapitel 7: Erklärungen für schichtspezifische Lesekompetenzdisparitäten in der Sekundarstufe I in Deutschland
Dieses Kapitel interpretiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen und versucht, die beobachteten schichtspezifischen Lesekompetenzdisparitäten zu erklären. Es werden Erkenntnisse aus der Ungleichheits- und der Lesesozialisationsforschung herangezogen, um die Mechanismen und Ursachen für die Disparitäten zu beleuchten. Außerdem wird der Einfluss des Migrationshintergrundes auf die Lesekompetenzdisparitäten untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I in Deutschland und analysiert den Einfluss des sozialen Hintergrundes auf die Entwicklung von Lesekompetenz. Schwerpunkte sind: Lesesozialisation, Lesekompetenzmodelle, PISA-Studien, soziale Herkunft, Bildungsungleichheit, Kapitaltheorie, Migrationshintergrund und empirische Forschung.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2022, Mangelnde Lesekompetenzen als schichtspezifisches Problem? Die Bedeutung des sozialen Hintergrundes für die Lesekompetenzen von Schülern der Sekundarstufe I, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1421701