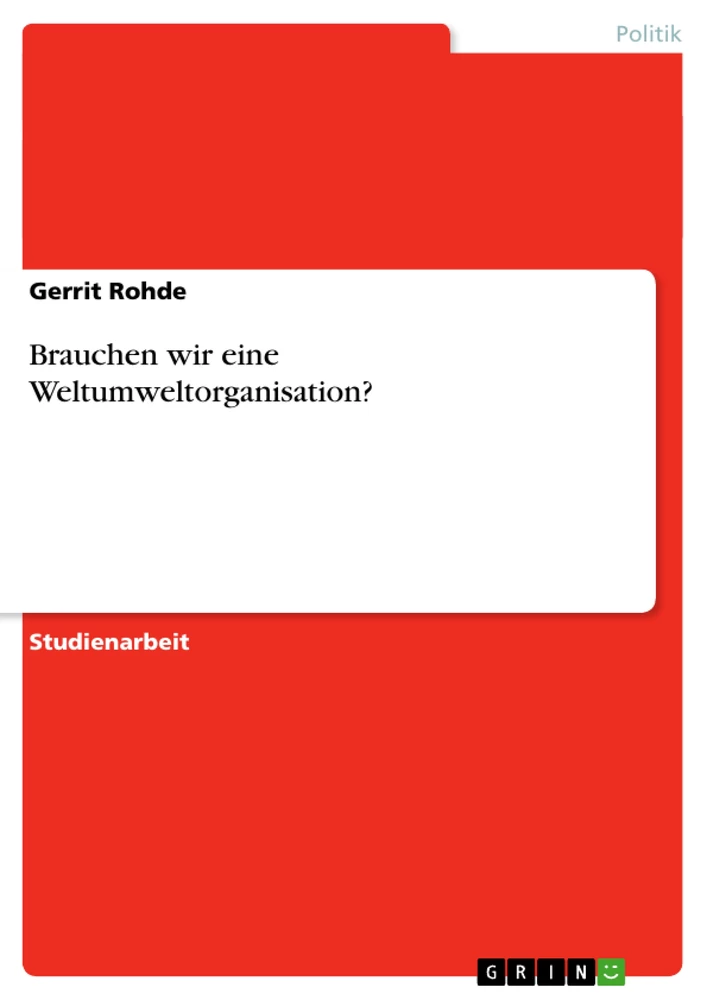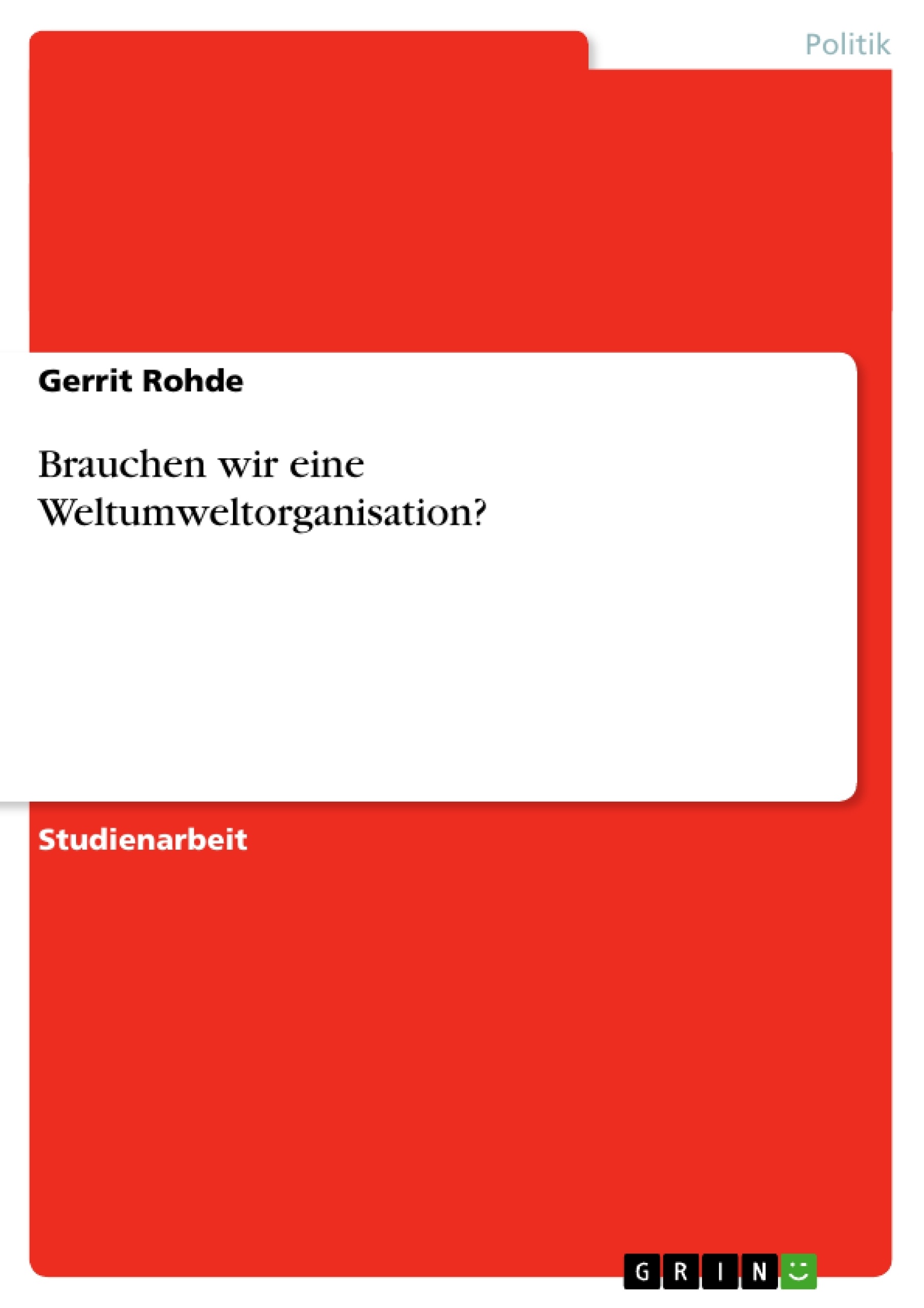Die institutionelle Zersplitterung in der globalen Umweltpolitik ist so ausgeprägt wie in keinem anderen Politikfeld. Bi- oder multilaterale Abkommen zwischen zwei oder mehreren Staaten beschränken sich meist auf die sektorale Bearbeitung spezifischer Umweltprobleme. Dabei können einerseits Reibungsverluste zwischen verschiedenen Abkommen, die sich der Bearbeitung eines Problemfeldes widmen, anderseits Zielkonflikte zwischen den einzelnen Problemfeldern entstehen. Zur Lösung dieser Probleme plädieren einige Politiker und Wissenschaftler für die Gründung einer neuen politischen Körperschaft, die bestehende Regime in sich eingliedert und als institutionelle Dachorganisation auftritt. Die deutsche Bundesregierung ließ durch ihre umweltpolitische Sprecherin am 25. Januar 1999 verlauten: „Wir brauchen […] eine Bündelung der unübersichtlichen und zersplitterten internationalen Institutionen und Programme“. In der wissenschaftlichen Forschungsdebatte gibt es Befürworter einer solchen Entwicklung, die in einer institutionellen Bearbeitung globaler Umweltprobleme gemäß der politischen Idee „Global Governance“ die optimale Lösung sehen. Bei der möglichen Ausgestaltung einer Weltumweltorganisation reichen die Forderung von einer hierarchischen Organisation, nach Vorbild des Weltsicherheitsrat bis zu einer Organisation, die lediglich mit weichen Durchsetzungsmechanismen ausgestattet ist und vornehmlich Informationsstandards einführt, aber keinerlei Sanktionsgewalt besitzt (Biermann und Simonis: 2000).
Andere Wissenschaftler sehen keinerlei Zusatznutzen in der Aufhebung der institutionellen Zersplitterung und beschäftigen sich zunächst mit den Ursachen dieser Entwicklung.
Ist die sektorale Zersplitterung in der globalen Umweltpolitik ein Hindernis oder ein notwendiges aber unüberwindbares Übel bei der Bearbeitung der Problembereiche im Politikfeld Umwelt? Die Arbeit wird mit der Erkenntnis schließen, dass eine souveränitätseinschränkende Organisation mit weitreichenden Entscheidungskompetenzen und Eingriffsmöglichkeiten die optimale Bearbeitungsmethode für das Politfeld Umwelt darstellt und angesichts der immer gravierenderen globalen Umweltprobleme selbst im Kontext einer realistischen Grundhaltung internationaler Akteure nicht im Bereich der politischen Utopie anzusiedeln ist.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIE INSTITUTIONELLE ZERSPLITTERUNG DER GLOBALEN UMWELTPOLITIK
- Staatliche Vereinigungen zur Bearbeitung globaler Umweltprobleme
- Staatliche Vereinigungen mit einem Schwerpunkt auf Umweltschutz
- Nichtregierungsorganisationen
- Fazit
- AUFHEBUNG DER ZERSPLITTERUNG IM RAHMEN EINES GLOBAL-GOVERNANCE-ANSATZ
- DIE INSTITUTIONELLE ZERSPLITTERUNG ALS CHANCE ZUR VERBESSERUNG DER SEKTORALEN ZUSAMMENARBEIT
- FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die institutionelle Zersplitterung in der globalen Umweltpolitik und analysiert die verschiedenen Ansätze zur Bearbeitung dieses Problems. Die Arbeit stellt fest, dass die bestehende Zersplitterung negative Auswirkungen auf die Bearbeitung von Umweltproblemen hat und argumentiert für die Notwendigkeit einer neuen, umfassenden Weltumweltorganisation.
- Institutionelle Zersplitterung in der globalen Umweltpolitik
- Kritik an der sektoralen Bearbeitung von Umweltproblemen
- Vorteile einer Weltumweltorganisation
- Verschiedene Ansätze zur Reform der globalen Umweltpolitik
- Realistische Perspektiven für eine Weltumweltorganisation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Problematik der institutionellen Zersplitterung in der globalen Umweltpolitik. Sie stellt die verschiedenen Akteure und ihre unterschiedlichen Ansätze zur Bearbeitung von Umweltproblemen vor und diskutiert die Notwendigkeit einer neuen Weltumweltorganisation.
2. Die institutionelle Zersplitterung der globalen Umweltpolitik
Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Akteure, die sich mit globalen Umweltproblemen befassen. Es werden staatliche Vereinigungen, Umweltregime, Nichtregierungsorganisationen und Unternehmensverbände vorgestellt. Die Kapitel analysiert die unterschiedlichen Ansätze und die Herausforderungen, die durch die Zersplitterung der globalen Umweltpolitik entstehen.
3. Aufhebung der Zersplitterung im Rahmen eines Global-Governance-Ansatz
Dieses Kapitel diskutiert verschiedene Vorschläge zur Überwindung der institutionellen Zersplitterung. Es werden verschiedene Modelle für eine Weltumweltorganisation vorgestellt und ihre Vor- und Nachteile analysiert.
4. Die institutionelle Zersplitterung als Chance zur Verbesserung der sektoralen Zusammenarbeit
Dieses Kapitel beleuchtet die positiven Aspekte der sektoralen Zusammenarbeit und zeigt, dass die Zersplitterung der globalen Umweltpolitik auch Chancen für eine effektive Bearbeitung von Umweltproblemen bietet. Es wird argumentiert, dass eine neue Weltumweltorganisation nicht unbedingt notwendig ist.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Globale Umweltpolitik, Institutionelle Zersplitterung, Weltumweltorganisation, Global Governance, Sektorale Zusammenarbeit, Nachhaltige Entwicklung, Umweltregime, Nichtregierungsorganisationen, Umweltprobleme, Internationalisierung, Global Change.
- Citar trabajo
- Diplom Politologe Gerrit Rohde (Autor), 2005, Brauchen wir eine Weltumweltorganisation?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142359