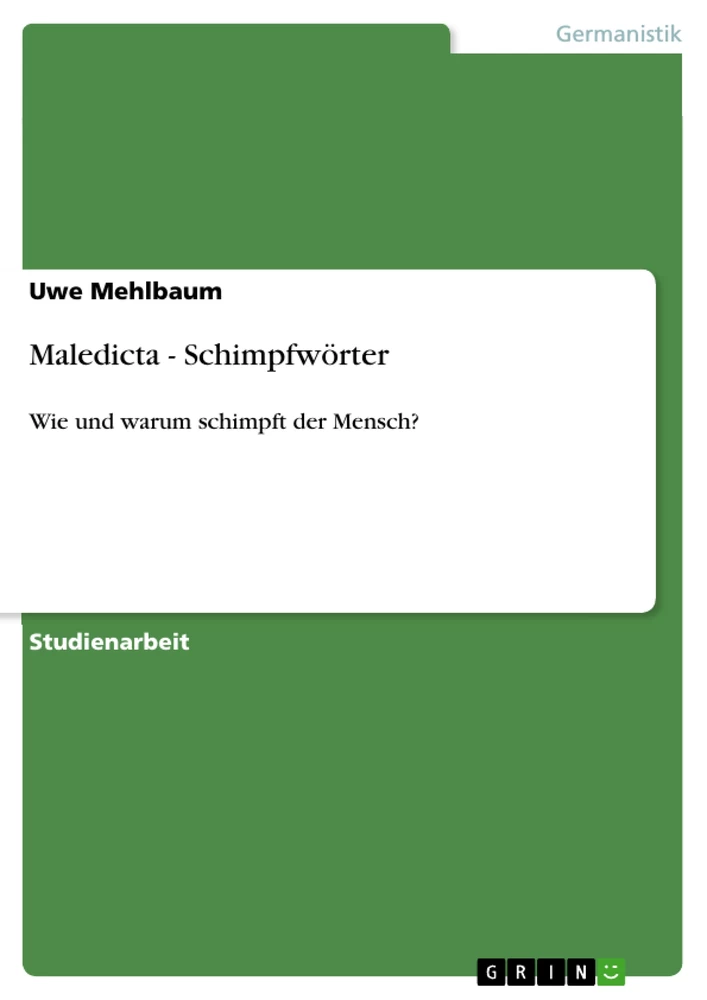Maledicta (von lat. maledicere – „schimpfen“) ist ein Überbegriff für Schimpfwörter und die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ihnen in der Linguistik. Gleichzeitig ist Maledicta der Name eines englischsprachigen, seit 1977 erscheinenden Journals, das sich der Studie sämtlicher Aspekte des Schimpfens und des vulgären Sprachgebrauchs in aller Welt befasst. Der Herausgeber des Journals und gleichzeitig Gründer der Maledictologie, also der Lehre vom Schimpfen und von Schimpfwörtern, der deutschstämmige Sprachwissenschaftler Reinhold Aman, nimmt dabei in seiner Forschung auf Tabubrüche und „political correctness“ keine Rücksicht (Aman 1996). Zugleich bemerkt er, dass das Forschungsfeld der Maledicta im Grunde wissenschaftlich vernachlässigt wurde, bis er sich in den siebziger Jahren dieses Themas annahm. Im Journal Maledicta steuern viele verschiedene Autoren aus vielen Teilen der Welt Aufsätze bei, die sich beispielsweise mit der prozentualen Verteilung einzelner Schimpfwörter auf die Geschlechter, ethnischen Verunglimpfungen im 18. Jahrhundert oder der verbalen Aggression von holländischen Schlafrednern beschäftigen. Diese Seminararbeit wird auf den folgenden Seiten eine Übersicht über einige grundlegende Erkenntnisse der Maledictologie geben und, unter anderem, darauf eingehen, was ein Schimpfwort genau ist, welche psychologischen Ursachen es für das Schimpfen gibt, wie Schimpfwörter entstehen, wie Schimpfwörter in verschiedenen Kulturen verwendet werden, auf welche Weise geschimpft wird und was damit angegriffen wird, welche juristischen Folgen Schimpfen haben kann und was es sonst noch für weiterführende Aspekte im Journal Maledicta gibt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Was ist ein Schimpfwort?
- III. Warum schimpft der Mensch?
- IV. Wie sich „echte“ Schimpfwörter bilden
- IV.1. Pejoration
- IV.2. Weitere Arten von Schimpfwörtern
- IV.2.1. Metaphorische Schimpfwörter
- IV.3.2. Formale Schimpfwörter
- V. Wie und worüber wird geschimpft?
- V.1. Arten von Beschimpfungen
- V.1.1. Direkte und indirekte Beschimpfungen
- V.1.2. Formen von Beschimpfungen
- V.2. Angriffspunkte
- V.3. Semantische Felder von Beschimpfungen
- V.1. Arten von Beschimpfungen
- VI. Schimpfwörter in verschiedenen Kulturen
- VII. Juristische Aspekte beim Gebrauch von Schimpfwörtern
- VIII. Einige ausgewählte Artikel aus dem Journal „Maledicta“
- VIII.1. Andrew R. Sisson: Is French a sexist language?
- VIII.2. Reinhold Aman: Gimp, Pimp, Simp & Wimp – Political pejoration past and present
- VIII.3. Reinhold Aman: Nomen est Omen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit bietet einen Überblick über die Maledictologie, die wissenschaftliche Erforschung von Schimpfwörtern. Sie beleuchtet verschiedene Aspekte, von der Definition des Schimpfwortes über die psychologischen Ursachen des Schimpfens bis hin zu kulturellen und juristischen Implikationen. Die Arbeit stützt sich dabei auf Erkenntnisse des Journals "Maledicta".
- Definition und Charakteristika von Schimpfwörtern
- Psychologische Ursachen und Funktionen des Schimpfens
- Bildung und Entwicklung von Schimpfwörtern
- Kulturelle Unterschiede im Umgang mit Schimpfwörtern
- Juristische Relevanz des Schimpfens
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Maledictologie ein und stellt das Journal "Maledicta" als zentrale Forschungsquelle vor. Sie skizziert den Forschungsgegenstand und die behandelten Aspekte der Seminararbeit, welche einen umfassenden Überblick über grundlegende Erkenntnisse der Maledictologie liefern soll, von der Definition des Begriffs "Schimpfwort" bis hin zu den juristischen Konsequenzen des Schimpfens.
II. Was ist ein Schimpfwort?: Dieses Kapitel analysiert die Schwierigkeiten bei der Definition eines Schimpfwortes. Es wird deutlich, dass die Einordnung eines Wortes als Schimpfwort stark kontextabhängig ist und von Faktoren wie Tonfall, Mimik, Gestik und der Kombination mit anderen Wörtern abhängt. "Harmlose" Wörter können je nach Kontext und Intention beleidigend wirken. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des affektiven Gebrauchs als entscheidendes Kriterium für die Klassifizierung als Schimpfwort, wobei die Unterscheidung zwischen Denotation und Konnotation hervorgehoben wird.
III. Warum schimpft der Mensch?: Dieser Abschnitt erörtert die psychologischen Hintergründe des Schimpfens. Es wird eine Kausalkette von Frustration über Affekt zu Aggression dargestellt. Frustration, die aus einer Vielzahl von Ursachen resultieren kann, führt zu einem affektiven Zustand, der sich in aggressiven Handlungen, wie dem Schimpfen, manifestiert. Das Schimpfen wird als Angriffsakt durch abwertende und beleidigende Worte beschrieben, die aus dem emotionalen Zustand der Frustration resultieren.
Schlüsselwörter
Maledictologie, Schimpfwörter, Vulgärsprache, Psychologie des Schimpfens, Kulturelle Unterschiede, Juristische Aspekte, "Maledicta" Journal, Pejoration, semantische Felder, verbale Aggression.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Maledictologie
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Maledictologie, die wissenschaftliche Erforschung von Schimpfwörtern. Sie behandelt verschiedene Aspekte, von der Definition und Entstehung von Schimpfwörtern über die psychologischen Gründe für deren Verwendung bis hin zu kulturellen und juristischen Implikationen. Die Arbeit basiert auf Erkenntnissen aus dem Journal "Maledicta".
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Seminararbeit deckt folgende Themen ab: Definition und Charakteristika von Schimpfwörtern, psychologische Ursachen und Funktionen des Schimpfens, Bildung und Entwicklung von Schimpfwörtern, kulturelle Unterschiede im Umgang mit Schimpfwörtern, juristische Relevanz des Schimpfens sowie ausgewählte Artikel aus dem Journal "Maledicta".
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung und einer Definition von Schimpfwörtern. Es folgen Kapitel zu den psychologischen Ursachen des Schimpfens, der Bildung von Schimpfwörtern (inklusive Pejoration und metaphorischen Schimpfwörtern), verschiedenen Arten und Angriffspunkten von Beschimpfungen, kulturellen Unterschieden im Umgang mit Schimpfwörtern und den juristischen Aspekten. Abschließend werden ausgewählte Artikel aus dem Journal "Maledicta" vorgestellt.
Welche Arten von Schimpfwörtern werden behandelt?
Die Arbeit unterscheidet verschiedene Arten von Schimpfwörtern, einschließlich metaphorischer und formeller Schimpfwörter, und analysiert die Entstehung von Schimpfwörtern durch Prozesse wie Pejoration. Sie untersucht auch direkte und indirekte Beschimpfungen sowie die semantischen Felder, in denen Schimpfwörter vorkommen.
Welche psychologischen Aspekte werden beleuchtet?
Die Seminararbeit erörtert die psychologischen Hintergründe des Schimpfens, indem sie eine Kausalkette von Frustration über Affekt zu Aggression darstellt. Schimpfen wird als aggressiver Akt beschrieben, der aus einem emotionalen Zustand der Frustration resultiert.
Welche kulturellen und juristischen Aspekte werden berücksichtigt?
Die Arbeit betrachtet kulturelle Unterschiede im Umgang mit Schimpfwörtern und beleuchtet die juristischen Konsequenzen des Gebrauchs von Schimpfwörtern. Sie zeigt, wie die Bewertung eines Wortes als Schimpfwort stark kontextabhängig ist.
Welche Rolle spielt das Journal "Maledicta"?
Das Journal "Maledicta" dient als zentrale Forschungsquelle für die Seminararbeit. Ausgewählte Artikel aus diesem Journal werden im letzten Kapitel vorgestellt und zusammengefasst (z.B. zu den Themen Sexismus in der französischen Sprache, politische Pejorationen und die Bedeutung von Namen).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Maledictologie, Schimpfwörter, Vulgärsprache, Psychologie des Schimpfens, kulturelle Unterschiede, juristische Aspekte, "Maledicta" Journal, Pejoration, semantische Felder, verbale Aggression.
- Citation du texte
- Uwe Mehlbaum (Auteur), 2008, Maledicta - Schimpfwörter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142383