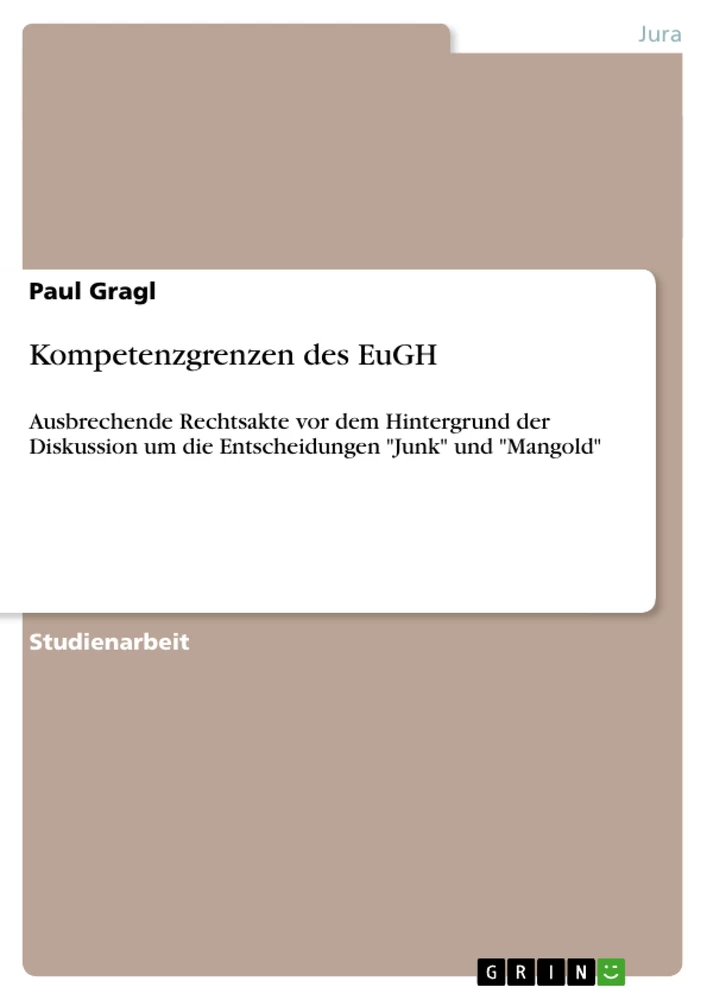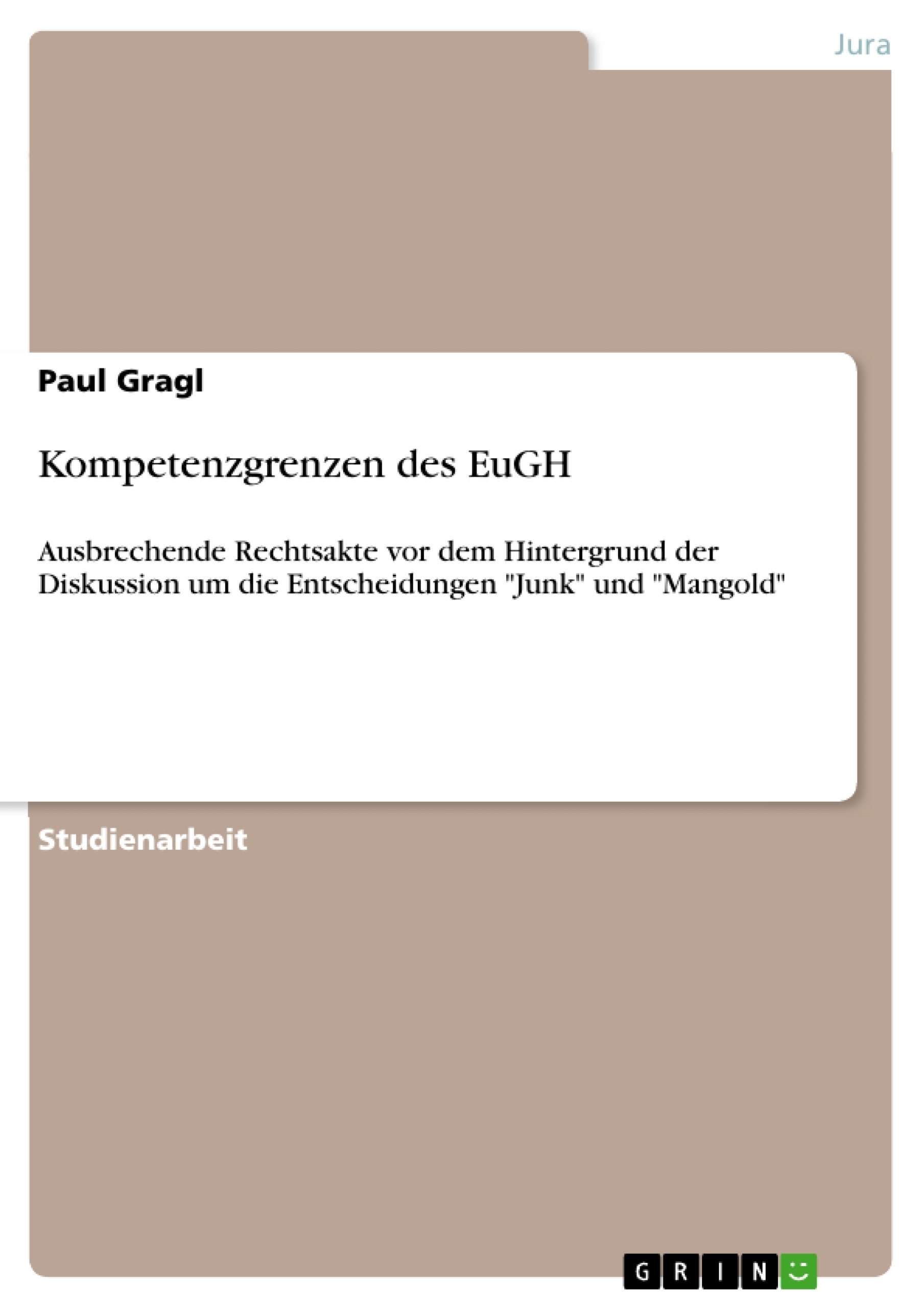Die zunehmende Integration auf europäischer Ebene ist eine unbestrittene Tatsache. Daher scheint es nur logisch und zweckmäßig, wenn ganz im Sinne des Subsidiaritätsprinzips nach Art 5 Abs 3 EUV (ex-Art 5 Abs 2 EGV) die Union in jenen Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig wird, soweit die Zwecke der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können. Zu diesen Bereichen gehört seit einigen Jahren auch das Arbeitsrecht, um im Hinblick auf einen funktionierenden Binnenmarkt (dh Arbeitnehmerfreizügigkeit und Niederlassungsfreiheit) gleiche arbeitsrechtliche Standards in den Mitgliedstaaten zu schaffen.
Diese Seminararbeit wird sich dabei mit der Problematik auseinandersetzen, wann die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes diese Kompetenzen der Union überschreitet, und zwar anhand zweier konkreter Fälle mit arbeitsrechtlichem Bezug. Mit dem „Maastricht“-Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts wurde für solche kompetenzüberschreitende Handlungen der Begriff der „ausbrechenden Rechtsakten“ geprägt. Darunter versteht man einen unzulässigen ultra vires-Akt eines Organs, der gegen bestehendes Kompetenzrecht oder – wie im Falle des EuGH – etablierte Rechtsprechung verstößt. Kritiker von „ausbrechenden Rechtsakten“ argumentieren dabei vor allem, dass die Mitgliedstaaten die Europäische Union niemals zu solchen Rechtsakten ermächtigt haben und dass mit einer derart ausuferenden Rechtsprechungspraxis die rechtstaatliche Gewaltenteilung gefährdet wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- A. Ausbrechende Rechtsakte
- I. Ultra vires-Handlungen: Ursprünge und Definition
- II. Ausbrechende oder fehlerhafte Rechtsakte als Verletzung der Verbandskompetenz
- III. Das Maastricht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts
- 1. Inhalt und Grenzen des Urteils
- 2. Folgen des Urteils
- B. Die Fälle „Junk“ und „Mangold“
- I. Der Fall Rs C-188/03: Irmtraud Junk/Wolfgang Kühnel
- 1. Sachverhalt und Prozessverlauf
- 2. Die Entscheidung des EuGH
- II. Der Fall Rs. C-144/04: Werner Mangold/Rüdiger Helm
- 1. Sachverhalt und Prozessverlauf
- 2. Die Entscheidung des EuGH
- III. Kritische Analyse der Fälle „Junk“ und „Mangold“
- 1. Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung?
- 2. Finden oder Erfinden eines allgemeinen Grundsatzes des Gemeinschaftsrechts?
- 3. Unmittelbare horizontale (Vor-)Wirkung von Richtlinien?
- a) Vorwirkung der Richtlinie
- b) Unmittelbare horizontale Richtlinienwirkung
- c) Ergebnis
- C. Conclusio
- I. Kritik an der Rechtsprechungspraxis des EuGH
- II. Der EuGH als „Superrevisionsinstanz“?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Seminarbeitrag analysiert die Kompetenzgrenzen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) anhand der Entscheidungen in den Fällen „Mangold“ und „Junk“. Ziel ist es, die Rechtsprechung des EuGH im Kontext der Diskussion um ausbrechende Rechtsakte kritisch zu beleuchten und die Auswirkungen auf die nationale Gerichtsbarkeit zu untersuchen.
- Kompetenzüberschreitung des EuGH
- Ausbrechende Rechtsakte und ihre rechtlichen Folgen
- Richtlinienkonforme Auslegung
- Horizontale Wirkung von Richtlinien
- Verhältnis zwischen nationalem und europäischem Recht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Kompetenzgrenzen des EuGH ein und skizziert den Rahmen der folgenden Analyse. Sie beschreibt den Kontext der Entscheidungen „Mangold“ und „Junk“ sowie deren Bedeutung für die Diskussion um ausbrechende Rechtsakte.
A. Ausbrechende Rechtsakte: Dieses Kapitel definiert den Begriff „ausbrechende Rechtsakte“ und untersucht dessen Ursprünge und Definition im Kontext von Ultra-vires-Handlungen. Es analysiert die Verletzung der Verbandskompetenz durch solche Rechtsakte und diskutiert das bedeutende Maastricht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, einschließlich dessen Inhalt, Grenzen und Folgen für die Rechtsprechung.
B. Die Fälle „Junk“ und „Mangold“: Dieser Abschnitt präsentiert detaillierte Analysen der Fälle „Junk“ und „Mangold“, einschließlich Sachverhalt, Prozessverlauf und der Entscheidung des EuGH in jedem Fall. Es folgt eine kritische Auseinandersetzung mit beiden Entscheidungen, wobei die Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung, die Frage nach dem Finden oder Erfinden allgemeiner Grundsatze des Gemeinschaftsrechts und die unmittelbare horizontale Wirkung von Richtlinien im Mittelpunkt stehen. Die verschiedenen Aspekte der Vorwirkung und der unmittelbaren horizontalen Wirkung werden sorgfältig untersucht und ihre Ergebnisse bewertet.
C. Conclusio: Der Schlussteil fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und richtet Kritik an der Rechtsprechungspraxis des EuGH. Die Frage, ob der EuGH als „Superrevisionsinstanz“ fungiert, wird kritisch diskutiert und die möglichen Implikationen dieser Rolle werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
EuGH, Kompetenzgrenzen, Ausbrechende Rechtsakte, Ultra vires, Verbandskompetenz, Maastricht-Urteil, Fall Junk, Fall Mangold, Richtlinienkonforme Auslegung, Horizontale Wirkung von Richtlinien, Gemeinschaftsrecht, nationales Recht, Rechtsprechungskritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Seminarbeitrag: Kompetenzgrenzen des EuGH in den Fällen „Mangold“ und „Junk“
Was ist der Gegenstand dieses Seminarbeitrags?
Der Seminarbeitrag analysiert kritisch die Kompetenzgrenzen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), insbesondere im Kontext der Entscheidungen in den Fällen „Mangold“ und „Junk“. Im Fokus steht die Untersuchung der Rechtsprechung des EuGH hinsichtlich „ausbrechender Rechtsakte“ und deren Auswirkungen auf die nationale Gerichtsbarkeit.
Welche Themen werden im Seminarbeitrag behandelt?
Der Beitrag behandelt unter anderem folgende Themen: Kompetenzüberschreitung des EuGH, ausbrechende Rechtsakte und deren rechtliche Folgen, richtlinienkonforme Auslegung, horizontale Wirkung von Richtlinien, das Verhältnis zwischen nationalem und europäischem Recht, sowie das Maastricht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
Welche Fälle stehen im Mittelpunkt der Analyse?
Die zentralen Fälle sind die Entscheidungen des EuGH in „Junk“ (Rs C-188/03) und „Mangold“ (Rs C-144/04). Der Beitrag analysiert detailliert den Sachverhalt, den Prozessverlauf und die Entscheidungen in beiden Fällen.
Was sind „ausbrechende Rechtsakte“?
Der Beitrag definiert den Begriff „ausbrechende Rechtsakte“ und untersucht dessen Ursprünge im Kontext von Ultra-vires-Handlungen. Es wird analysiert, wie solche Rechtsakte die Verbandskompetenz verletzen können.
Welche Rolle spielt das Maastricht-Urteil?
Das Maastricht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts wird als bedeutendes Urteil im Kontext der Diskussion um ausbrechende Rechtsakte analysiert. Der Beitrag untersucht dessen Inhalt, Grenzen und Folgen für die Rechtsprechung.
Wie wird die Rechtsprechung des EuGH kritisiert?
Der Beitrag enthält eine kritische Auseinandersetzung mit der Rechtsprechungspraxis des EuGH. Es wird unter anderem die Frage diskutiert, ob der EuGH als „Superrevisionsinstanz“ fungiert und welche Implikationen dies hat.
Welche Schlüsselkonzepte werden im Beitrag behandelt?
Schlüsselkonzepte sind unter anderem: richtlinienkonforme Auslegung, horizontale Wirkung von Richtlinien (inklusive Vorwirkung und unmittelbarer horizontaler Wirkung), die Frage nach dem Finden oder Erfinden allgemeiner Grundsätze des Gemeinschaftsrechts, sowie das Verhältnis zwischen nationalem und europäischem Recht.
Wie ist der Beitrag strukturiert?
Der Beitrag ist in Einleitung, einen Abschnitt zu ausbrechenden Rechtsakten, eine detaillierte Analyse der Fälle „Junk“ und „Mangold“ und eine Schlussfolgerung (Conclusio) gegliedert. Er enthält zudem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Für wen ist dieser Seminarbeitrag relevant?
Dieser Seminarbeitrag ist relevant für alle, die sich mit den Kompetenzgrenzen des EuGH, dem Verhältnis zwischen nationalem und europäischem Recht, und der Auslegung von Richtlinien befassen, insbesondere im Kontext des europäischen Gemeinschaftsrechts.
- Citar trabajo
- Mag.phil., Mag.iur. Paul Gragl (Autor), 2009, Kompetenzgrenzen des EuGH, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142597