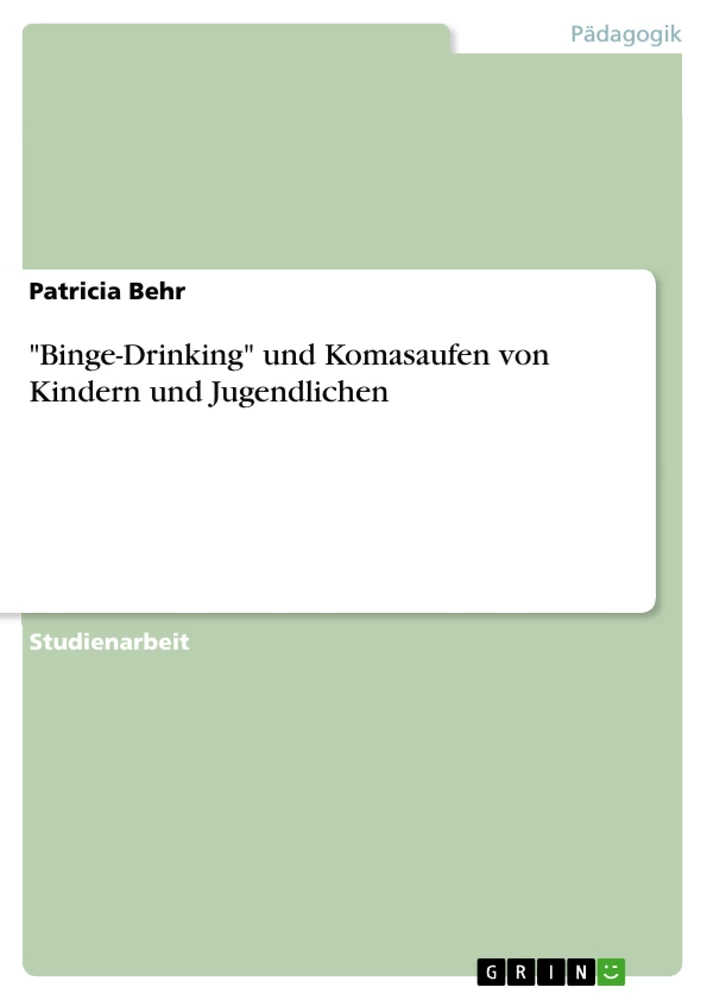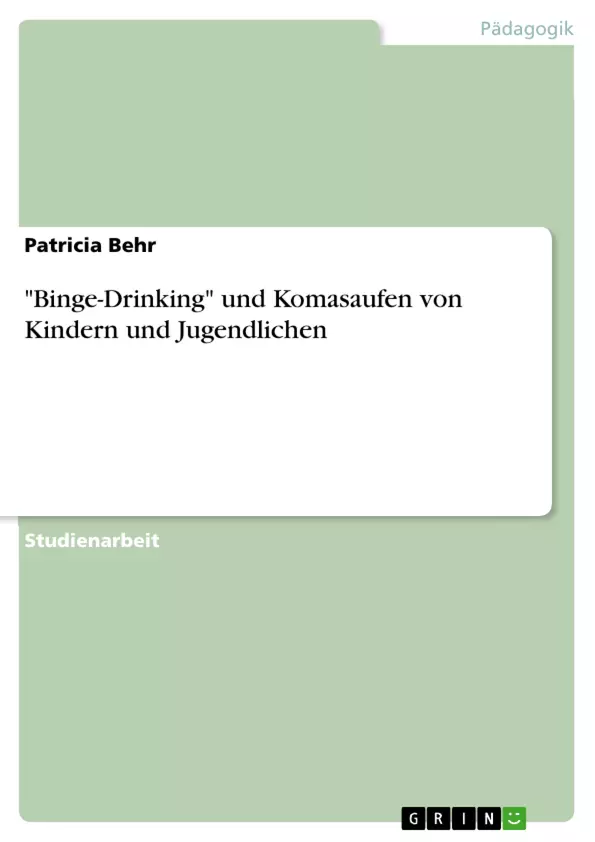Ob in Zeitungsberichten, Radiosendungen, Fernsehreportagen, Nachrichten, oder Talkshows: Komasaufen wurde in den letzten Jahren zum medialen Brennpunkt schlechthin – Nicht zuletzt wegen erschütternden Schlagzeilen, welche zum Beispiel den Tod eines 16-Jährigen Schülers aus Berlin, der nach 45 2-cl-Gläsern Tequila mit 4,8 Promille ins Koma gefallen war, oder die Einlieferung eines erst 7-jährigen Jungen ins Krankenhaus beinhalteten, der durch die Anstiftung von Jugendlichen bis hin zur Vergiftung Alkohol konsumiert hatte .
In Anbetracht des wachsenden Interesses von Seiten der Politik, der Eltern, des Gesundheitswesens, der Polizei, usw. an der Verhinderung und Prävention des weiter ansteigenden „Exzesstrinkens“ der nächsten Generation, muss jedoch zunächst erforscht werden, welche Umstände überhaupt dazu führen und welche Faktoren dieses Verhalten bestärken oder verstärken, um anschließend durch gezielte, präventive Maßnahmen eine Ausweitung des Problems einschränken zu können.
Die folgende Arbeit soll einen Überblick über das moderne Phänomen Komasaufen geben, welcher verschiedene Forschungsergebnisse diverser Studien, sowie ärztliche und persönliche Recherchen beinhaltet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinition und Abgrenzung: Binge-Drinking, Rauschtrinken, Komasaufen
- Zahlen und Fakten
- Die „Drogenaffinitätsstudie 2008“ der BZgA
- Regionale Studie zum Trinkverhalten Jugendlicher durch die Aktion „Jugend an der Flasche“
- Interne Statistik zur Einlieferung Jugendlicher aufgrund von Alkoholintoxikation der Techniker Krankenkasse (TK) 2003-2008
- Lerneffekt nach Komasaufen? - eine Studie des Instituts für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsystemforschung (ISEG) 2008
- Risikofaktoren für Rauschtrinken von Jugendlichen
- Die Studie „Einflussfaktoren, Motivation und Anreize zum Rauschtrinken bei Jugendlichen“ der BZgA (2009)
- Folgen, Risiken und Schäden von Rauschtrinken
- Moderne Trends des Wett- und Komatrinkens
- Warum Jugendliche komasaufen - Standpunkte von Experten
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des Komasaufens bei Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, einen Überblick über die Ursachen, Faktoren und Folgen dieses Verhaltens zu geben. Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Forschungsarbeiten und ärztliche Recherchen.
- Definition und Abgrenzung von Begriffen wie Binge-Drinking, Rauschtrinken und Komasaufen
- Statistische Daten zum Alkoholkonsum und Komasaufen bei Jugendlichen
- Risikofaktoren, die zum Rauschtrinken beitragen
- Folgen und Risiken von exzessivem Alkoholkonsum
- Aktuelle Trends im Bereich des Wett- und Komatrinkens
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die zunehmende mediale Aufmerksamkeit für das Thema Komasaufen bei Jugendlichen und betont die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen. Sie begründet die Notwendigkeit der vorliegenden Arbeit, die einen Überblick über das Phänomen Komasaufen geben soll, indem sie auf die geringe Anzahl wissenschaftlicher Studien zu diesem spezifischen Thema hinweist.
Begriffsdefinition und Abgrenzung: Binge-Drinking, Rauschtrinken, Komasaufen: Dieses Kapitel analysiert die unterschiedlichen Definitionen von Begriffen wie Binge-Drinking, Rauschtrinken und Komasaufen. Es zeigt die Schwierigkeiten einer eindeutigen Definition von „Komasaufen“ auf und vergleicht die verschiedenen Definitionen, die in der klinischen Forschung und Epidemiologie verwendet werden, besonders im Hinblick auf die zeitliche Komponente und die Blutalkoholkonzentration. Es hebt die unterschiedlichen Bedeutungen hervor, die der Begriff „Komasaufen“ im alltäglichen Gebrauch haben kann.
Zahlen und Fakten: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene statistische Daten zum Alkoholkonsum Jugendlicher. Es bezieht sich auf die Drogenaffinitätsstudie 2008 der BZgA, die einen Rückgang des wöchentlichen Alkoholkonsums, aber gleichzeitig einen weiterhin hohen Anteil an Jugendlichen mit riskantem Alkoholkonsum aufzeigt. Die Daten zum Binge-Drinking bleiben über den untersuchten Zeitraum nahezu konstant. Die Kapitel präsentiert weitere Studien, welche das Trinkverhalten Jugendlicher beleuchten.
Risikofaktoren für Rauschtrinken von Jugendlichen: Dieser Abschnitt befasst sich mit den Faktoren, die das Rauschtrinken bei Jugendlichen begünstigen. [An dieser Stelle muss der Textinhalt ergänzt werden, da die bereitgestellten Informationen zu diesem Kapitel fehlen].
Die Studie „Einflussfaktoren, Motivation und Anreize zum Rauschtrinken bei Jugendlichen“ der BZgA (2009): Dieses Kapitel beschreibt die Ergebnisse einer BZgA-Studie zu den Einflussfaktoren, Motiven und Anreizen für das Rauschtrinken bei Jugendlichen. [An dieser Stelle muss der Textinhalt ergänzt werden, da die bereitgestellten Informationen zu diesem Kapitel fehlen].
Folgen, Risiken und Schäden von Rauschtrinken: Dieses Kapitel widmet sich den negativen Folgen des Rauschtrinkens, sowohl auf die körperliche als auch auf die psychische Gesundheit. [An dieser Stelle muss der Textinhalt ergänzt werden, da die bereitgestellten Informationen zu diesem Kapitel fehlen].
Moderne Trends des Wett- und Komatrinkens: Dieser Abschnitt befasst sich mit aktuellen Entwicklungen und Trends im Bereich des Wett- und Komatrinkens. [An dieser Stelle muss der Textinhalt ergänzt werden, da die bereitgestellten Informationen zu diesem Kapitel fehlen].
Warum Jugendliche komasaufen - Standpunkte von Experten: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Expertenmeinungen zu den Ursachen des Komasaufens bei Jugendlichen. [An dieser Stelle muss der Textinhalt ergänzt werden, da die bereitgestellten Informationen zu diesem Kapitel fehlen].
Schlüsselwörter
Komasaufen, Binge-Drinking, Rauschtrinken, Jugendschutz, Alkoholmissbrauch, Risikofaktoren, Prävention, Alkoholismus, Jugendliche, Gesundheitsrisiken, Suchtprävention, BZgA.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Komasaufen bei Jugendlichen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Komasaufen bei Jugendlichen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, sowie Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Definition und Abgrenzung relevanter Begriffe (Binge-Drinking, Rauschtrinken, Komasaufen), der Darstellung statistischer Daten zum Alkoholkonsum Jugendlicher, der Analyse von Risikofaktoren und Folgen exzessiven Alkoholkonsums, sowie der Betrachtung aktueller Trends und Expertenmeinungen.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Begriffsdefinition und Abgrenzung (Binge-Drinking, Rauschtrinken, Komasaufen), Zahlen und Fakten (inkl. verschiedener Studien), Risikofaktoren für Rauschtrinken von Jugendlichen, Die Studie „Einflussfaktoren, Motivation und Anreize zum Rauschtrinken bei Jugendlichen“ der BZgA (2009), Folgen, Risiken und Schäden von Rauschtrinken, Moderne Trends des Wett- und Komatrinkens, Warum Jugendliche komasaufen - Standpunkte von Experten, und Schluss.
Welche Studien werden im Dokument erwähnt?
Das Dokument bezieht sich auf verschiedene Studien, darunter die „Drogenaffinitätsstudie 2008“ der BZgA, eine regionale Studie zum Trinkverhalten Jugendlicher von der Aktion „Jugend an der Flasche“, interne Statistiken zur Einlieferung Jugendlicher aufgrund von Alkoholintoxikation der Techniker Krankenkasse (TK) 2003-2008, eine Studie des Instituts für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsystemforschung (ISEG) 2008 zum Lerneffekt nach Komasaufen, und die Studie „Einflussfaktoren, Motivation und Anreize zum Rauschtrinken bei Jugendlichen“ der BZgA (2009).
Welche Begriffe werden definiert und abgegrenzt?
Das Dokument definiert und grenzt die Begriffe Binge-Drinking, Rauschtrinken und Komasaufen voneinander ab. Es wird auf die Schwierigkeiten einer eindeutigen Definition von „Komasaufen“ hingewiesen und verschiedene Definitionen aus klinischer Forschung und Epidemiologie verglichen, insbesondere im Hinblick auf die zeitliche Komponente und die Blutalkoholkonzentration.
Welche Risikofaktoren für Rauschtrinken werden behandelt?
Das Dokument erwähnt Risikofaktoren für Rauschtrinken bei Jugendlichen, jedoch sind die detaillierten Informationen zu diesem Punkt im bereitgestellten Textfragment unvollständig.
Welche Folgen und Risiken von Rauschtrinken werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt die negativen Folgen von Rauschtrinken für die körperliche und psychische Gesundheit. Detaillierte Informationen zu den Folgen sind jedoch im bereitgestellten Textfragment nicht enthalten.
Welche aktuellen Trends im Bereich Wett- und Komatrinken werden beleuchtet?
Das Dokument thematisiert aktuelle Trends im Bereich Wett- und Komatrinken, jedoch sind die konkreten Informationen dazu im bereitgestellten Textfragment nicht verfügbar.
Welche Expertenmeinungen werden zum Thema Komasaufen vorgestellt?
Das Dokument beinhaltet einen Abschnitt mit verschiedenen Expertenmeinungen zu den Ursachen von Komasaufen bei Jugendlichen. Die konkreten Meinungen sind jedoch im bereitgestellten Textfragment nicht aufgeführt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für dieses Dokument?
Die Schlüsselwörter umfassen: Komasaufen, Binge-Drinking, Rauschtrinken, Jugendschutz, Alkoholmissbrauch, Risikofaktoren, Prävention, Alkoholismus, Jugendliche, Gesundheitsrisiken, Suchtprävention, BZgA.
Wo finde ich mehr Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die detaillierten Informationen zu den einzelnen Kapiteln, insbesondere zu den Risikofaktoren, Folgen, Trends und Expertenmeinungen, fehlen im bereitgestellten Textausschnitt. Die vollständigen Informationen sind in der vollständigen Version des Dokuments zu finden.
- Citar trabajo
- Patricia Behr (Autor), 2010, "Binge-Drinking" und Komasaufen von Kindern und Jugendlichen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142640