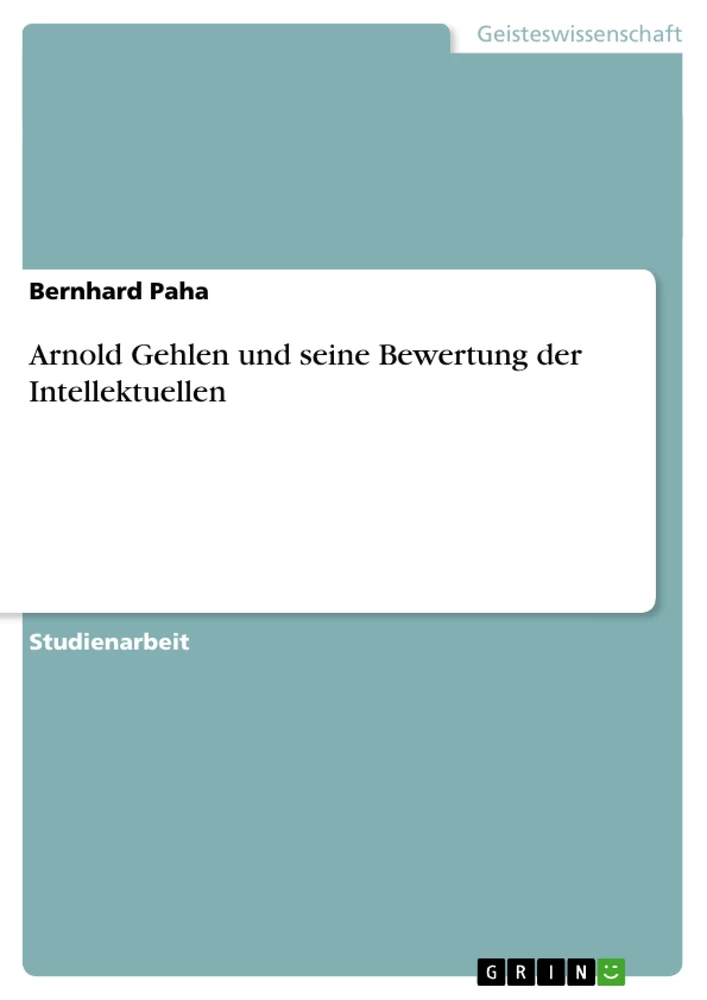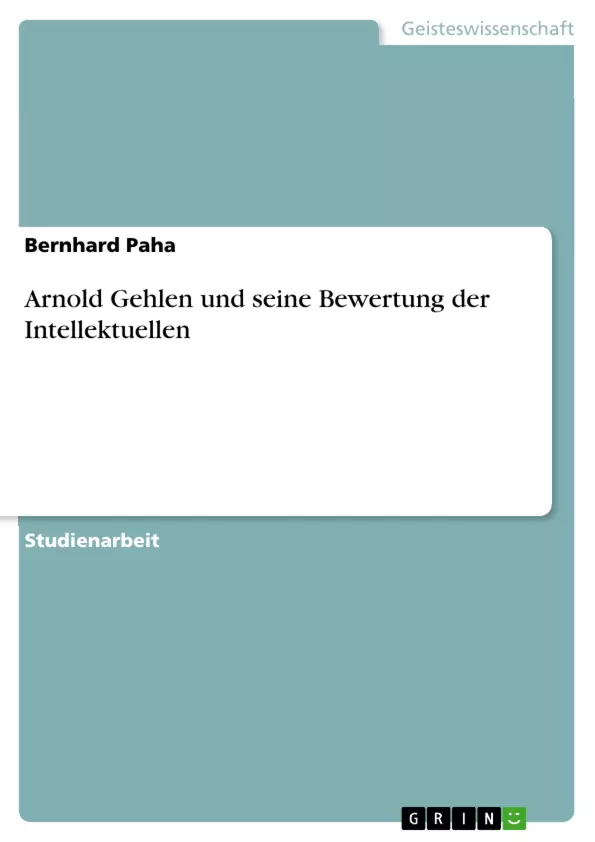Die Bewertung der Intellektuellen hat in Gehlens Gegenwartsanalyse in „Moral und Hypermoral“ aus dem Jahr 1969 sehr viel mit einer speziellen Erscheinungsform zu tun: den Massenmedien. Gehlens Kritik erstreckt sich allerdings auf eine Entwicklungslinie, die schon in der Antike beginnt. Hierzu greift Gehlen auf seine Anthropologie zurück, die er in seinem Werk „Der Mensch“ entwickelt hat. Es geht Gehlen um Grundlegendes: In welcher Weise hat Intellek¬tualität und damit die Instanz des Geistes im Menschen eine Berechtigung. Diese Frage verknüpft Gehlen mit der Etablierung von Institutionen und dem Einfluss der Intellektuellen auf diese. Die Arbeit skizziert Gehlens Anthropologie und Zeitanalyse. Und sie kritisiert Gehlens verkürzte Sicht auf Intellektualität und Institionen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Geistproblematik in Gehlens Werk „Der Mensch“
- Der Mensch als weltoffenes und handelndes Wesen
- Das Entlastungsprinzip und die Herausbildung von Symbolik
- Hemmung des Triebbedürfnisses als Voraussetzung für Seele
- Lebensnotwendige Funktion von Institutionen
- Der Vollzug des Daseins als in sich sinnvoll
- Die Intellektuellenproblematik in „Moral und Hypermoral“
- Gehlens Intellektuellenbild
- Gehlens Analyse der Gegenwart
- Die Intellektuellen als Propagandisten einer diktatorischen Moral
- Intellektualität, Geistigkeit und Institution
- Kritik an Gehlen: Institution und geistige Freiheit sind vereinbar
- Gehlen formuliert ein Bild vom Menschen ohne Persönlichkeit
- Kritik an Gehlen: Institutionen benötigen freie Gestaltung
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Intellektuellenproblematik in Arnold Gehlens Werken, insbesondere in „Der Mensch“ und „Moral und Hypermoral“. Ziel ist es, Gehlens Kritik an den Intellektuellen im Kontext seiner anthropologischen Grundlegung zu analysieren und die zentralen Argumente seines Intellektuellenbildes zu beleuchten.
- Die anthropologische Grundlegung Gehlens in „Der Mensch“ und die Bedeutung der Instinktreduktion für das menschliche Handeln
- Die Herausbildung von Symbolik und die Entstehung der Seele im Kontext des Entlastungsprinzips
- Gehlens Kritik an den Intellektuellen in „Moral und Hypermoral“ und deren Rolle in der gegenwärtigen Gesellschaft
- Die Problematik der „diktatorischen Moral“ und ihre Auswirkungen auf die geistige Freiheit
- Das Verhältnis von Institution und individueller Gestaltungsfreiheit in Gehlens Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problematik der Intellektuellen im Kontext von Gehlens Werk „Moral und Hypermoral“ ein und stellt die Relevanz seiner anthropologischen Grundlegung in „Der Mensch“ dar.
Kapitel 2 analysiert den Aspekt des Geistes in Gehlens Anthropologie. Es beleuchtet den Menschen als weltoffenes und handelndes Wesen, die Notwendigkeit des Entlastungsprinzips und die Herausbildung von Symbolik sowie die Rolle der Hemmung des Triebbedürfnisses für die Entstehung der Seele. Des Weiteren wird die lebensnotwendige Funktion von Institutionen und der Vollzug des Daseins als in sich sinnvoll diskutiert.
Kapitel 3 widmet sich der Intellektuellenproblematik in „Moral und Hypermoral“. Es analysiert Gehlens Intellektuellenbild, seine Kritik an den Intellektuellen als Propagandisten einer „diktatorischen Moral“ sowie die Verbindung von Intellektualität, Geistigkeit und Institution. Darüber hinaus werden kritische Einwände gegenüber Gehlens Position hinsichtlich der Vereinbarkeit von Institution und geistiger Freiheit sowie der Notwendigkeit freier Gestaltung für Institutionen geäußert.
Schlüsselwörter
Arnold Gehlen, Anthropologie, Intellektuelle, Moral und Hypermoral, Instinktreduktion, Entlastungsprinzip, Symbolik, Handlung, Institutionen, geistige Freiheit, diktatorische Moral
Häufig gestellte Fragen
Welches Menschenbild vertritt Arnold Gehlen?
Gehlen sieht den Menschen als „Mängelwesen“, das aufgrund reduzierter Instinkte auf Kultur und Institutionen angewiesen ist, um zu überleben (Entlastungsprinzip).
Warum kritisiert Gehlen die Intellektuellen?
In seinem Werk „Moral und Hypermoral“ kritisiert er Intellektuelle als Propagandisten einer „diktatorischen Moral“, die gewachsene Institutionen untergraben und die gesellschaftliche Stabilität gefährden.
Was versteht Gehlen unter dem „Entlastungsprinzip“?
Da der Mensch von Reizen überflutet wird, schaffen Institutionen und Symbole eine Ordnung, die ihn entlastet und zielgerichtetes Handeln ermöglicht.
Was ist die „Geistproblematik“ in Gehlens Anthropologie?
Es geht um die Frage, inwieweit die menschliche Intelligenz und Geistigkeit eine biologische Berechtigung haben und wie sie mit der Bildung von Institutionen verknüpft sind.
Welche Kritik wird an Gehlens Sichtweise geübt?
Die Hausarbeit kritisiert, dass Gehlen Institutionen und geistige Freiheit als Gegensätze sieht, während sie in einer modernen Gesellschaft eigentlich vereinbar sein sollten.
- Citar trabajo
- Magister Artium Bernhard Paha (Autor), 1991, Arnold Gehlen und seine Bewertung der Intellektuellen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142912