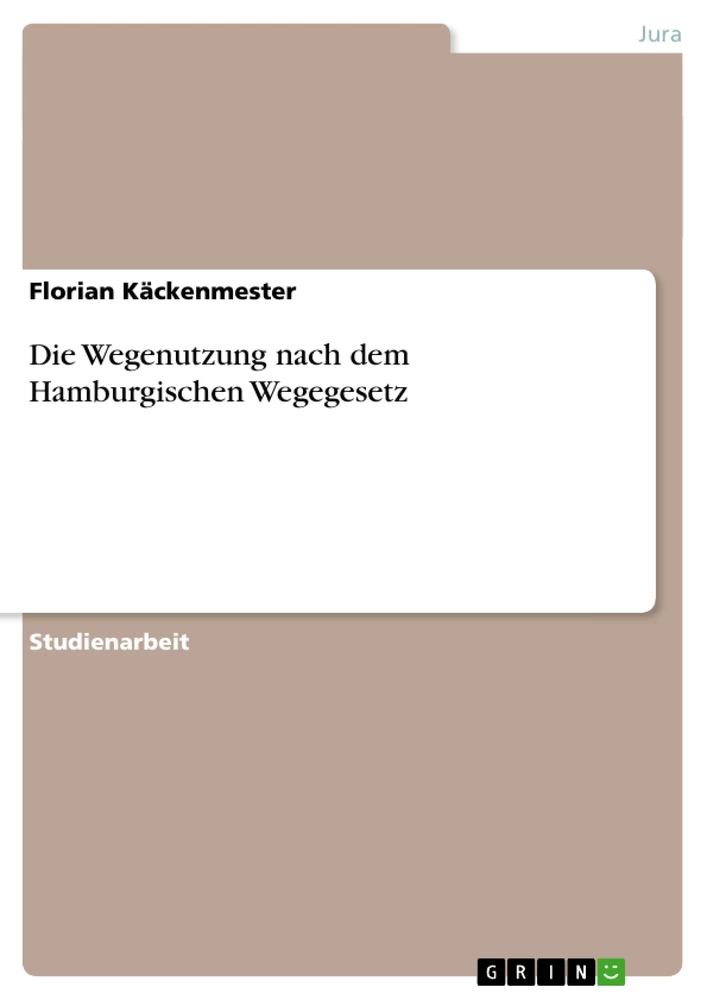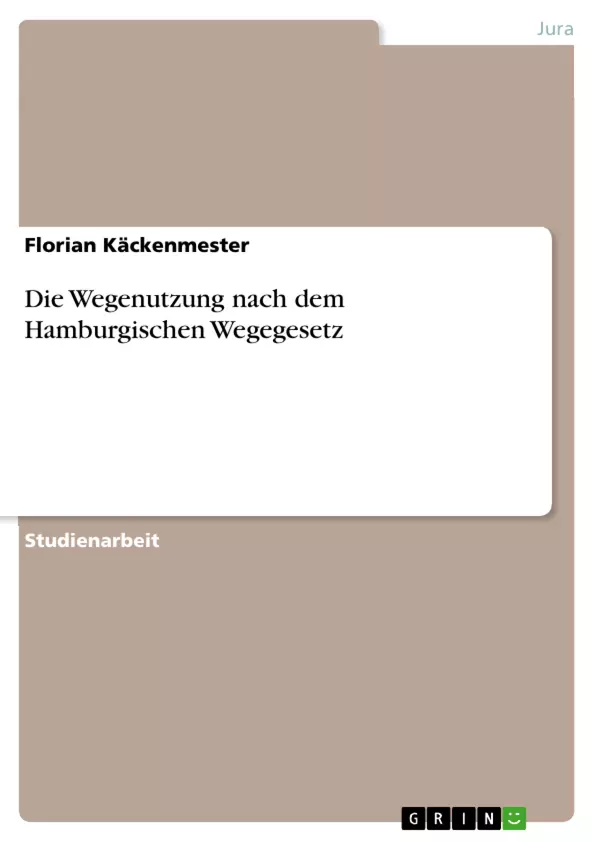Jeder tut es. Man geht zu Fuß zum Einkaufen, fährt mit dem Rad zur Arbeit und mit dem Auto zu Verwandten. Jeder nutzt die öffentlichen Straßen, Fuß- und Fahrradwege ganz selbstverständlich. Doch darf man auch ohne Weiteres seine Mülltonne auf den Weg stellen? Und wie verhält es sich eigentlich mit dem Gastwirt, der Tische und Stühle vor sein Restaurant stellen will? Oder der Telefongesellschaft, die Kabel unter einer Straße verlegen muss? Schon anhand dieser Beispiele lässt sich erahnen, dass es unterschiedliche Regelungen zum Gebrauch der öffentlichen Wege geben muss. Die gibt es auch – und die entsprechenden Gebühren gleich dazu. Die vorliegende Ausarbeitung gibt einen Überblick über den im Hamburgischen Wegegesetz (HWegeG) geregelten Gemein- und Anliegergebrauch sowie die genehmigungspflichtigen Sondernutzungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gemeingebrauch
- Anliegergebrauch
- Sondernutzungen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung bietet einen Überblick über die im Hamburgischen Wegegesetz (HWegeG) geregelten Nutzungsformen öffentlicher Wege. Sie beleuchtet die rechtlichen Grundlagen und Abgrenzungen zwischen Gemeingebrauch, Anliegergebrauch und Sondernutzungen.
- Gemeingebrauch als Standardnutzung öffentlicher Wege
- Anliegergebrauch als erweiterte Nutzung für Anlieger
- Sondernutzungen als genehmigungspflichtige Nutzungen
- Rechtliche Grundlagen im HWegeG und im Grundgesetz
- Abgrenzung der verschiedenen Nutzungsformen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Wegenutzung ein und skizziert anhand von Beispielen die verschiedenen Nutzungsarten öffentlicher Wege nach dem Hamburgischen Wegegesetz (HWegeG). Sie kündigt den Überblick über Gemeingebrauch, Anliegergebrauch und Sondernutzungen an, die im Folgenden detailliert dargestellt werden.
Gemeingebrauch: Dieses Kapitel definiert den Gemeingebrauch als Standardnutzung öffentlicher Wege, wie in § 16 Abs. 1 S. 1 HWegeG festgelegt. Es betont die uneingeschränkte und unentgeltliche Nutzung für jedermann, beschränkt jedoch diese Nutzung auf die Rahmenbedingungen der Widmung und der Straßenverkehrsvorschriften. Der Begriff "Verkehr" wird ausführlich diskutiert, mit Betonung auf seine Entwicklung vom ursprünglichen Verständnis der Fortbewegung hin zu einem breiteren Verständnis, das Kontakt, Güteraustausch und Kommunikation einschließt. Die Gewerbeausübung ist explizit vom Gemeingebrauch ausgeschlossen (§ 16 Abs. 2 S. 1 HWegeG), obwohl die entsprechende Rechtsverordnung noch nicht erlassen wurde. Beispiele für den Gemeingebrauch werden genannt, einschließlich Straßenmusik und -theater unter bestimmten Bedingungen. Die rechtliche Grundlage im Grundgesetz (Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 GG) wird hervorgehoben, ebenso der fehlende Rechtsanspruch auf Aufrechterhaltung des Gemeingebrauchs.
Anliegergebrauch: Dieses Kapitel behandelt den Anliegergebrauch (§§ 17 und 18 HWegeG) als Zwischenstufe zwischen Gemeingebrauch und Sondernutzung. Es definiert Anlieger als Eigentümer angrenzender Grundstücke und betont ihr erhöhtes Nutzungsinteresse. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern regelt das HWegeG den Anliegergebrauch explizit, wobei die Nutzung über den Gemeingebrauch hinaus für Zwecke des Grundstücks erlaubt ist, solange der Gemeingebrauch nicht erheblich beeinträchtigt wird. Die rechtliche Grundlage wird im Grundgesetz (Art. 2 Abs. 1 GG und Art. 14 GG) verankert. Der Anliegergebrauch wird als "gesteigerter Gemeingebrauch" bezeichnet, mit der Möglichkeit, Einschränkungen gerichtlich überprüfen zu lassen. Das Kapitel erläutert die Bedeutung des "notwendigen Kontakts nach außen" und die Pflicht des Straßenbaulastträgers zur Entschädigung bei dauerhafter Zugangsbehinderung. Konkrete Beispiele für den Anliegergebrauch werden vorgestellt, ebenso die Regelung von Überfahrten (§ 18 HWegeG) und die Notwendigkeit einer Erlaubnis für das Befahren von Wegeflächen mit nicht dafür vorgesehenen Fahrzeugen.
Sondernutzungen: Das Kapitel beschreibt Sondernutzungen (§ 19 HWegeG), die den Gemeingebrauch dauerhaft ausschließen, in den Wegekörper eingreifen oder über den Gemein- und Anliegergebrauch hinausgehen. Es betont die Ermessensentscheidung der zuständigen Behörde bei der Abgrenzung zu anderen Nutzungsformen und die Notwendigkeit einer straßenrechtlichen Betrachtungsweise. Straßenverkehrsrechtliche Verstöße stellen keine Sondernutzung dar.
Schlüsselwörter
Hamburgisches Wegegesetz (HWegeG), Gemeingebrauch, Anliegergebrauch, Sondernutzung, Straßenrecht, Grundgesetz, Wegenutzung, Verkehrsrecht.
Häufig gestellte Fragen zum Hamburgischen Wegegesetz (HWegeG)
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Hamburgische Wegegesetz (HWegeG) und die darin geregelten Nutzungsformen öffentlicher Wege. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Darstellung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel (Einleitung, Gemeingebrauch, Anliegergebrauch, Sondernutzungen) sowie eine Liste der Schlüsselwörter.
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte des Dokuments?
Das Dokument erläutert die rechtlichen Grundlagen und die Abgrenzung zwischen Gemeingebrauch, Anliegergebrauch und Sondernutzungen öffentlicher Wege nach dem HWegeG. Es beleuchtet die jeweilige Rechtsgrundlage im HWegeG und im Grundgesetz und zeigt die Unterschiede zwischen den verschiedenen Nutzungsformen auf.
Was ist Gemeingebrauch im Sinne des HWegeG?
Gemeingebrauch ist die Standardnutzung öffentlicher Wege, die jedermann uneingeschränkt und unentgeltlich zusteht (§ 16 Abs. 1 S. 1 HWegeG). Diese Nutzung ist jedoch auf die Rahmenbedingungen der Widmung und der Straßenverkehrsvorschriften beschränkt. Gewerbeausübung ist explizit ausgeschlossen (§ 16 Abs. 2 S. 1 HWegeG). Beispiele sind das gewöhnliche Gehen, Radfahren oder das Halten von Veranstaltungen wie Straßenmusik oder -theater (unter bestimmten Bedingungen).
Was ist Anliegergebrauch im Sinne des HWegeG?
Anliegergebrauch (§§ 17 und 18 HWegeG) ist eine erweiterte Nutzungsmöglichkeit für Eigentümer angrenzender Grundstücke. Er geht über den Gemeingebrauch hinaus und erlaubt die Nutzung öffentlicher Wege für Zwecke des Grundstücks, solange der Gemeingebrauch nicht erheblich beeinträchtigt wird. Es handelt sich um einen "gesteigerten Gemeingebrauch", der gerichtlich überprüfbar ist. Beispiele sind Überfahrten und der Zugang zu den eigenen Grundstücken.
Was sind Sondernutzungen im Sinne des HWegeG?
Sondernutzungen (§ 19 HWegeG) schließen den Gemeingebrauch dauerhaft aus, greifen in den Wegekörper ein oder gehen über den Gemein- und Anliegergebrauch hinaus. Sie erfordern eine Genehmigung der zuständigen Behörde und werden im Einzelfall geprüft. Straßenverkehrsrechtliche Verstöße stellen keine Sondernutzung dar.
Welche Rechtsgrundlagen sind im Dokument relevant?
Das Dokument bezieht sich hauptsächlich auf das Hamburgische Wegegesetz (HWegeG) und relevante Artikel des Grundgesetzes (GG), insbesondere Art. 2 Abs. 1 GG und Art. 14 GG (in Bezug auf Anliegergebrauch) sowie Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 GG (in Bezug auf Gemeingebrauch).
Wie werden die verschiedenen Nutzungsformen abgegrenzt?
Die Abgrenzung der Nutzungsformen erfolgt anhand der Kriterien Dauerhaftigkeit der Nutzung, Eingriff in den Wegekörper, Ausmaß der Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs und der Notwendigkeit einer Genehmigung. Die zuständige Behörde trifft im Einzelfall die Ermessensentscheidung.
Welche Schlüsselwörter sind im Zusammenhang mit dem HWegeG relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Hamburgisches Wegegesetz (HWegeG), Gemeingebrauch, Anliegergebrauch, Sondernutzung, Straßenrecht, Grundgesetz, Wegenutzung, Verkehrsrecht.
- Citar trabajo
- Florian Käckenmester (Autor), 2010, Die Wegenutzung nach dem Hamburgischen Wegegesetz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143604