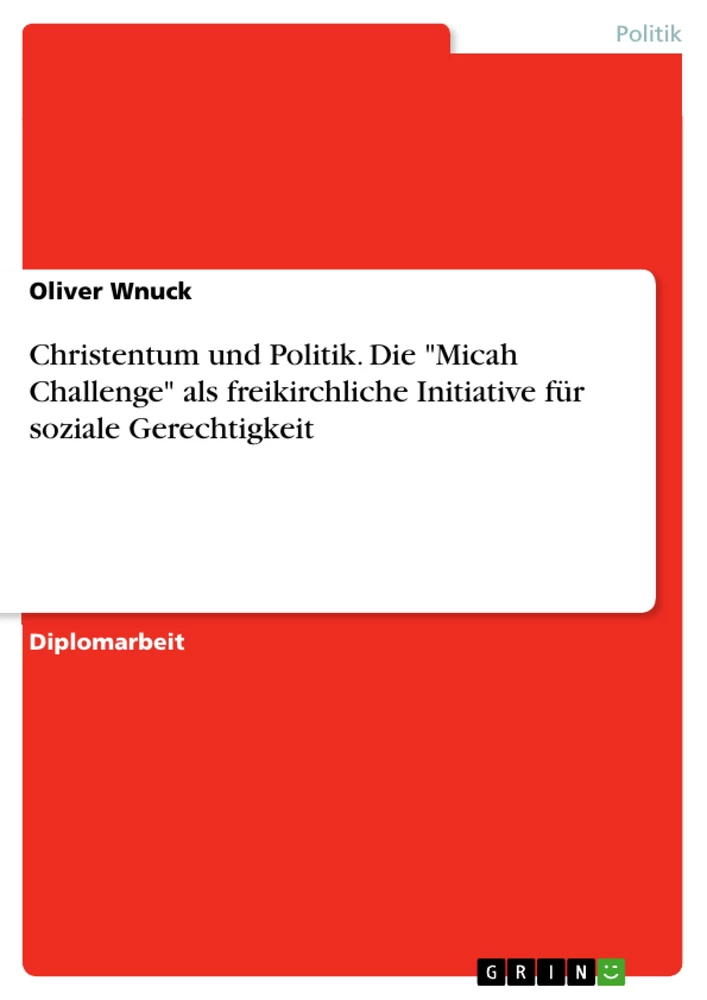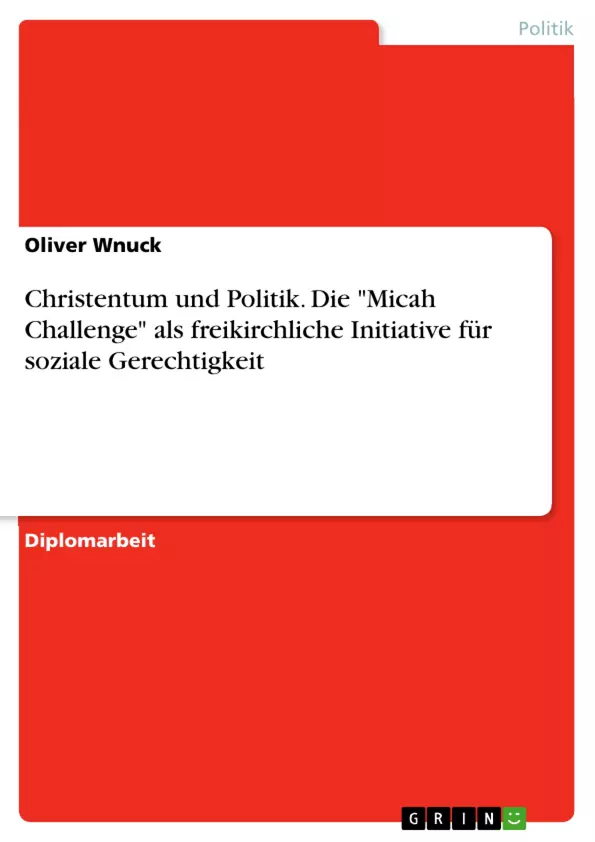Die vorliegende Arbeit diskutiert das Verhältnis von Christentum und Politik am Beispiel der Micah-Initiative (MI), einer evangelikalen Entwicklungsinitiative. Zu diesem Zweck erfolgt ein Überblick über die Geschichte des Christentums hinsichtlich seines Verhältnisses zur Politik und zu sozialpolitischem Engagement. Die MI wird daran anschließend als spezifische Ausprägung eines neuzeitlich-postmodernen Christentums näher erläutert und untersucht. Voraussetzung für diese Untersuchung bildet zum einen der politiktheoretische Diskurs über die Rolle des Religiösen in der säkularen Öffentlichkeit.
Zum anderen werden in dieser Arbeit Faktoren angeführt und analysiert, die die Ausformung religiöser Orientierungen zwischen friedlich-sozialen und autoritär-dogma-tischen Werten bedingen.3 Darauf aufbauend und ausgehend von dem spezifischen Kontext der Entwicklungszusammenarbeit in dem die MI agiert, werden Kriterien aufgestellt um die MI, bzw. religiöse Akteure im Allgemeinen im Hinblick auf ihre politiktheoretische Ausrichtung, gesellschaftspolitischen Potentiale und untergründigen Normvorstellungen untersuchen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziel der Arbeit
- Einleitende Gedanken zum Verhältnis von Christentum und Politik
- Idealtypische Beziehungsmuster zwischen Politik und Religion
- Beschreibung der Micha-Initiative/ Micah Challenge
- Aufbau der Arbeit
- Historisch-Epochale Paradigmen im Verhältnis von Christentum und Politik - Von der Alternativkultur zur freundschaftlichen Kooperation
- Urchristlich-Apokalyptisches Paradigma
- Altkirchlich-Hellenistisches und orthodoxes Paradigma
- Römisch-Katholisches Paradigma
- Reformatorisch-Protestantische Paradigma
- Modernes Paradigma
- Exkurs zum Fundamentalismus
- Neuzeitlich-postmodernes Paradigma
- Religion und weltanschauliche Neutralität - Die freundschaftliche Trennung von Politik und Religion und die Rolle religiöser Akteure
- Voraussetzungen staatsbürgerlicher Solidarität und der Einfluss religiöser Orientierungen
- Säkulare Öffentlichkeit und die Beteiligungsmöglichkeiten religiöser Akteure
- Freundschaftliche Trennung aus christlicher Perspektive - Die Selbstpositionierung der Kirchen im säkularen Staat und der internationalen Zivilgesellschaft
- Engel und Dämonen: Der gesellschaftspolitische Gehalt religiöser Orientierungen und die Einflussfaktoren für ihre Entwicklung
- Die grundsätzliche Ambivalenz religiöser Orientierungen
- Der Einfluss soziokultureller Bedingungen auf die historischen Ausprägungen des Christentums
- Gesellschaftliche Makrostrukturen
- Das kulturelle Umfeld
- Strukturbedingungen religiöser Gemeinschaften
- Individuelle Interessen und Charakterstrukturen
- Die Voraussetzungen für sozialliberale und friedenspolitische Ausrichtung religiöser Organisationen
- Strukturelles Autonomiepotential
- Friedlichkeit der Lehre
- Exkurs: Strukturmechanismen religiöser Orientierungen
- Verankerung der Lehre in den Strukturen der Gemeinschaft
- Ausbildung in Friedenstechniken und Methoden sozialpolitischer Arbeit
- Religion und Entwicklungszusammenarbeit
- Staat und weltweite Gemeinschaft - Veränderte Strukturbedingungen und die Position der christlichen Kirchen
- Die Voraussetzungen für einen positiven Beitrag religiöser Akteure in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit
- Kriterien zur Beurteilung des politischen Engagements weltanschaulicher Organisationen
- Gesellschaftspolitische Orientierungen
- Arbeits- und Kooperationsweise
- Interne Strukturen und strukturelle Verflechtungen
- Religiöses Selbstverständnis
- Reflexion kritischer Potentiale
- Vorstellung der Micha-Initiative
- Die evangelikalen Wurzeln der Micha-Initiative
- Evangelikalismus und gesellschaftliches Engagement
- Die Gründung des Micah-Networks und der Micha-Initiative
- Motive und Vorrangige Ziele der Arbeit von Micah Challenge
- Die Praktische Arbeit
- Innerkirchliche Bildungsarbeit
- Interkirchliche und zivilgesellschaftliche Netzwerkarbeit
- Lobbying und Kampagnenarbeit
- Einfluss der Micha-Initiative
- Ihre Bedeutung innerhalb der evangelikalen Szene
- Einfluss auf die Verwirklichung der Millenniumsentwicklungsziele
- Die Micha-Initiative aus der Sicht externer Akteure
- Gesellschaftspolitische Bewertung der Micha-Initiative
- Gesellschaftspolitische Orientierungen
- Arbeits- und Kooperationsweise
- Interne Strukturen und strukturelle Verflechtungen
- Religiöses Selbstverständnis
- Reflexion kritischer Potentiale
- Bewertung der Micha-Initiative
- Zeitgeschichtliche Einordnung
- Zur Rolle religiöse Akteure in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht das Verhältnis von Christentum und Politik anhand der Micha-Initiative, einer evangelikalen Entwicklungsinitiative. Die Arbeit beleuchtet historische Paradigmen des Verhältnisses zwischen Christentum und Politik, analysiert die Rolle religiöser Akteure in der säkularen Öffentlichkeit und untersucht die spezifischen Faktoren, die die Ausformung religiöser Orientierungen zwischen friedlich-sozialen und autoritär-dogmatischen Werten bedingen.
- Die historische Entwicklung des Verhältnisses von Christentum und Politik
- Die Rolle religiöser Akteure in der säkularen Öffentlichkeit
- Faktoren, die die Ausformung religiöser Orientierungen beeinflussen
- Die Micha-Initiative als Beispiel für ein neuzeitlich-postmodernes Christentum
- Kriterien zur Beurteilung des politischen Engagements weltanschaulicher Organisationen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Verhältnis von Christentum und Politik als ein spannendes und komplexes Feld dar, das von Ambivalenz geprägt ist. Die Micha-Initiative wird als Fallbeispiel für das neuzeitlich-postmoderne Christentum und seine Ausprägung im Bereich des politischen Engagements eingeführt.
- Historisch-Epochale Paradigmen im Verhältnis von Christentum und Politik: Dieser Abschnitt beleuchtet die historische Entwicklung des Verhältnisses zwischen Christentum und Politik von der Urkirche bis zur Neuzeit. Es werden verschiedene Paradigmen und ihre Einflussfaktoren analysiert, um das Verhältnis zwischen Religion und Politik besser zu verstehen.
- Religion und weltanschauliche Neutralität: Dieser Teil befasst sich mit der Rolle religiöser Akteure in der säkularen Öffentlichkeit. Es werden die Voraussetzungen staatsbürgerlicher Solidarität und der Einfluss religiöser Orientierungen diskutiert, sowie die Möglichkeiten für religiöse Akteure zur Beteiligung am politischen Prozess.
- Engel und Dämonen: Dieser Abschnitt analysiert die gesellschaftspolitischen Auswirkungen religiöser Orientierungen. Es werden die Faktoren untersucht, die die Ausformung religiöser Orientierungen zwischen friedlich-sozialen und autoritär-dogmatischen Werten bedingen.
- Religion und Entwicklungszusammenarbeit: Der Abschnitt betrachtet die Rolle religiöser Akteure in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Es werden die Voraussetzungen für einen positiven Beitrag religiöser Akteure in diesem Kontext diskutiert.
- Kriterien zur Beurteilung des politischen Engagements weltanschaulicher Organisationen: In diesem Abschnitt werden Kriterien zur Beurteilung des politischen Engagements weltanschaulicher Organisationen vorgestellt. Es werden verschiedene Aspekte wie gesellschaftspolitische Orientierungen, Arbeits- und Kooperationsweise, interne Strukturen und religiöses Selbstverständnis betrachtet.
- Vorstellung der Micha-Initiative: Die Micha-Initiative, eine evangelikale Entwicklungsinitiative, wird vorgestellt. Ihre Geschichte, Motive, Ziele und praktische Arbeit werden detailliert erläutert.
- Gesellschaftspolitische Bewertung der Micha-Initiative: Die Micha-Initiative wird auf Basis der zuvor entwickelten Kriterien hinsichtlich ihrer gesellschaftspolitischen Orientierungen, Arbeits- und Kooperationsweise, internen Strukturen, religiösen Selbstverständnisses und kritischen Potentiale bewertet.
- Bewertung der Micha-Initiative: Die Arbeit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Analyse der Micha-Initiative zusammen und bewertet ihre Rolle im Verhältnis von Christentum und Politik.
- Zeitgeschichtliche Einordnung: Die Arbeit ordnet die Micha-Initiative in den Kontext der Zeitgeschichte ein und betrachtet ihre Bedeutung im Hinblick auf die Rolle religiöser Akteure in der heutigen Gesellschaft.
- Zur Rolle religiöse Akteure in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit: Abschließend beleuchtet die Arbeit die Bedeutung religiöser Akteure in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit und diskutiert deren Potenziale und Herausforderungen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind Christentum, Politik, Religion, Micha-Initiative, Evangelikalismus, Entwicklungszusammenarbeit, säkulare Öffentlichkeit, friedlich-soziale Orientierungen, autoritär-dogmatische Werte, gesellschaftspolitische Bewertung, politische Ethik, religiöse Akteure, weltanschauliche Neutralität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die "Micah Challenge" (Micha-Initiative)?
Es ist eine weltweite evangelikale Initiative, die sich für soziale Gerechtigkeit und die Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele einsetzt.
Wie stehen Christentum und Politik zueinander?
Das Verhältnis ist historisch komplex und reicht von strikter Trennung bis hin zu enger Kooperation oder politischem Aktivismus aus religiöser Motivation.
Was sind Millenniumsentwicklungsziele?
Dies sind von den Vereinten Nationen festgelegte Ziele zur Bekämpfung von Armut, Hunger und Krankheit weltweit, die von der Micha-Initiative unterstützt werden.
Welche Rolle spielen religiöse Akteure in der Entwicklungszusammenarbeit?
Sie können durch ihre Netzwerke und ethische Motivation positive Beiträge leisten, stehen aber oft vor der Herausforderung der weltanschaulichen Neutralität.
Was ist der Fokus der praktischen Arbeit von Micah Challenge?
Die Arbeit umfasst innerkirchliche Bildungsarbeit, Lobbying bei Regierungen sowie globale Kampagnen für mehr soziale Gerechtigkeit.
- Citar trabajo
- Oliver Wnuck (Autor), 2008, Christentum und Politik. Die "Micah Challenge" als freikirchliche Initiative für soziale Gerechtigkeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143784