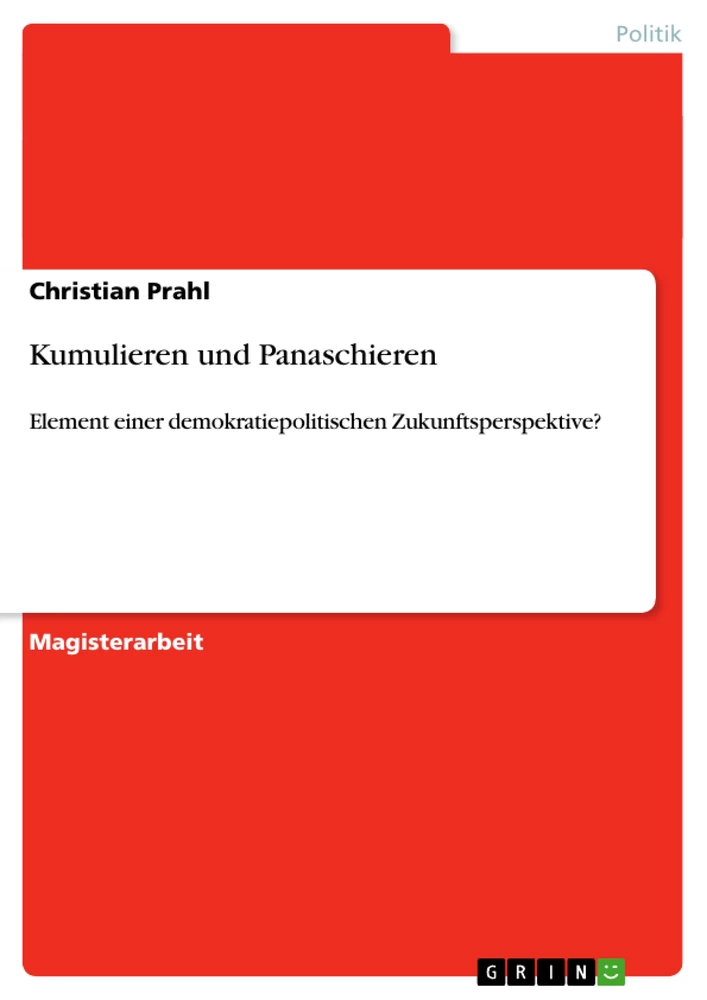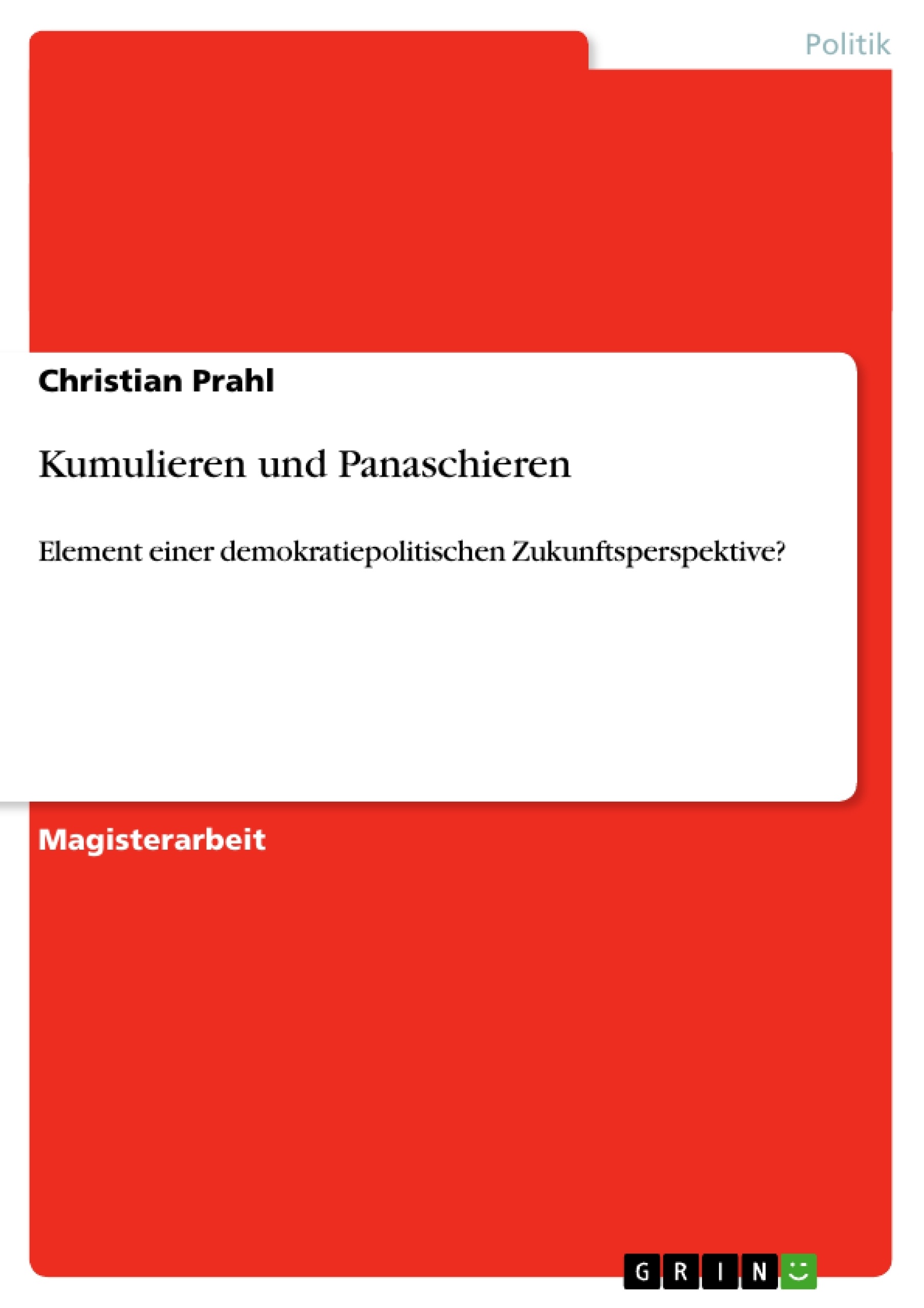„Auch Demokratie muß, wenn ihr ein Wert vermittelt werden soll, spürbar sein, ja stärker spürbar werden. (...) Der Staat muß sich dem Bürger als Beteiligungsstaat präsentieren.“1 Diese Betrachtung des damaligen Bundespräsidenten Roman spiegelt den Grundgedanken von Wahlrechtsdiskussionen seit Beginn der 90er Jahre in die heutige Zeit wider und setzt an einer weit verbreiteten Parteienkritik an.
Als ein Mittel gegen Politikverdrossenheit wird immer wieder eine Veränderung des Wahlrechtes, insbesondere die Einführung von Kumulieren und Panaschieren angeführt.
In den süddeutschen Bundesländern ist Kumulieren und Panaschieren auf kommunaler Ebene jahrzehntelange Praxis. Es wurde jedoch in den letzten zwanzig Jahren in fast allen anderen Ländern in unterschiedlichen Varianten eingeführt. Die dort gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen mit Kumulieren und Panaschieren
sollen Gegenstand dieser Arbeit sein, um bewerten zu können, ob eine Einführung in weitere Ebenen des bundesdeutschen Staates sinnvoll erscheint.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Einführung
1.2. Problemaufriss
1.3. Fragestellungen und Hypothese
2. Stimmgebungssystem Kumulieren und Panaschieren
2.1.1. Klassifizierung
3. Analyse des Stimmgebungssystems Kumulieren und Panaschieren
3.1. Das Grundgesetz und seine diesbezüglichen Verfassungs-bestimmungen
3.1.1.3. Die freie Wahl
3.1.1.4. Die gleiche Wahl
3.1.1.5. Die geheime Wahl
3.1.2. Leistungsanforderungen an Wahlsysteme
3.1.2.1. Repräsentation
3.1.2.2. Konzentration
3.1.2.3. Partizipation
3.1.2.4. Funktionalität
3.1.2.5. Legitimität
3.1.2.6. Weitere Ziele und Aufgaben
3.2. Zwischenfazit
4. Demokratiepolitische Auswirkungen
4.1. Verfasstheit/Einfluss der Parteien
4.2. Kandidatinnen und Kandidaten
4.3. Wählerinnen und Wähler
4.4. Wahlorgane/ Organisation
4.5. Mögliches Mittel gegen Politikverdrossenheit
4.6. Zwischenfazit
5. Exkurs: Möglichkeit einer Einführung von Kumu- lieren und Panaschieren auf Landes- und Bundesebene
6. Abschließende Betrachtung
7. Literaturverzeichnis
8. Anlage
1. Einleitung
1.1. Einführung
,, Auch Demokratie muß, wenn ihr ein Wert vermittelt werden soll, spürbar sein, ja wieder stärker spürbar werden. (...) Der Staat muß sich dem Bürger als Beteiligungsstaat präsentieren. " 1 Diese Betrachtung des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog spiegelt den Grundgedanken von Wahlrechtsdiskussionen seit Beginn der 90er Jahre bis in die heutige Zeit wider und setzt an einer weit verbreiteten Parteienkritik an.
Die vergangenen Jahrzehnte gelten hier als Phase der Politikverdrossenheit oder gar der Parteienverdrossenheit. Gefördert durch ungelöste wirtschaftliche und politische Probleme sowie durch zahlreiche politische Affären genährt, kam eine Diskussion in Gang, die sich mit den Parteien als Kern der Krise befasste.2 Neben anderen Aussagen prägte insbesondere Richard von Weizsäcker mit dem Ausdruck ,, Machtvergessenheit bei gleichzeitiger Machtversessenheit " 3 die anhaltende Parteienkritik, indem er das Bild von Parteien als zahlreichen Kraken, welche die Gesellschaft in der Gewalt halten, zeichnete. Eine ständig sinkende Wahlbeteiligung auf allen Ebenen seit Anfang der achtziger Jahre scheint den Parteienkritikern Recht zu geben.4
Als Ansatzpunkt für Veränderungen wird in der Diskussion häufig ein Mehr an Demokratie verlangt, und man flechtet hier Reformansätze neben der Forderung nach direktdemokratischen Elementen vor allem Veränderungen im Wahlrecht in den Dialog ein.5
In unserer repräsentativen Demokratie stellen Wahlen die essenziellste Form der Bürgerbeteiligung am politischen Prozess dar. Die Volkssouveränität drückt sich somit insbesondere im Wahlakt aus und wird vom bundesdeutschen Grundgesetz an exponierter Stelle gewürdigt. ,, Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen (...) ausgeübt. " 6. Durch diese Wahlen übt das Volk die Staatsgewalt über Repräsentanten und Organe aus. Das Grundgesetz hat sich damit für die Form der mittelbaren und parlamentarischen Demokratie entschieden,7 auch wenn dies Formen direkter Demokratie wie Volksentscheide nicht prinzipiell ausschließt und für sie grundsätzlich offen ist.8
Der Bürger nimmt also nur indirekt an politischen Entscheidungen teil. Die eigentliche politische Willensbildung wird von den Parteien wahrgenommen. Die Gestaltung, wie die Vertreter der Bürger in ihre Aufgabe gewählt werden, bleibt daher grundlegend für das Parteiensystem und für die politischen Entscheidungsfindungen eines Landes. Dies ist unabhängig der Verteilung der Aufgaben der Legislative auf eine oder mehrere Kammern, von den Einflussmöglichkeiten derselben auf die Regierung, einer ggf. möglichen Direktwahl des Hauptes der Exekutive oder der Einbeziehung weiterer denkbarer direktdemokratischer Elemente.
Die Diskussion über die richtige Form des Wahlrechts ist nunmehr über 100 Jahre alt. Nach Anfängen in Form eines Mehrheitswahlrechts während der Zeit des Norddeutschen Bundes und des Deutschen Kaiserreiches über ein reines Verhältniswahlsystem innerhalb der Weimarer Republik fand man den Weg zu einem personalisierten Verhältniswahlrecht.9 Im Zuge der Erörterung einer möglichen Demokratisierung des Wahlrechts treten hier insbesondere bürgeraktive Wahlsysteme wie das Stimmgebungssystem Kumulieren und Panaschieren in das Schlaglicht der Debatte. Dieses System, welches als Element dem Verhältniswahlrecht zuzuordnen ist, unterscheidet sich insbesondere entsprechend des Einflusses, welcher dem Wähler im Bezug auf die personelle Besetzung der Parlamente bzw. kommunalen Gremien zuerkannt wird, von anderen Entwürfen. Dem Bürger soll somit ein ,, Wählen a la carte ' , ohne Bindung an die Listenvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen, möglich sein10, wobei das grundsätzliche Aufstellungsmonopol der Organisationen erhalten bleibt. Befürworter versprechen sich hiervon eine Wandlung der Rolle der politischen Parteien und ihrem Verhältnis zu den Wählern. Parteien wären somit gezwungen, bei der Aufstellung von Bewerbern mögliche Präferenzen der Bevölkerung intensiver mit einzubeziehen, was mutmaßlich zu mehr Bürgernähe und einem Aufbrechen erstarrter Parteistrukturen führen könnte.11
In den süddeutschen Bundesländern ist Kumulieren und Panaschieren auf kommunaler Ebene jahrzehntelange Praxis. Es wurde jedoch in den letzten zwanzig Jahren in fast allen anderen Ländern in unterschiedlichen Varianten eingeführt.12
Die dort gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen mit Kumulieren und Panaschieren sollen Gegenstand dieser Arbeit sein, um bewerten zu können, ob eine Einführung in weitere Ebenen des bundesdeutschen Staates sinnvoll erscheint.
Neben den Forderungen nach Einführung dieses Systems bei Kommunalwahlen in den übrigen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen oder dem Saarland, ist die Diskussion schon auf eine weitere Stufe gelangt.
,, Ich kann mir durchaus mehr direkten Einfluß der Bürger vorstellen, etwa das Kumulieren und Panaschieren der Wählerstimmen auch bei Bundes- und Landtagswahlen, (...)". 13 Mit dieser Empfehlung des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog schließt sich der Kreis des Diskurses nunmehr auch auf der Landes- und Bundesebene.
1.2. Problemaufriß
Parteien sind in der bundesdeutschen Verfassungsordnung als Vermittler und als Mitwirkende bei der politischen Willenbildung besonders hervorgehoben.14 Auf dieser Grundlage entwickelte sich in Deutschland, ähnlich wie in anderen westlichen Staaten, eine parteienstaatliche Demokratie. Parteien kanalisieren als Träger der politischen Willensbildung Bedürfnisse und Interessen in Richtung der Verfassungsorgane und vermitteln im Gegenzug deren Entscheidungen dem Wähler.15 Allerdings haben sich im Parteienstaat Muster entwickelt, welche ihn von der herkömmlichen parlamentarisch-repräsentativen Demokratie unterscheiden. Der Gemeinwille wird in diesem System fast ausschließlich durch die Parteien abgebildet, wodurch Entscheidungen faktisch des Öfteren nicht mehr im Parlament durch die vom Volk gewählten Repräsentanten, sondern in Parteikreisen getroffen und anschließend von den Abgeordneten nur noch vollzogen werden.16
Da Parteien neben dem eigentlichen Vorschlagsmonopol für Kandidaten aufgrund des geltenden Wahlrechts auch großen Einfluss auf die tatsächliche Zusammensetzung des Parlamentes nehmen17, erfährt hierdurch diese Problematik eine weitere Brisanz und steht in einem Spannungsverhältnis zu Art. 20 II GG, nachdem alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht.18
Aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen, stetig ansteigender Pluralisierung von Lebensentwürfen sowie wachsender Konkurrenzsituationen von Parteien gegenüber weiteren Akteuren der politischen Willensbildung19 gerät das Parteiensystem zunehmend in eine Legitimationskrise. Die Erscheinungsform der Volkspartei, mit in der Gesellschaft breit verwurzelter Mitgliedschaft, wird von einem neuen Typus abgelöst, welcher mit den Wählern zunehmend nur noch über die Medien kommuniziert, sich intern professionalisiert und das Entscheidungszentrum in die Parteispitzen bzw. Fraktionsspitzen verlagert bzw. verengt. Somit kommen Parteien der Vermittlung bzw. Mediatisierung von Politik als ihrer wichtigsten Aufgabe nur noch eingeschränkt nach.20 Folgt man dieser Analyse, so stellt sich die Frage nach einer Methode, welche Parteienstaat und Volksherrschaft wieder miteinander versöhnt. Neben der Forderung nach direktdemokratischen Elementen erscheinen Vorschläge zur Änderung des Wahlrechts in der Diskussion als naheliegend.
Das Wahlrecht setzt nicht nur Wahlergebnisse in Mandate um, sondern beeinflusst durch Wechselbeziehungen zum Wahlverhalten sowie ebenso zur inneren Struktur von Parteien weitere wichtige Indikatoren.21
Vor dem Hintergrund vielfältiger Enttäuschungen, ob nun real oder in der politischen Debatte hochstilisiert, sind Forderungen nach mehr Einflussmöglichkeiten für den Bürger immerhin nachvollziehbar. Allerdings besteht zudem die Notwendigkeit, dass politische Systeme nicht nur ,, demokratiegetragen"22 sein sollen, sondern auch effektiv arbeiten müssen. Eine Balance zwischen der Beteiligung der Bürger und der notwendigen Wirksamkeit des politischen Systems erscheint somit notwendig.23
In dieser Frage zeigt sich das Spannungsfeld zwischen der partizipatorischen und der funktionalistischen Dimension von Demokratie. Letztere stellt in der Diskussion insbesondere auf die Erzeugung von Mehrheiten, die Position der Parteien und die Handlungsfähigkeit des Parlaments ab und rechtfertigt somit die Vormachtstellung der Parteien. Die partizipatorische Sichtweise hingegen greift den Alleinherrschaftsanspruch der Parteien, insbesondere bei der Nominierung von Bewerbern, an und beklagt einen Mangel an Repräsentativität aufgrund des fehlenden Bezuges der Wähler zu anonymen geschlossenen Listen.
Jenseits dieser Problematik muss man sich der Bedeutung der Folgen von Wahlrechtsänderungen bewusst sein. ,, Je mehr Einflußmöglichkeiten Wähler erhalten, um so komplizierter wird das Wahlrecht. 24 Insofern bestehen auch bezüglich der Ausgestaltung von Kumulieren und Panaschieren Hindernisse und natürliche Grenzen.
Die Einführung eines neuen Wahlrechts mit Kumulieren und Panaschieren bringt ein gewisses Maß an Personalisierung mit sich, welches die Gefahr einer Entpolitisierung möglicherweise in sich trägt.25 Gleichermaßen kollidieren die Präferenzen der Wähler in Teilen mit der bisherigen Praxis der Parteien zur Rekrutierung politischen Personals, da diese oft auch innerparteiliche Bewertungsmaßstäbe zur Auswahl der Kandidaten ansetzen.26 Hier dürften neben machtpolitischen Interessen, innerparteilichen Verdiensten durchaus auch Kompetenzressourcen in Form von fachkundigen Gremien- bzw. Parlamentsmitgliedern eine Rolle spielen.
Letztendlich bleibt aber auch bei neuen Wahlsystemen der Wählerwille unberechenbar.27 Der Kontrast zwischen dem Anspruch hinsichtlich der beabsichtigten positiven Effekte und den tatsächlichen Auswirkungen auf die Akteure, bildet jenen Zusammenhang, dem das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit zugrunde liegt.
1.3. Fragestellung und Hypothese
So wie Befürworter des Kumulierens und Panaschierens mit dessen Einführung hohe Erwartungen verbinden, bringen Kritiker ebenso zahlreiche Vorbehalte gegen dieses Wahlrecht vor.28 Ziel der Fürsprecher ist es, das Verhältnis des Volkes als Träger der Staatsgewalt und der Parteien als Mitwirkende bei der Willensbildung desselben, soll wieder ins Lot zu bringen.
Eine erkenntnisleitende Fragestellung, welche dieser Magisterarbeit vorangeht, kann man, im Bezug auf die eben skizzierte Problematik, wie folgt zusammenfassend formulieren:
Wird durch eine Einführung dieses Stimmgebungssystems ein Mehr an Demokratie tatsächlich erreicht, kann es einer befürchteten Aushebelung der Volkssouveränität vorbeugen und entspricht dieses komplexe Wahlrecht wirklich dem Bürgerwillen?
Hier werden neben der Verständlichkeit, Akzeptanz und Nutzung des Systems auch die demokratiepolitischen Auswirkungen zu untersuchen sein. Kumulieren und Panaschieren rückt augenscheinlich Elemente der Persönlichkeitswahl noch deutlicher in den Mittelpunkt des Interesses.
Daher gilt es zu untersuchen, ob es ,Gewinner' und ,Verlierer' einer solchen Entwicklung geben wird und somit eine akteurspezifische Analyse vorgenommen werden kann, welche neben den Kandidaten und Parteien gleichwohl auch mögliche Motive und sozistrukturelle Merkmale der Wähler mit einbezieht. Ebenso reizvoll erscheint in diesem Zusammenhang die Frage, ob die Auswirkungen gleichermaßen in allen Bereichen zutreffen oder inwieweit regionale bzw. auf andere Ebenen des Staatsaufbaus bezogene Unterschiede existieren.
Gerade die Rolle der Akteure sowie die Bewertung von Auswirkungen des Kumulierens und Panaschierens ist in der Diskussion immer noch umstritten. Daher soll vor Beginn einer genaueren Analyse nachstehende Hypothese aufgestellt werden, welche in der Folge anhand der Untersuchungsergebnisse zu überprüfen ist:
Kumulieren und Panaschieren kann als neues Wahlrecht zu einer besseren Einheit der Wähler, Wahlvorschlagsberechtigen (Parteien) und den Kandidaten führen und somit die Grundlagen des repräsentativ-parlamentarischen Modells im Sinne eines Mehr an Demokratie von innen heraus verbessern. Allerdings wird dies allein unzureichend sein, um der Entwicklung der politischen Verdrossenheit entgegenzuwirken oder diese gar umzukehren.
Aus der Tatsache, dass die zuvor genannte Fragestellung eines der wesentlichen Bestandteile unseres verfassungsmäßigen Systems untersucht und eine Analyse der an diesem politischen Prozess beteiligten Akteure einbezieht , ergibt sich eine deutliche politikwissenschaftliche Relevanz.
1.4. Aktuelle Forschungslage
Allgemein haben Wahlrechtsdiskussionen in der Wissenschaft in den vergangenen Jahrzehnten einen breiten Raum eingenommen.29 Dennoch ist die Forschungslage im Bereich des Kumulieren und Panaschieren relativ überschaubar. Aufgrund eigener Recherchen, aber auch in Gesprächen mit Autoren, Vertretern von Bürgerbewegungen sowie Vertretern von Landeswahlleitungen wurde ersichtlich, dass eine Standardliteratur faktisch nicht vorhanden ist.30 Mitunter wird das geringe wissenschaftliche Interesse darauf zurückgeführt, dass bisherige Wahlsysteme mit geschlossenen Listen der Forschung nur wenige Analysemöglichkeiten boten. Dies wird mit der Hoffnung auf eine Änderung der Situation nach ersten Erfahrungen mit dem neuen System verbunden.31 Gleichwohl hat sich auch nach der Einführung von Kumulieren und Panaschieren in verschiedenen Bundesländern seit Ende der achtziger Jahre an der Gesamtsituation wenig geändert.
Erst vor dem Hintergrund zahlreicher bürgerschaftlicher Aktivitäten32 und den Veränderungen des Wahlrechts in Hamburg, wurde ein gewisses wissenschaftliches Interesse an der Problematik generiert. Jedoch stellte sich trotz der langjährigen Debatte selbst hier ein Zeitverzug ein.33 Kumulieren und Panaschieren bleibt somit weiterhin ein Randthema. Da es sich hier um ein nunmehr in vierzehn Bundesländern in verschiedenen Varianten angewandtes Stimmgebungssystem handelt, welches als Element des Wahlrechts einen nicht unbedeutenden Teil des Kerns unserer Demokratie darstellt, muss dies als großer Mangel begriffen und kritisiert werden.
In der bisherigen Forschung erreichten vornehmlich Publikationen von Hans-Georg Wehling insbesondere in Bezug auf die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg34 sowie die Stuttgart-Studie von Oscar W. Gabriel35 überregionale Bedeutung. Während Wehling dem System ausnehmend positiv gegenübersteht und dessen positive Auswirkungen hervorhebt, stellt Andreas Henke in der Stuttgart-Studie von Oscar W. Gabriel insbesondere ein Bedürfnis des Wählers fest, auf die personelle Besetzung von gewählten Organen Einfluss zu nehmen.
In der allgemeinen Diskussion um das Wahlrecht und den Parteienstaat wurde das Thema Kumulieren und Panaschieren aber auch von einschlägigen Autoren wie Hans Herbert von Arnim36 oder Ulrich von Alemann37 immer wieder partiell behandelt. In den letzten Jahren kamen wichtige Beiträge wie die Untersuchung zum neuen hessischen Kommunalwahlrecht von Thomas Gremmels38, sowie institutionelle Studien und Evaluationen zum Wahlverhalten in Rheinland-Pfalz39 und Hamburg40 hinzu. Während die Studien hier sehr unterschiedlich ausfallen, ist bei Gremmels in der Untersuchung der Folgen der Einführung von Kumulieren und Panaschieren in Hessen besonders eine kritische Auseinandersetzung mit der dortigen Variante des Systems speziell den Heilungsvorschriften und Panaschieren zu finden.
Auf Seiten des bürgerschaftlichen Engagements machte sich der Verein Mehr Demokratie e.V. bzw. Klaus Hofmann mit einer allgemeinen Studie zu Kumulieren und Panaschieren41 sowie einer Analyse der Auswirkungen dieses Wahlrechts in Brandenburg42 einen Namen. Angesichts dieser ersten aufbauenden Signale erscheint eine weitere positive Fortentwicklung der Forschungslage insbesondere nach den Kompromissen bzw. Änderungen zum Wahlrecht in Bremen und Hamburg als wahrscheinlich.
1.5. Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit
Die Betrachtung des Stimmgebungssystems Kumulieren und Panaschieren beginnt mit einer konzentrierten Darstellung der Funktionsweise dieses Wahlrechts. Dieser erste Teil soll ein Grundverständnis für die in der Folge vorzunehmenden weiteren Analyseschritte liefern.
Diesen Erläuterungen schließt sich eine Charakteristisierung der sich aus dem Grundgesetz ergebenden Aufgaben einer Wahl an. Zunächst erfolgt hier eine Thematisierung der aus der Verfassung vorgegebenen Wahlrechtsgrundsätze. Nachfolgend werden weitere Leistungsanforderungen an Wahlsysteme entwickelt. Dieses dient gleichzeitig zur Ausbildung von Bewertungsmaßstäben, um die Grundlage für eine weitergehende Untersuchung zu schaffen. Das Stimmgebungssystems Kumulieren und Panaschieren soll direkt im Anschluss des jeweiligen Abschnittes diesen Kriterien untergeordnet und anhand der entwickelten Parameter einer Beurteilung unterzogen werden.
In engem Zusammenhang mit den demokratiepolitischen Auswirkungen des Wahlrechts steht eine Analyse aller am politischen Prozess beteiligten Gruppen. Hier kann zudem auf zahlreiche aus der öffentlichen Diskussion bekannte Fragestellungen eingegangen werden. In diesem Kapitel soll weiterhin überprüft werden, inwieweit Kumulieren und Panaschieren ein Mittel gegen Politikverdrossenheit sein kann.
Anschließend wird in einem kurzen Exkurs die Möglichkeit einer Einführung von Kumulieren und Panaschieren auf Landes- und Bundesebene in einem eigenen Kapitel einer genaueren Untersuchung unterzogen.
Am Ende der Arbeit werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst und unter Hinzuziehung aller hier beschriebenen Faktoren einer abschließenden Betrachtung zugeführt, in welcher eingehende Antworten auf die verschiedenen Ausgangsfragen gefunden sowie die oben aufgestellte Hypothese überprüft werden soll. Als Grundgerüst im Zuge der Analyse soll die eingangs formulierte erkenntnisleitende Fragestellung dienen, auf welche am Ende der jeweiligen Kapitel in einem Zwischenfazit entsprechend eingegangen werden soll.
In einer Analyse der Wahlrechtsdiskussion sowie der Parteienproblematik wäre es möglich, zu einer Vielzahl der Aspekte dieser Zeit einzelne Ausarbeitungen zu verfassen. Diese Arbeit soll jene zwar aufgreifen, den Schwerpunkt jedoch auf die bereits genannten Betrachtungen legen. Eine weitergehende Erörterung von Themen wie Parteienstaat oder anderer möglicher Wahlsysteme bzw. direktdemokratischer Elemente würde jedoch die Grenzen dieser Ausarbeitung überschreiten.
Die hier erstellte Arbeit beinhaltet keine empirische oder quantitative Betrachtung sondern beschränkt sich auf eine qualitative Textanalyse der bisherigen Sekundärliteratur und Erfahrungsberichte. Um die sehr eingeschränkte Literaturlage zu verbessern, wurden zudem die Innenministerien der sechszehn deutschen Bundesländer, bürgerschaftliche Initiativen für mehr Demokratie sowie politikwissenschaftliche Autoren auf elektronischem Wege angeschrieben und um Erfahrungsberichte gebeten.43
2. Stimmgebungssystem Kumulieren und Panaschieren
2.1. Verhältniswahlrecht mit Personenbezug
Kumulieren und Panaschieren ist nicht nur ein an sich komplexes Wahlrecht, die Regelungen dafür gehen auch in den verschiedenen Bundesländern weit auseinander. Im Folgenden wird der Versuch unternommen, die Bestimmungen zu generalisieren und dabei dennoch auf wichtige Abweichungen einzelner Länder einzugehen. Eine umfassende Darstellung aller Detailregelungen würde jedoch über die Themensetzung dieser Arbeit hinausgehen. Ein ausführlicher Blick auf die einzelnen Wahlsysteme kann durch die Ansicht einer tabellarischen Übersicht in der Anlage erfolgen.
2.1.1 Klassifizierung
Kumulieren und Panaschieren ist nicht als ein eigenständiges Wahlsystem zu begreifen, sondern muss als Variante des Verhältnisrechts eingeordnet werden44 und wird folglich im weiteren Verlauf dieser Betrachtung mit der Verhältniswahl mit geschlossenen Listen zu vergleichen sein. Bei einer Verhältniswahl werden die zu besetzenden Wahlämter auf Grundlage der auf den Wahlvorschlag abgegebenen Stimmen vergeben.45 Ziel dieses Wahlsystems ist es eine möglichst genaue Abbildung des Wählerwillens in den zu besetzenden Parlamenten oder Vertretungen zu erreichen.46
Mit Kumulieren und Panaschieren kommt innerhalb der Verhältniswahl ein besonderes Stimmgebungsverfahren zur Anwendung. Dieses legt fest wie und wie viele Stimmen der Wähler vergeben darf und ob eine Mehrstimmgebung möglich ist.47
Durch diese Differenzierungen werden Elemente der Personenwahl in das Verhältniswahlrecht aufgenommen. Die Wahl erfolgt dabei mit offenen Listen wodurch es den Wählern möglich ist ihre eigenen Auffassungen über die personelle Zusammensetzung von Parlamenten oder Vertretungen zu artikulieren.48
2.1.2. Element der repräsentativen oder direkten Demokratie?
Um das Instrument Kumulieren und Panaschieren genauer verstehen und dessen demokratiepolitische Auswirkungen einschätzen zu können, lässt eine demokratietheoretische Einordnung als sinnvoll erscheinen. Hierbei bietet sich eine Systematisierung nach den Begriffen der repräsentativen oder direkten Demokratie an.
So beschreibt u.a. Jörg Bogumil direkte Demokratie als Form der Entscheidungsfindung in Sach- oder Personalfragen, welche der Bürger direkt selbst vollziehen kann, wobei er hier die Umgehung der gewählten Repräsentanten als besonders wichtig ansieht. Repräsentative Demokratie bezieht er hier vornehmlich auf gewählte Vertreter,49 die im Auftrage der Wähler handeln.
Nach diesem Kriterium müsste man Kumulieren und Panaschieren der direkten Demokratie zurechnen, da die Form der Personenwahl eben dieser Demokratieform zuzuordnen wäre. Bogumil übersieht hier allerdings den immer noch großen Einfluss der Parteien bei der Aufstellung der Kandidaten. Bei Kumulieren und Panaschieren hat der Wähler eben keinen Einfluss auf das Nominierungsverfahren.
Genau dies kritisiert Timon Gremmels indem er Kumulieren und Panaschieren als Ä (...)lediglich über den Wahlakt hinausgehende Einflussnahme auf die Auswahl der Gemeindevertreter durch die Wähler(...)" bezeichnet. Er stellt hier insbesondere auf das Wesen der Verhältniswahl ab, welches auch dem Kumulieren und Panaschieren immer noch zu Grunde liegt und nach dieser Ansicht dem Grundcharakter der direkten Demokratie entgegenläuft.50
Zudem kann man gegen Bogumils Verständnis grundsätzlich einwenden, dass direkte Demokratie erst dort wirklich beginnen kann, wo der Wähler selbst Entscheidungen der Legislative übernimmt, wie dies bei Volksabstimmungen der Fall ist. Direktwahlen diesem Bereich zuordnen zu wollen, kann sich hier nur als schwierig erweisen.
Das Wahlrecht Kumulieren und Panaschieren ist somit ein Verfahren der repräsentativen Demokratie, welches mit Elementen des Personenwahlrechts angereichert wurde. Dadurch stärkt es die Mitwirkungsmöglichkeiten des Bürgers und schränkt die Machtbasis der Parteien und Wählergruppierungen ein. Dennoch bleibt das Wesen der repräsentativen Demokratie erhalten, da die gewählten Vertreter von den Wählern mit Macht ausgestattet werden und als Legislative Entscheidungen für das Volk treffen können. Infolgedessen ist das System im weiteren Verlauf dieser Betrachtung mit Modellen repräsentativer Demokratie zu vergleichen.
2.1.3. Funktionsweise des Systems
Bei einer Wahl mit offenen Listen sind auf den Stimmunterlagen die Namen aller Kandidaten einer Liste in der von der vorschlagenden Partei festgelegten Reihenfolge aufgeführt, und der Wähler hat die Möglichkeit, die benannte Reihenfolge der Kandidaten zu ändern.51 In der Regel ist die Gesamtzahl der Kandidaten einer Liste auf die Zahl der Sitze in der Volksvertretung beschränkt. In Ausnahmen ist bei einigen Wahlsystemen eine Nominierung auch über diese Zahl hinaus gestattet.52 Die Veränderungen der Wähler können an dieser Stelle bewirken, dass Bewerber in die Volksvertretung einziehen, welche unter den Bedingungen von geschlossenen Listen nicht zum Zuge gekommen wären und dafür andere keine Berücksichtigung finden.
Die Gesamtzahl der Stimmen, die ein Wähler abgeben darf, richtet sich in den meisten Wahlsystemen ebenfalls nach der Zahl der zu vergebenden Sitze. In den neuen Ländern, in Niedersachsen und Hamburg ist die Stimmenzahl jedoch auf drei bzw. fünf Stimmen beschränkt worden.5354 Zudem wird die Gelegenheit gegeben, nicht genehme Kandidaten zu streichen, welche dann keine Stimmen erhalten.55 Somit wird für den Wähler die Möglichkeit geschaffen, Bewerber einer Partei nicht zu wählen ohne gleich die Parteipräferenz ganz zu wechseln.
In vielen Fällen hat der Wähler zudem die Möglichkeit zur Abgabe einer Listenstimme.56 Dies ist zwar für ein Kumulieren und Panaschieren nicht zwingend erforderlich, soll aber ebenfalls kurz dargestellt werden, da es in fast allen Ländern Anwendung findet und zudem in der Debatte um die Auswirkungen des Systems eine Rolle spielen kann.
Im Falle der Markierung einer Liste (Listenstimme) werden die Stimmen, soweit nicht schon anderweitig verwandt, grundsätzlich auf alle angegebenen Bewerber verteilt und daher erhält hier jeder Kandidat eine Stimme. Der Wähler hat so die Option, die Vorschläge einer Partei unverändert anzunehmen. Den Parteien ist es jedoch möglich, weniger Kandidaten als zu vergebende Sitze aufzustellen. Alle Bewerber erhalten dann ebenso innerhalb ihrer Reihenfolge auf dem Stimmzettel Voten, allerdings wird dieser Vorgang bis Ausschöpfung der Gesamtstimmenzahl, unter der Beachtung der Höchstgrenzen des Kumulierens, von Anfang dieser Liste wiederholt.57 Hier ist als logische Folge in Extremfällen auf die Gefahr verlorener Stimmen hinzuweisen, wenn die Zahl der Nominierten ein Drittel der Mandate oder die Zahl der Streichungen durch den Wähler zwei Drittel derselben überschreitet, da dann nicht alle Stimmen verbraucht werden können.
Parteien und Wählergruppierungen haben in einigen Bundesländern wie z.B. Rheinland-Pfalz zudem die Möglichkeit Bewerber bis zu drei Mal auf der Wahlliste zu platzieren.58 Damit wird an dieser Stelle den Parteien ein Mittel an die Hand gegeben, Personen die ihnen besonders wichtig sind hervorzuheben, welche dann über die Listenstimme mehr Voten erhalten. Dieses Verfahren wird auch Vorkumulieren genannt und uns in der späteren Erörterung noch beschäftigen.
2.1.3.1. Kumulieren von Wählerstimmen
Der Begriff ,Kumulieren' bedeutet soviel wie häufeln und lässt sich von der lateinischen Vokabel cumulus (Haufen) herleiten. In der Praxis des Wahlrechts versteht man darunter die Möglichkeit, in personalisierten Mehrstimmenwahlsystemen mehrere Stimmen auf einen Kandidaten konzentrieren zu können. Hierbei hat der Wähler in der Regel Gelegenheit, einzelne Bewerber mit bis zu drei Stimmen zu bedenken.59 Dadurch kann er bei der Wahl noch intensiveren Einfluss auf die Reihenfolge der Wahlvorschläge innerhalb der Liste nehmen. Die Verwendung einer Listenstimme bewirkt hier, dass abzüglich der bereits verwandten bzw. kumulierten Stimmen, die noch übrigen Voten auf die anderen Kandidaten nach den bereits erläuterten Regeln verteilt werden.60
2.1.3.2. Panaschieren von Wählerstimmen
Der Begriff ,Panaschieren' leitet sich hingegen vom französischen Wort panacher (mischen) ab und bedeutet, dass der Wähler in den genannten Systemen seine Stimmen auf einzelne Kandidaten unterschiedlicher Listen verteilen kann. Dadurch kann er Personen unterschiedlicher Parteien auswählen, die ihm besonders geeignet erscheinen.61 In Verbindung mit der Listenstimme ist es zudem möglich, einzelnen Kandidaten in anderen Listen Stimmen zuzuteilen, während die verbleibenden Stimmen durch die Listenstimme auf die ausgewählte Wahlliste verteilt werden.62
Panaschieren ist grundsätzlich nur bei völlig offenen Listen möglich, während bei lose gebundenen Listen nur Veränderungen innerhalb der präferierten Liste möglich sind.
Insbesondere in Rheinland-Pfalz63 sowie in Hessen64 ist es möglich in Kommunen über 5000 Einwohner bzw. bei Kreistagswahlen einzelne Wahlbereiche mit eigenen Listen zu bilden. Hintergrund dieser bislang kaum praktisch angewandten Regelungen ist die Befürchtung, dass ganze Bereiche eines größeren Wahlgebietes bei Einsatz des neuen Wahlrechtes in den Vertretungen keine Repräsentation mehr finden.
Nach Abschluss beider Verfahren werden die Mandate nach den insgesamt auf einen Wahlvorschlag entfallenen Stimmen aufgeteilt. Die Verteilung erfolgt jedoch nicht in der Reihenfolge der entsprechenden Wahlliste, sondern wird aufgrund der durch die einzelnen Bewerber erreichten Anzahl der Stimmen vergeben.65
2.1.3.3. Heilungsvorschriften
Insbesondere in Hessen und Rheinland-Pfalz gibt es zahlreiche Heilungsmöglichkeiten für nicht vollständig korrekt ausgefüllte Stimmzettel. Ziel ist es, möglichst viele Stimmen der Wähler zu realisieren, und ungültige Stimmen entsprechend zu vermeiden.
So führt beim alleinigen Kumulieren bei gleichzeitiger Abgabe einer Listenstimme eine Überschreitung der Anzahl der zulässigen Gesamtstimmen nicht automatisch zur Ungültigkeit des Stimmzettels. Hier werden auf der gekennzeichneten Liste von unten nach oben solange Stimmen gestrichen, bis die vorgegebene Grenze wieder eingehalten wird.66 Gibt der Wähler einzelnen Kandidaten mehr als drei Stimmen, so bleiben hier die überzähligen Stimmen unberücksichtigt. Für den Fall eines nicht ausgeschöpften Reststimmenpotentials werden die verbleibenden Stimmen von oben nach unten auf der angekreuzten Liste aufgefüllt (Auffüllregelung). 67
Ungültig ist ein Stimmzettel in diesen Fällen erst dann, wenn mehrere Listenstimmen abgegeben worden sind oder beim Panaschieren zu viele Stimmen vergeben wurden.68
Die genannten Grundsätze sind nicht ganz unbedenklich, da sie einen nicht eindeutigen Wählerwillen auslegen und somit möglicherweise verfälschen. Dies stärkt zudem wiederum die Rolle der Platzierung auf einer Liste, welche durch die Einführung von Kumulieren und Panaschieren eigentlich an Bedeutung verlieren sollte. Allerdings ist das Ziel der Vermeidung von unbewusst abgegebenen ungültigen Stimmen durchaus von Bedeutung, jedoch wäre dies auch ohne die hier beschriebene Auffüllregelung zu erreichen gewesen. Nicht vergebene Stimmen könnte man hier ebenso als bewusste Dokumentation des Wählerwillens beschreiben, zumal diese nicht zur Ungültigkeit des Votums führt.
In anderen Ländern, insbesondere in Baden-Württemberg als einem der Ursprünge von Kumulieren und Panaschieren, sind diese Auslegungs- und Heilungsvorschriften nur in abgeschwächter Form in Kraft. Hier gilt insbesondere die positive Kennzeichnungspflicht, nach der ein Wählerwille eindeutig erkennbar sein muss.69 Diese Vorschrift trägt der zuvor angesprochenen Kritik Rechnung.
2.1.4. Historie des Stimmgebungssystems
Bei Kommunalwahlen ist Kumulieren und Panaschieren mittlerweile eine weit verbreitete Praxis, welcher aber durch das Wahlrecht zum bayrischen Landtag sowie seit dem 24.06.2009 zur Bürgerschaft der Stadt Hamburg zumindest in Teilen den Einzug in die Landesebene gelungen ist.70
Zunächst war Kumulieren und Panaschieren im bundesrepublikanischen Deutschland allerdings nur eine recht begrenzte Erscheinung. Mit Baden-Württemberg und Bayern war im Anfang nur im süddeutschen Raum der Wähler mit den erweiterten Handlungsmöglichkeiten ausgestattet. Erst 1989 folgte das Land Rheinland-Pfalz, und kurz danach wurden bei Bildung der neuen Länder im Osten unserer Republik Kumulieren und Panaschieren in die dortigen Wahlgesetze aufgenommen.71
Offenbar bildete dies, wie auch im Bereich der direktdemokratischen Elemente, einen Schub für eine Wahlrechtsdiskussion. So führte Niedersachsen 1996 eine Variante ein, welches große Ähnlichkeiten mit den ostdeutschen Modellen aufweist.72 In Hessen wurde in der Wahl 2001 ebenfalls ein neues Wahlrecht eingesetzt, welches sich jedoch an den Vorbildern im Südwesten wie z.B. Rheinland-Pfalz orientierte.73
In Bremen konnten nach langen Diskussionen und einem drohenden Volksentscheid 2006 Kumulieren und Panaschieren für die Wahl im Jahre 2011 eingeführt werden.74 In Hamburg wurde durch eine Volksabstimmung im Jahr 2004 ein neues Wahlrecht beschlossen, welches jedoch seitens der CDU-Mehrheit in der dortigen Bürgerschaft noch vor der Wahl 2008 wieder in wesentlichen Teilen eingeschränkt wurde und somit seine Wirkung nicht voll entfalten konnte. Nach langen Verhandlungen mit bürgerschaftlichen Gruppen einigte man sich 2009 auf einen Kompromiss, welcher eine Anwendung in Mehrpersonenwahlkreisen vorsieht.75 Die Einigung wurde durch eine Änderung der Verfassung abgesichert, wonach Wahlrechtsänderungen in Zukunft durch höhere Hürden bei Abstimmungen bedürfen.76
Im Land Schleswig-Holstein gibt es ebenfalls eine lange Debatte zu diesem Thema.77 Bisher wurden ähnliche Regelungen anderer Bundesländer hier nicht in Gänze übernommen, es ergeben sich trotzdem einige interessante Besonderheiten. Zum einen kann hier dem Kandidaten jeweils nur eine Stimme gegeben werden, ein originäres Kumulieren wird somit nicht durchgeführt. Außerdem wird in Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Einpersonenwahlkreisen, unterhalb dieser Schwelle in Mehrpersonenwahlkreisen gewählt.78 Das Land besitzt somit ein sehr differenziertes Wahlrecht, welches auf bestimmte Strukturen Rücksicht nimmt.
2.2. Zwischenfazit
In der bisherigen Erörterung konnten wichtige Erkenntnisse für die weitere Ausarbeitung der Thematik gewonnen werden. So was es möglich, das Stimmgebungssystem Kumulieren und Panaschieren als Teil des Verhältniswahlrechts mit Personenbezug sowie als Bestandteil der repräsentativen Demokratie zu klassifizieren.
Durch einen Blick auf die Funktionsweisen des Systems konnte eine wichtige Grundlage für die folgende Beurteilung geschaffen werden. Kumulieren und Panaschieren gewährt dem Wähler ein hohes Maß an Einfluss auf die Zusammensetzung der Volksvertretung, stellt aber gleichzeitig hohe Anforderungen an den Wähler selbst.
Gleichzeitig konnte dargelegt werden, dass in den einzelnen Ländern eine größere Anzahl von Variationen existiert, deren Besonderheiten nicht immer frei von Problematiken sind. So war es möglich im Bereich der Listenstimme, des möglichen Vorkumulierens, sowie in Form der Heilungsvorschriften weitere Ansatzpunkte für eine Untersuchung zu ermitteln, welche in einem späteren Teil dieser Betrachtung einer genaueren demokratiepolitischen Analyse unterzogen werden müssen.
3. Analyse des Stimmgebungssystems Kumulieren und Panaschieren
3.1. Das Grundgesetz und seine diesbezüglichen Verfassungsbestimmungen
Bei der Entstehung des Grundgesetzes fand der Parlamentarische Rat in der Frage des Wahlrechts keine gemeinsame Lösung.79 Somit hat eine genaue Regelung keinen Eingang in die deutsche Verfassung gefunden, sondern das Bundeswahlgesetz normiert die Details des deutschen Wahlrechts. Allerdings wurden demokratische Grundsätze als Fundament für die Durchführung von Wahlen in das Grundgesetz aufgenommen.80
Neben diesen Grundsätzen der Verfassung wurden aber durch die Wissenschaft bestimmte normative Maßstäbe entwickelt, welche Leistungsanforderungen an Wahlsysteme beschreiben. Beide Bereiche sollen hier nun kurz vorgestellt werden.
Um in der Folge eine Bewertung des Kumulierens und Panaschierens vollziehen und einen Vergleich mit anderen in Deutschland üblichen Wahlsystemen mit geschlossenen Listen durchführen zu können, ist es notwendig, die beschriebene Funktionsweise des Systems eben diesen Bewertungsmaßstäben unterzuordnen und zu untersuchen, ob Kumulieren und Panaschieren in der Lage ist, hier bessere Resultate erzielen, als Verhältniswahlsysteme mit geschlossenen Listen.
3.1.1. Vereinbarkeit mit Wahlrechtsgrundsätzen
Das Grundgesetz gibt für Wahlen im Bund, Ländern und Kommunen wichtige Regeln vor, an denen sich jedes Wahlrecht messen lassen muss, und die es einzuhalten gilt.
So müssen Wahlen nach Art. 38 I 1 GG verpflichtend allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim sein.81 Um als Grundlage für den demokratischen und föderativen Staat eine gewisse Homogenität verfassungsrechtlicher Grundbegriffe im Bundesgebiet zu erreichen, wurde in Art. 28 I 2 GG auch den Bundesländern die Beachtung dieser Prinzipien auferlegt. Dennoch lässt diese Regelung den Bundesländern einen großen Spielraum bei der Ausgestaltung ihres Wahlrechts.82
Gerade dieser letzte Punkt bildet die Basis für mögliche Wahlrechtsänderungen wie z.B. die Einführung von Kumulieren und Panaschieren, soweit sie mit diesen demokratischen Grundsätzen in Einklang stehen. Daher gilt zu untersuchen inwieweit diese Grundsätze gleichermaßen oder sogar weitergehender eingehalten werden, als innerhalb der Verhältniswahlsysteme mit geschlossenen Listen.
3.1.1.1. Die allgemeine Wahl
Eine Wahl kann als allgemein bezeichnet werden, wenn an ihr grundsätzlich Staatsbürger mit aktivem und passivem Stimmrecht teilnehmen können, ohne Ansehen des Besitzes, des Geschlechtes, der Herkunft, der Sprache, der Religion, oder der politischen Überzeugung. Beschränkungen sind nur aufgrund gesetzlicher Regelung bezüglich Mindestalter, Wohnsitz, des Verlusts der bürgerlichen Ehrenrechte durch Gerichtsurteil sowie der geistigen Zurechungsfähigkeit des Betroffenen möglich.83 Ähnlich wie das Gebot der gleichen Wahl nahm dieser Grundsatz seinen Ursprung in der Gleichheitsidee der Französischen Revolution, entwickelte sich jedoch zu einer eigenständigen Norm.
Problematisieren könnte man im Zusammenhang von Wahlrechtsdiskussionen, inwieweit das passive Wahlrecht durch die Einführung eines Unterschriftenquorums bei der Bewerbung unabhängiger Kandidaten oder eine Beschränkung des Wahlvorschlagsrechts auf Parteien und organisierte Wählergruppen diesem Grundsatz widerspricht.84
Der Grundsatz der allgemeinen Wahl setzt am Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu einem Wahlgang an. Das Stimmgebungsverfahren Kumulieren und Panaschieren nimmt aber keinerlei zusätzlichen Einfluss auf den Zugang zu einer Wahl, sondern verändert nur die Stimmgebung und somit die Anzahl der Stimmen, die Wählerinnen und Wählern zur Verfügung stehen.85
Die angesprochenen Problematiken im Rahmen eines Unterschriftenquorums bei der Bewerbung unabhängiger Kandidaten oder einer Beschränkung des Wahlvorschlagsrechts auf Parteien und organisierte Wählergruppen ist nicht zwingend mit diesem Stimmgebungssystem zu verbinden. Dieses hätte ebenso wie in anderen Systemen letztendlich das Ziel, die ,, Ernsthaftigkeit des Wahlvorschlages"86 zu überprüfen und könnte je nach Interesse auch anders geregelt werden.
Somit kann festgestellt werden, dass Kumulieren und Panaschieren unter gegebenen Voraussetzungen die allgemeine Wahl in gleicher Weise gewährleistet wie Verhältniswahlsysteme mit geschlossenen Listen.
3.1.1.2. Die unmittelbare Wahl
Unmittelbar ist eine Wahl dann, wenn die Abgabe des Votums durch den Wähler selbst, ohne Zwischeninstanz, also somit direkt erfolgt.87
Wurde die Verhältniswahl in früheren Zeiten mitunter als Verstoß gegen das Prinzip der unmittelbaren Wahl angesehen, da eine Bestimmung von Abgeordneten nur über das Verhältnis der Stärke des Parteiwahlergebnisses erfolgt, so wird die Einhaltung des Grundsatzes durch dieses System heute meist nicht mehr bestritten.88
Da Kumulieren und Panaschieren keinerlei Zwischengremien wie zum Beispiel Wahlmännerinstitutionen vorsieht oder ähnliche Einflussmöglichkeiten beinhaltet,89 wird der Grundsatz der unmittelbaren Wahl nicht in negativer Weise berührt.
[...]
1 Vgl. Herzog, Roman: Fünfzig Jahre Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, S. 345.
2 Vgl. Alemann, Ulrich von: Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland, S. 182f.
3 Vgl. Weizsäcker, Richard von: Unterrichtung durch den Bundespräsidenten. Empfehlungen der Kommission unabhängiger Sachverständiger zur Parteienfinanzierung, S. 52.
4 Vgl. Alemann, Ulrich von: Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland, S. 188.
5 Vgl. Arnim, Hans Herbert von: Volksparteien ohne Volk, S. 359ff.
6 Vgl. Hesselberger, Dieter: Das Grundgesetz, S. 171ff.
7 Vgl. ebenda.
8 Auf Landesebene ist dies in vielen Bereichen eine langjährige Praxis, welche in zahlreichen Bundesländern noch in den letzten Jahren noch
9 Vgl. Hesselberger, Dieter: Das Grundgesetz, S. 227, 229f.
10 Vgl. Wehling, Hans-Georg: Vom Kumulieren und Panaschieren., S. 6.
11 Vgl. Arnim, Hans Herbert von: Das System, S. 342f.
12 Vgl. Ebenda.
13 Vgl. Herzog, Roman: ebenda.
14 Vgl. Hesselberger, Dieter: Das Grundgesetz, S. 191.
15 Vgl. Lösche, Peter: Das Parteiensystem und die Herausforderungen direkter Demokratie, S. 46.
16 Vgl. Hesselberger, Dieter: ebenda.
17 An dieser Stelle sei auf mutmaßlich sichere Wahlkreise und Listenplätze hingewiesen; Vgl. Arnim, Hans Herbert von: Wahl ohne Auswahl, S. 115.
18 Vgl. Hesselberger, Dieter: ebenda, S. 171.
19 Als Beispiele seien Nichtregierungsorganisationen, Soziale Bewegungen und Differenzierungen im Dienstleistungs- und Freizeitbereich genannt.
20 Vgl. Lösche, Peter: Das Parteiensystem und die Herausforderungen direkter Demokratie, S. 47f.
21 Vgl. Jesse, Eckard: Wahlrecht zwischen Kontinuität und Reform, S. 15.
22 Vgl. Knemeyer, Franz-Ludwig: Bürgerbegehren und Bürgerentscheid, S. 80f.
23 Vgl. Ebenda, S. 81.
24 Vgl. Rotberg, Konrad Freiherr von: Das Kommunalwahlrecht in Baden-Württemberg, S. 28.
25 Vgl. Wehling, Hans-Georg: Vom Kumulieren und Panaschieren, S. 6.
26 Vgl. Arnim, Hans Herbert von: Volksparteien ohne Volk, S. 73ff.
27 Vgl. Jesse, Eckhard: Reformvorschläge zur Änderung des Wahlrechts, S. 11.
28 Vgl. Landtag Nordrhein-Westfalen: Ausschussprotokoll, S. 5ff.
29 Vgl. Jesse, Eckard: Wahlrecht zwischen Kontinuität und Reform, S. 24ff.
30 Vgl. S. 104ff. Hier sei beispielhaft auf die in der Anlage befindliche Emailkorrespondenz verwiesen.
31 Vgl. Gremmels, Timo: Kumulieren und Panaschieren - Das hessische Kommunalwahlrecht in Theorie und Praxis, S. 11.
32 Vgl. www.mehr-demokratie.de (Abgerufen am 22.09.2009, 17:01 MEZ).
33 Vgl. Jakobeit, Cord; Hiller, Philipp; Thomsen, Nils, Fröhlich, Louisa: Hamburger Wahlrecht bei der Bürgerschaftswahl 2008. S. 4.
34 Vgl. Wehling, Hans-Georg: Vom Kumulieren und Panaschieren.
35 Vgl. Henke, Andreas: Kumulieren und Panaschieren, S. 169ff.
36 Vgl. Arnim, Hans Herbert von: Das System, S. 343f.
37 Vgl. Alemann, Ulrich von: Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland.
38 Vgl. Gremmels, Timo: Kumulieren und Panaschieren - Das hessische Kommunalwahlrecht in Theorie und Praxis.
39 Vgl. Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz am 13. Juni 2004.
40 Vgl. Jakobeit, Cord; Hiller, Philipp; Thomsen, Nils, Fröhlich, Louisa: Hamburger Wahlrecht bei der Bürgerschaftswahl 2008.
41 Vgl. Hofmann, Klaus; Slonka, Alexander; Wolf, Stefan: Wahlrecht und Gewählte.
42 Vgl. Hofmann, Klaus: Die Auswirkungen des Wahlrechts in Brandenburg auf die Zusammensetzung der Städte- und Gemeindeparlamente am Beispiel der brandenburgischen Kommunalwahl 2008.
43 Vgl. als Beispiel Anlage 1, S. 104 und Anlage 2, Seite 105.
44 Vgl. Schweinsberg, Klaus: Demokratiereform, S. 232.
45 Vgl. Bönninger, Karl: Kommunalwahlrecht in den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, S. 14.
46 Vgl. Schweinsberg, Klaus: ebenda.
47 Vgl. Falter, Jürgen W.; Schoen, Harald (Hrsg.): Handbuch Wahlforschung, S. 578.
48 Vgl. Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz am 13. Juni 2004, S. 9.
49 Vgl. Bogumil, Jörg; Holtkamp Lars: Die Bürgerkommune als Zusammenspiel von repäsentativer und kooperativer Demokratie, S. 4.
50 Vgl. Gremmels, Timo: Kumulieren und Panaschieren - Das hessische Kommunalwahlrecht in Theorie und Praxis., S. 28.
51 Vgl. Hübner, Emil: Wahlsysteme und mögliche Auswirkungen unter spezieller Berücksichtigung der Bundesrepublik Deutschland, S. 24.
52 Vgl. Mann, Hans-Joachim: Das kommunale Wahlsystem in Baden-Württemberg, S. 2.
53 Vgl. Korte, Karl-Rudolf: Wahlen in Nordrhein-Westfalen, S. 21.
54 Vgl. Sollte nur ein Wahlvorschlag eingereicht worden sein, so findet als Ausnahme eine Mehrheitswahl statt. Im Falle von ausbleibenden Vorschlägen für die Wahl ist es meist möglich, jede wählbare Person mit einer Stimme zu bedenken, wobei dann das Kumulieren entfällt.54 Frech, Siegfried: Das Kommunalwahlsystem, S. 198.
55 Vgl. Steenbock, Reimer: Das Kommunalwahlrecht in Rheinland-Pfalz, S. 41.
56 Vgl. Gremmels, Timo: Kumulieren und Panaschieren - Das hessische Kommunalwahlrecht in Theorie und Praxis, S. 20.
57 Vgl. Hessisches Statistisches Landesamt: Die Kommunalwahlen vom 18.03.01, S. 6.
58 Vgl. Gremmels, Timo: ebenda, S. 21.
59 Vgl. Korte, Karl-Rudolf: Wahlen in Nordrhein-Westfalen, S. 22.
60 Vgl. Hessisches Statistisches Landesamt: ebenda.
61 Vgl. Korte, Karl-Rudolf: ebenda.
62 Vgl. Hessisches Statistisches Landesamt: ebenda.
63 Vgl. Steenbock, Reimer: Das Kommunalwahlrecht in Rheinland-Pfalz, S. 42.
64 Vgl. Hessisches Statistisches Landesamt: ebenda, S. 7.
65 Vgl. Mann, Hans-Joachim: Das kommunale Wahlsystem in Baden-Württemberg, S. 5f.
66 Vgl. Gremmels, Timo: ebenda , S. 22f.
67 Vgl. Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz am 13. Juni 2004, S. 11.
68 Vgl. Steenbock, Reimer: Das Kommunalwahlrecht in Rheinland-Pfalz, S. 41.
69 Vgl. Mann, Hans-Joachim: ebenda, S. 4.
70 Vgl. http://hh.mehr-demokratie.de (Abgerufen am 11.09.2009, 00:07 MEZ).
71 Vgl. Jakobeit, Cord; Hiller, Philipp; Thomsen, Nils, Fröhlich, Louisa: Hamburger Wahlrecht bei der Bürgerschaftswahl 2008, S. 7.
72 Vgl. Roth, Dieter: Empirische Wahlforschung, S. 208.
73 Vgl. Gremmels, Timo: ebenda, S. 14f.
74 Vgl. http://www.bremen.neues-wahlrecht.de/1757.html (Abgerufen am 11.09.2009, 11:09 MEZ).
75 Vgl. http://www.abendblatt.de/hamburg/article1047933/Jahrelanger-Streit-um-Wahlrecht-beendet.html (Abgerufen am 11.09.2009, 11:09 MEZ).
76 Vgl. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg: Antrag zum 12. Gesetz zur Änderung der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg.
77 Vgl. Lorenz-von-Stein-Institut (Hrsg.): Neues kommunales Wahlrecht in Schleswig-Holstein?.
78 Vgl. Korte, Karl-Rudolf: Wahlen in Nordrhein-Westfalen, S. 22.
79 Vgl. Roth, Dieter: Empirische Wahlforschung. S. 198.
80 Vgl. Gerlach, Irene: Bundesrepublik Deutschland: Entwicklungen, Strukturen und Akteure eines politischen Systems,, S. 237f.
81 Vgl. Gerlach, Irene: ebenda, S. 242.
82 Vgl. Siemer, Sebastian: Das Landtagswahlrecht in der Kritik, unterschiedliche Wahlkreisgrößen, offene Listen? S. 5.
83 Vgl. Hesselberger, Dieter: Das Grundgesetz, S. 233.
84 Vgl. Unterpaul, Klaus: Die Grundsätze des Landeswahlrechts nach der Bayrischen Verfassung im Lichte der Entwicklung 1946-1989, S. 147f. und S. 150f.
85 Vgl. Seite 23f. dieser Ausarbeitung.
86 Vgl. Unterpaul, Klaus: Die Grundsätze des Landeswahlrechts nach der Bayrischen Verfassung im Lichte der Entwicklung 1946-1989, S. 147f.
87 Vgl. Roth, Dieter: Empirische Wahlforschung. S. 194.
88 Vgl. Unterpaul, Klaus: ebenda, S. 222.
89 Vgl. Seite 16f. dieser Ausarbeitung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeuten die Begriffe Kumulieren und Panaschieren?
Kumulieren erlaubt dem Wähler, einem Kandidaten mehrere Stimmen zu geben; Panaschieren ermöglicht das Verteilen von Stimmen auf Kandidaten verschiedener Listen.
Können diese Wahlsysteme Politikverdrossenheit mindern?
Befürworter argumentieren, dass Bürger durch mehr direkten Einfluss auf die personelle Besetzung der Gremien stärker am Staat beteiligt werden.
Wo werden Kumulieren und Panaschieren in Deutschland bereits angewandt?
Auf kommunaler Ebene ist dies in süddeutschen Bundesländern jahrzehntelange Praxis und wurde mittlerweile in fast allen anderen Ländern eingeführt.
Welche verfassungsrechtlichen Anforderungen müssen Wahlsysteme erfüllen?
Wahlen müssen laut Grundgesetz allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim sein.
Wird eine Einführung auf Bundesebene diskutiert?
Ja, die Arbeit untersucht, ob die positiven Erfahrungen auf kommunaler Ebene eine Einführung auch bei Landtags- oder Bundestagswahlen rechtfertigen.
- Citation du texte
- Christian Prahl (Auteur), 2009, Kumulieren und Panaschieren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144158