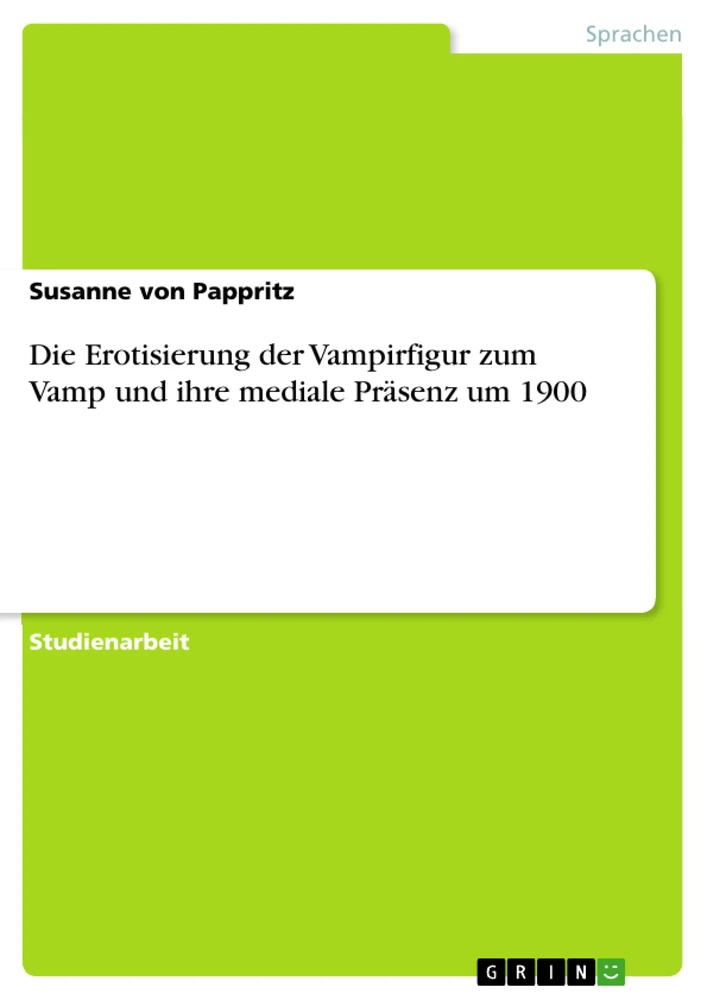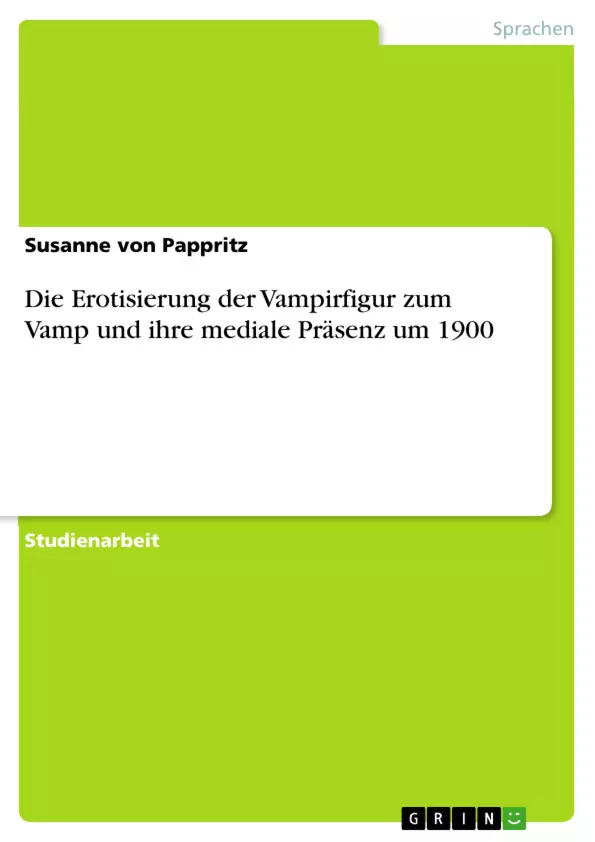Fragen nach der Realität von blutsaugenden Vampiren, die des Nachts auf Beutefang gehen, gehören seit jeher zu vielen Kulturen menschlichen Seins. Sei es der griechische „borborlakos“, indische „baital“, russische „upiry“, chinesische „giang shi“ oder der deutsche „Blutsauger“ – die Faszination um dunkle Geschöpfe der Nacht reißt nicht ab und führte zur Implementierung der Vampirfigur in immer mehr mediale Darstellungsformen und Darstellungsvarianten. Dabei lässt sich eine zunehmende Verflechtung von Fiktion und vermeintlicher Realität, d. h. dem historischen Kern des Mythos, feststellen bis hin zur absoluten Neugeburt des Vampirs als künstliches Kultobjekt, das nur noch wenig mit den Legenden von blutsaugenden Untoten zu tun hat. Damit verbunden ist nicht nur eine Verlagerung von der Darstellung der Vampirfigur als schreck- und angsteinflößendes Ungetüm zum medialen komplexen Kulturträger, sondern auch zum männermordenden Vamp.
Dieser Erotisierungsprozess der Vampirfigur zum Vamp, der sich ungefähr um die Wende zum 20. Jahrhundert medial besonders stark ausprägte, soll Thema dieser Arbeit sein und somit den Schwerpunkt der nachfolgenden Ausführungen bilden. Dabei wird untersucht werden, wie sich der Begriff Vamp gegenüber dem regulären Vampirbegriff etabliert hat und welche Rolle dabei die Erotisierung der ursprünglichen Vampirgestalt spielt. Das Heranziehen dreier medialer Formate soll dabei eine möglichst komplexe Beleuchtung dieses Phänomens gewährleisten, so dass die Wahl auf drei verschiedene um 1900 entstandene Stoffe aus Bildender Kunst, Literatur und Film fiel, um die vorangehende Darstellung der Begriffsbedeutung und Genese des Vamps beispielhaft zu belegen. Ziel soll es sein, die Rollenfunktion des Vamps offenzulegen, Parallelen, aber vor allem auch Unterschiede zu älteren Vampirauffassungen ausfindig zu machen, um prototypische Wesensmerkmale der Vampgestalt herauszustellen.
In ihrem Facettenreichtum mit dem Schwerpunkt auf der erotischen Komponente soll so die feminine Vampirfigur betrachtet werden, um die Verlagerung hin zum Weiblichen verständlicher werden zu lassen; gerade dort, wo tradierte Vampirauffassungen vom blutsaugenden Wiedergänger zu Gunsten eines neuen Vampirverständnisses verlassen werden und man als Zuschauer, Leser oder Betrachter fremdes Terrain betritt.
Inhaltsverzeichnis
- Begründung der Thematik
- Vampire und Vamps - Begrifflichkeit und Genese
- Vamps in den Medien Literatur, Film und Bildender Kunst
- Die medial-übergreifende Aufnahme des Vamps
- Zu Bram Stokers „Dracula\" (1897)
- Zu Frank Powells „A Fool There Was\" (1915)
- Zu Edvard Munchs „Vampir“ (1893)
- Rückschlüsse auf die Beschaffenheit eines prototypischen Vamps
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Vampirfigur zum Vamp, einem erotischen und weiblichen Pendant des traditionellen Vampirs. Dabei wird die Etablierung des Begriffs „Vamp“ im Kontext der Erotisierung der ursprünglichen Vampirgestalt analysiert. Die Arbeit konzentriert sich auf die Medienlandschaft um 1900, die eine besondere Blütezeit für den Vamp darstellt.
- Die Genese des Begriffs „Vamp“ und seine Abgrenzung zum ursprünglichen Vampirbegriff
- Die Rolle der Erotisierung in der Entwicklung der Vampfigur
- Die mediale Präsenz des Vamps in Literatur, Film und Bildender Kunst
- Die Identifizierung prototypischer Wesensmerkmale der Vampgestalt
- Die feminine Vampirfigur als Projektionsfläche des Weiblichen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Begründung der Thematik
Dieses Kapitel führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt die Faszination um die Vampirfigur in verschiedenen Kulturen. Es wird auf die zunehmende Verflechtung von Fiktion und vermeintlicher Realität sowie die Entwicklung der Vampirfigur zum Vamp hingewiesen, der den Fokus der Arbeit darstellt. Die Arbeit untersucht die Rolle der Erotisierung in dieser Transformation und analysiert die mediale Präsenz des Vamps um 1900.
2. Vampire und Vamps - Begrifflichkeit und Genese
Dieses Kapitel befasst sich mit den Begriffen „Vampir“ und „Vamp“ und ihrer Genese. Es wird die Bedeutung des „Vamp“ im Alltag und in der Medienlandschaft um 1900 erörtert und die Abgrenzung zu den traditionellen Vampirvorstellungen untersucht.
3. Vamps in den Medien Literatur, Film und Bildender Kunst
Dieses Kapitel analysiert die mediale Präsenz des Vamps in verschiedenen Kunstformen. Es werden Beispiele aus Literatur, Film und Bildender Kunst um 1900 untersucht und die Rolle des Vamps in diesen Werken beleuchtet. Das Kapitel analysiert die Darstellung des Vamps, seine Eigenschaften und seine Wirkung auf das Publikum.
3.1 Die medial-übergreifende Aufnahme des Vamps
Dieses Kapitel fokussiert sich auf drei konkrete Beispiele: Bram Stokers „Dracula“ (1897), Frank Powells „A Fool There Was“ (1915) und Edvard Munchs „Vampir“ (1893). Es analysiert die mediale Rezeption des Vamps in diesen Werken und die Entwicklung der Vampirfigur in unterschiedlichen medialen Kontexten.
3.2 Rückschlüsse auf die Beschaffenheit eines prototypischen Vamps
Dieses Kapitel zieht aus den vorherigen Analysen Rückschlüsse auf die Beschaffenheit eines prototypischen Vamps. Es fasst die Merkmale und Eigenschaften zusammen, die den Vamp in der medialen Landschaft um 1900 kennzeichnen. Es beleuchtet die Verlagerung der Vampirfigur vom blutsaugenden Wiedergänger hin zum erotischen und weiblichen Vamp.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung des Vamps als weiblichen Pendant des traditionellen Vampirs, insbesondere mit seiner medialen Präsenz in Literatur, Film und Bildender Kunst um 1900. Zentrale Themen sind die Erotisierung der Vampirfigur, die Verlagerung von einem männlichen zum weiblichen Wesen, die prototypischen Merkmale des Vamps, und die Rolle der Medien in der Gestaltung von Mythen und Symbolen.
- Quote paper
- Susanne von Pappritz (Author), 2007, Die Erotisierung der Vampirfigur zum Vamp und ihre mediale Präsenz um 1900, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1453580