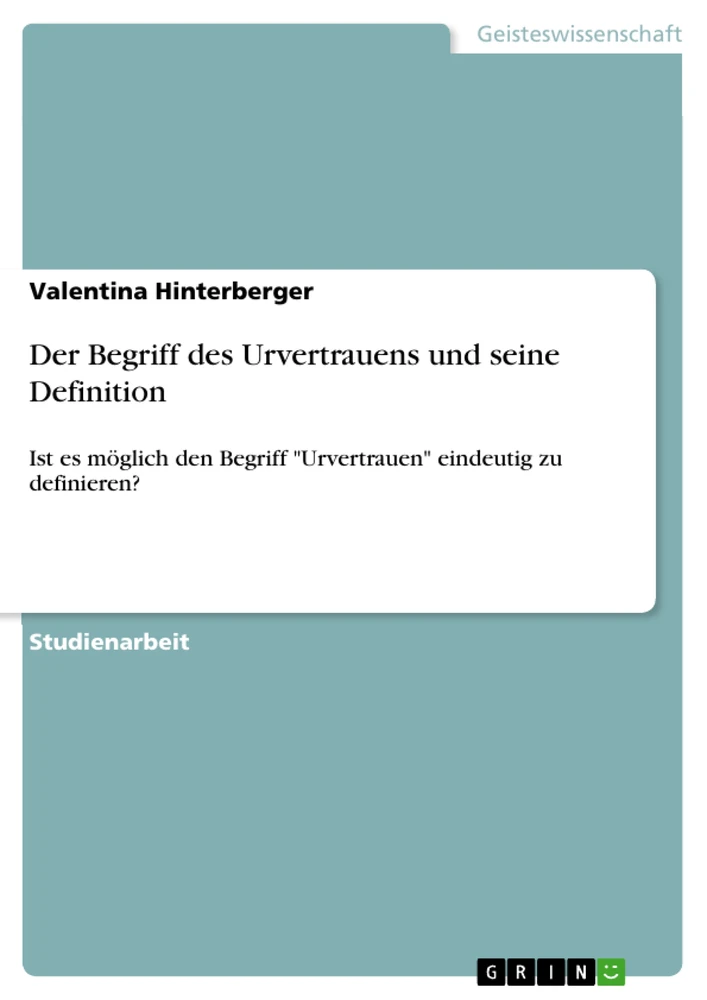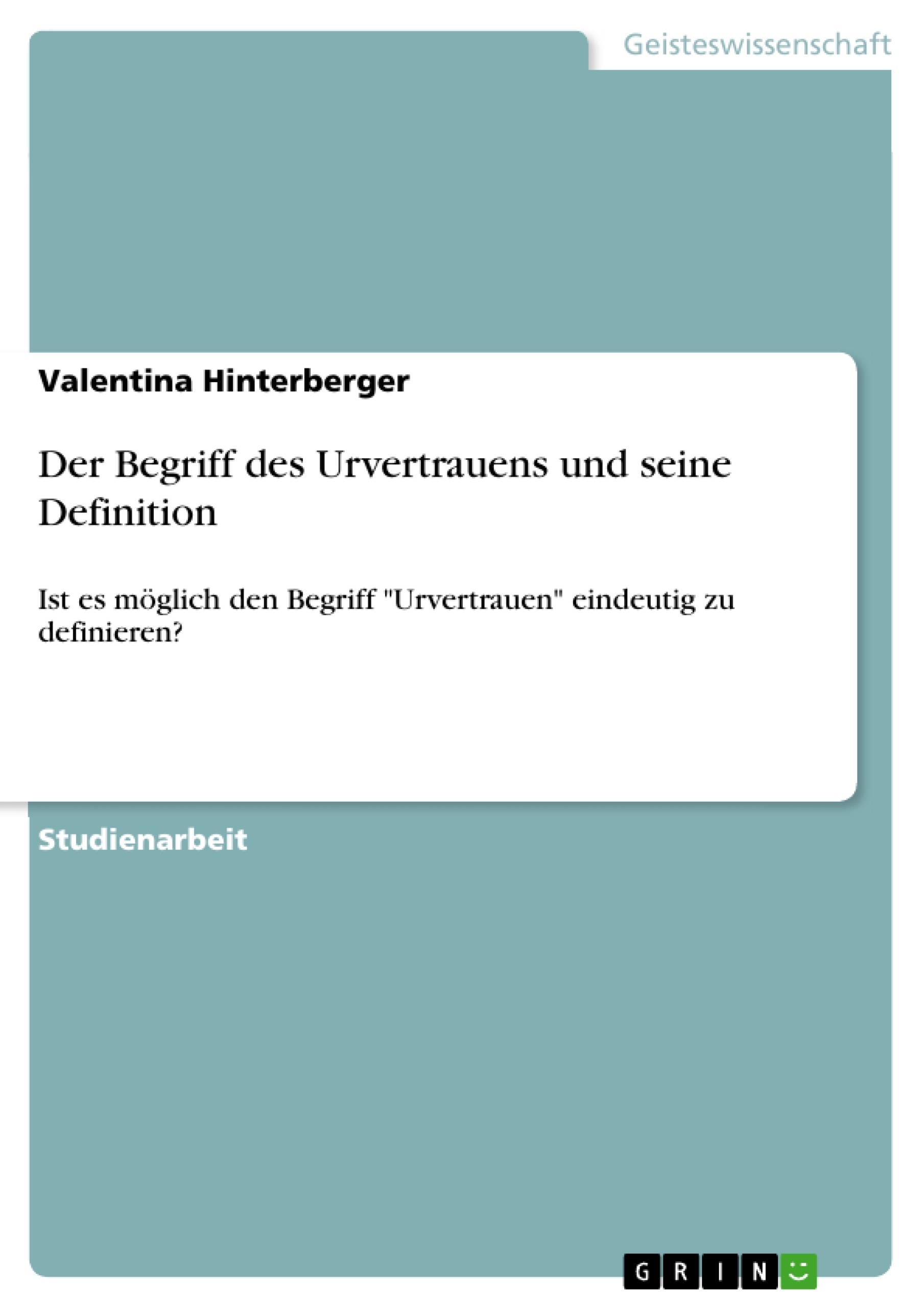Im Rahmen dieser Arbeit werden nun unterschiedliche Definitionen und die Bedeutsamkeiten von Urvertrauen dargestellt. Es wird überprüft, ob es eine einstimmige Begriffserklärung gibt, oder ob dieser Terminus zu umfassend ist.
Vertrauen zu können ist eine Fähigkeit, welche nicht wegzudenken ist. Jeden Tag begleitet Vertrauen die Menschen von früh bis spät und das auch meist unbewusst. Sei es in der Arbeit, im Straßenverkehr, beim Einkauf oder beim Sport. Vertrauen ist wohl eine der wichtigsten Überzeugungen, die man zum Leben braucht.
Man vertraut jedoch nicht nur in die eigene Umwelt und den Mitmenschen, man muss sich auch selbst vertrauen, um unbeschwert existieren zu können.
Ein wichtiger Bestandteil des Vertrauens ist das Urvertrauen, auf welches in dieser Arbeit eingegangen wird. Es ist ein Konstrukt, welches unterschiedlich interpretiert und beschrieben wird. Der wohl größte Unterschied zwischen Urvertrauen und Vertrauen besteht darin, dass Urvertrauen anhaltend und Vertrauen variabel ist, weshalb man die Begriffe nicht als absolut ident bezeichnen kann. (Vertrauensbuch zur Salutogenese, 2012)
Trotz allem ist es von Bedeutung sich mit dieser Überzeugung auseinanderzusetzen und den Wert dahinter zu erkennen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begründung
- Peter Wust
- Entwicklung
- Psychische Entwicklung nach Erik H. Erikson
- Biosoziologische Entwicklung nach Dieter Claessens
- Definitionen
- Otto Friedrich Bollnow
- Karen Joseph
- Versuch einer globalen Definition
- Urvertrauen als positive Empfindung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Begriff des Urvertrauens und seiner Bedeutung in der Psychologie. Ziel ist es, den Begriff des Urvertrauens zu erläutern und zu untersuchen, ob eine eindeutige Definition möglich ist.
- Entwicklung des Urvertrauens in Psychologie und Biosoziologie
- Unterschiedliche Definitionen des Urvertrauens
- Bedeutung des Urvertrauens für die menschliche Entwicklung
- Untersuchung der Möglichkeit einer eindeutigen Definition des Urvertrauens
- Zusammenhänge zwischen Urvertrauen und Vertrauen in die Umwelt und in sich selbst
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Urvertrauens ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Ist es möglich, den Begriff "Urvertrauen" eindeutig zu definieren?
Im Kapitel "Begründung" wird Peter Wust als deutscher Begründer des Urvertrauens vorgestellt und seine Auffassung des fundamentalen Vertrauens erläutert.
Das Kapitel "Entwicklung" beschreibt die Entwicklung des Urvertrauens in der Psychologie und Biosoziologie. Es werden die Ansichten von Erik H. Erikson und Dieter Claessens zum Urvertrauen vorgestellt.
Im Kapitel "Definitionen" werden verschiedene Versuche, den Begriff des Urvertrauens zu definieren, vorgestellt. Dabei werden unter anderem die Definitionen von Otto Friedrich Bollnow und Karen Joseph beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Begriff des Urvertrauens, seiner Entstehung und seinen Definitionen in der Psychologie und Soziologie. Wichtige Schlüsselwörter sind: Urvertrauen, Basic Trust, Grundvertrauen, Seinsvertrauen, Basic Security, psychosoziale Entwicklung, Biosoziologie, Vertrauen, Entwicklungspsychologie.
- Citation du texte
- Valentina Hinterberger (Auteur), 2022, Der Begriff des Urvertrauens und seine Definition, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1458008