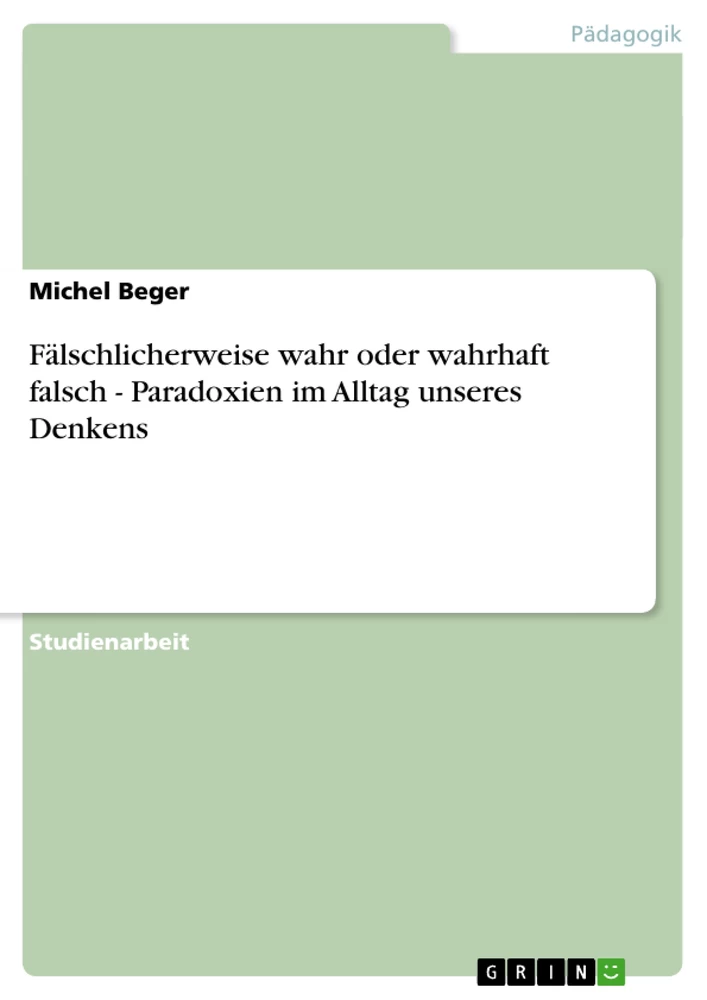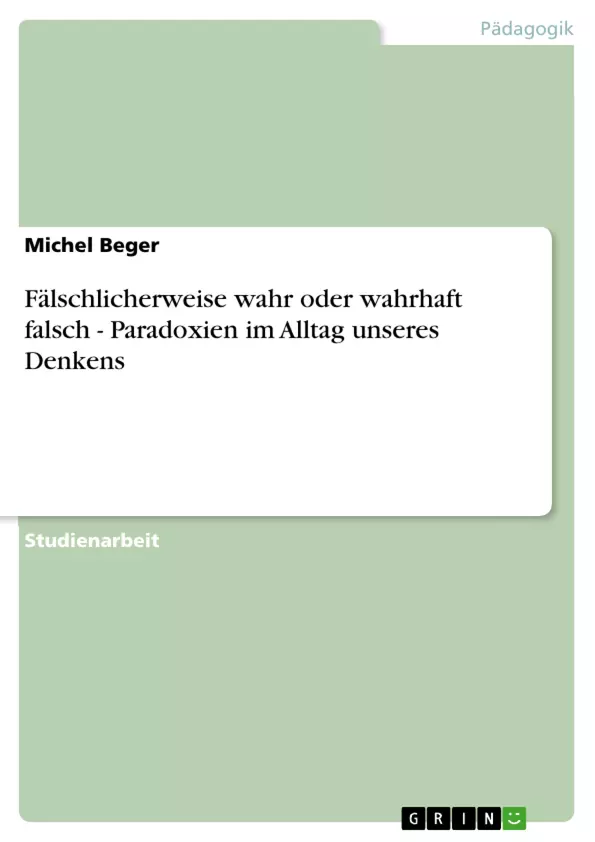Die Suche nach einem passenden Beispiel um in diese Arbeit einzuleiten, stellte sich ausgesprochen schwierig dar. Obwohl genügend davon in der praktischen Erfahrung und dem Alltag vorliegen, genügte keines den Anforderungen, die darauf ausgelegt waren, den „Appetit anzuregen, aber den Braten noch in der Röhre zu lassen“. Schlussendlich entschied ich mich dann doch für die Variante, die durch jene Beispiele charakterisiert ist, die ohnehin solche Arbeiten schon viel zu oft einleiteten.
Wenn ein Goethe-Denkmal durch die Bäume schillert; wenn ein Arzt kalte Umschläge wärmstens empfiehlt; wenn eine Mutter ihr Kind unverwandt anstarrt; wenn ein Lokführer keinen Zug verträgt; genau dann handelt es sich um jenen Begriff der „Paradoxie“, der doch schon so vielen Leuten Kopfzerbrechen bereitet hat.
In dieser Arbeit soll der Begriff der „Paradoxie“ ausgeleuchtet und gegen den sehr ähnlichen der „Antinomie“ abgegrenzt werden. Weiterhin wird anhand von drei sehr bekannten Paradoxien – Zenons Paradoxie von Achilles und der Schildkröte, dem Haufenparadox und dem Gefangenendilemma – die Vielfältigkeit derer dargestellt werden um letztlich solche paradoxen Formen auch im Hinblick auf das Denken und Sein des Menschen zu erläutern.
Mit dem Titel „Fälschlicherweise wahr oder wahrhaft falsch: Paradoxien im Alltag unseres Denkens“ sind dabei bereits zwei wichtige Felder eröffnet. Zum einen stellt sich die Frage, was Paradoxien sind. Sind sie wahr? Sind sie falsch? Oder sind sie vielleicht beides? Zum anderen soll dargestellt werden, inwiefern Paradoxien in unserem alltäglichen Leben bestehen und welche Bewandtnis diese haben? Im Besonderen werden die Haufenparadoxie, die Bewegungsparadoxie (Achilles und die Schildkröte) und das Gefangenendilemma behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. „Entgegen der Erwartung“: Was sind Paradoxien?
- 3. Paradox Formen des Denkens: Beispiele für logische Widersprüche
- 3.1 Die Bewegung
- 3.2 Der Haufen
- 3.3 Die Gefangenen
- 4. Paradoxien anthropologischen Denkens
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Begriff der Paradoxie und grenzt ihn von der Antinomie ab. Sie untersucht die Vielfältigkeit von Paradoxien anhand bekannter Beispiele und erläutert deren Bedeutung für das menschliche Denken und Sein. Die Arbeit beleuchtet die Frage nach der Wahrheit und Falschheit von Paradoxien und deren Vorkommen im Alltag.
- Definition und Abgrenzung von Paradoxie und Antinomie
- Analyse bekannter Paradoxien (z.B. Zenon, Haufenparadox, Gefangenendilemma)
- Paradoxien im alltäglichen Denken und Erleben
- Die Rolle von Schein und Wirklichkeit in Paradoxien
- Systematik und Lösungsansätze für Paradoxien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Schwierigkeit, ein passendes Beispiel für den Einstieg in die Thematik der Paradoxien zu finden. Sie führt den Begriff der Paradoxie anhand alltäglicher Beispiele ein und kündigt die Ziele der Arbeit an: die Ausleuchtung des Begriffs „Paradoxie“, die Abgrenzung zur „Antinomie“ und die Darstellung der Vielfältigkeit von Paradoxien im menschlichen Denken und Sein. Die zentrale Frage nach der Wahrheit und Falschheit von Paradoxien wird angeschnitten und die Relevanz ihres Auftretens im Alltag hervorgehoben.
2. „Entgegen der Erwartung“: Was sind Paradoxien?: Dieses Kapitel beleuchtet den etymologischen Ursprung des Wortes „Paradoxie“ und untersucht verschiedene Definitionen. Es wird die Definition von Richard M. Sainsbury diskutiert, der Paradoxien als scheinbar unannehmbare Schlussfolgerungen aus scheinbar annehmbaren Prämissen beschreibt. Die Sichtweise von Elena Esposito, die Selbstreferenz und Unentscheidbarkeit als Merkmale von Paradoxien nennt, wird ebenfalls vorgestellt. Ein wichtiger Aspekt ist die Abgrenzung der Paradoxie von der Antinomie, wobei die Unterschiede in der Lösbarkeit und der Natur des Widerspruchs hervorgehoben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Unterscheidung systemabhängig ist. Schließlich wird der paradoxe Charakter der Paradoxie selbst erläutert – ihre Existenz basiert sowohl auf Ablehnung als auch auf Anerkennung durch die Öffentlichkeit. Zwei Beispiele – der Barbier von Sevilla und der fehlerhafte Satz – illustrieren die beschriebenen Konzepte, aber der zweite Beispiel wird hier nicht vollständig wiedergegeben, da der Text an dieser Stelle abbricht.
Schlüsselwörter
Paradoxie, Antinomie, logischer Widerspruch, scheinbare Unannehmbarkeit, Selbstreferenz, Unentscheidbarkeit, Alltagserfahrung, Denken, Sein, Wahrheit, Falschheit, Zenons Paradoxie, Haufenparadox, Gefangenendilemma.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Paradoxien
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text befasst sich umfassend mit dem Thema Paradoxien. Er definiert den Begriff, grenzt ihn von der Antinomie ab und untersucht verschiedene Paradoxien anhand konkreter Beispiele. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Paradoxien für das menschliche Denken und Sein, sowie auf der Frage nach ihrer Wahrheit und Falschheit im Alltag.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und beschreibt die Ziele der Arbeit. Kapitel 2 ("Entgegen der Erwartung": Was sind Paradoxien?) beleuchtet den Begriff der Paradoxie etymologisch und definitional, grenzt ihn von der Antinomie ab und erläutert den paradoxen Charakter der Paradoxie selbst. Kapitel 3 (Paradox Formen des Denkens) behandelt Beispiele für logische Widersprüche (Bewegung, Haufen, Gefangenen). Kapitel 4 (Paradoxien anthropologischen Denkens) wird im Preview nicht näher beschrieben. Kapitel 5 (Zusammenfassung) fasst die Ergebnisse zusammen (im Preview nicht detailliert ausgearbeitet).
Welche Beispiele für Paradoxien werden im Text behandelt?
Der Text erwähnt und teilweise erläutert verschiedene Paradoxien, darunter Zenons Paradoxie, das Haufenparadox und das Gefangenendilemma. Weitere Beispiele werden in Kapitel 3 detaillierter behandelt (Bewegung, Haufen, Gefangenen).
Wie grenzt der Text Paradoxien von Antinomien ab?
Der Text hebt die Unterschiede zwischen Paradoxien und Antinomien in Bezug auf Lösbarkeit und die Natur des Widerspruchs hervor. Die Unterscheidung wird als systemabhängig beschrieben.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text behandelt?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Paradoxie, Antinomie, logischer Widerspruch, scheinbare Unannehmbarkeit, Selbstreferenz, Unentscheidbarkeit, Alltagserfahrung, Denken, Sein, Wahrheit, Falschheit, Zenons Paradoxie, Haufenparadox und Gefangenendilemma.
Welche Ziele verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, den Begriff "Paradoxie" zu klären, ihn von der "Antinomie" abzugrenzen und die Vielfalt von Paradoxien im menschlichen Denken und Sein aufzuzeigen. Er untersucht die Frage nach der Wahrheit und Falschheit von Paradoxien und deren Relevanz im Alltag.
- Quote paper
- Michel Beger (Author), 2009, Fälschlicherweise wahr oder wahrhaft falsch - Paradoxien im Alltag unseres Denkens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146110