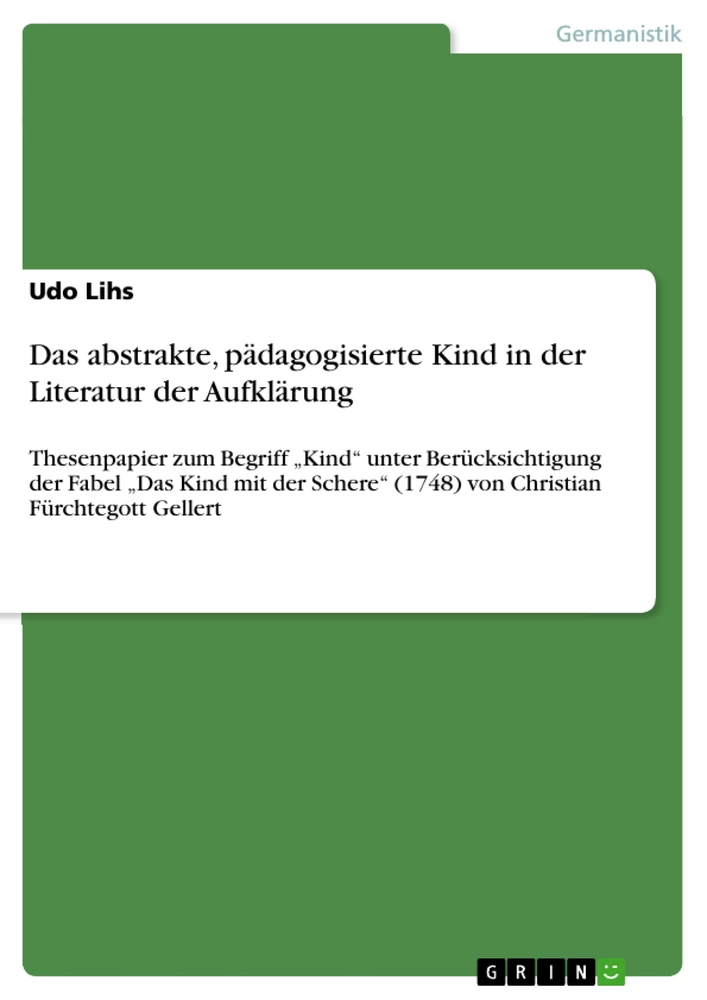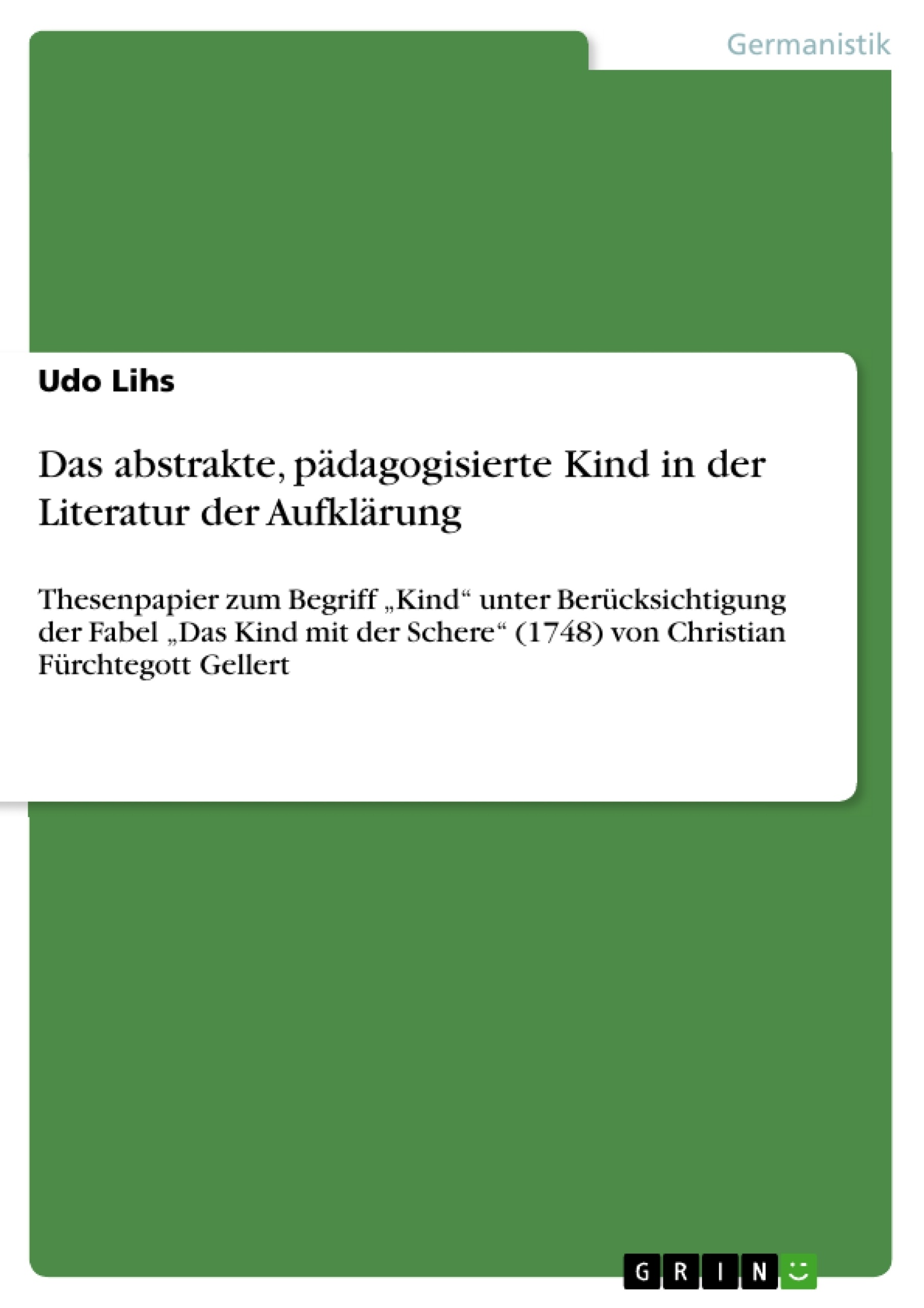Die Geschichte des Begriffs "Kind" führt regelmäßig zu vielfältigen kritischen Diskursen in der Kultur- und Literaturgeschichte. Das Kind ist bis heute ein Mythos, ein Symbol oder eine Metapher.
Dieses Thesenpapier wird sich auf die Symbolkraft des Kindes aus der Perspektive der Epoche der Aufklärung konzentrieren und der These nachgehen, dass das Kind in der Zeit der Aufklärung „pädagogisiert“ wurde. Diese These wird an der Fabel "Das Kind mit der Schere" von Christian Fürchtegott Gellert belegt.
Inhaltsverzeichnis
- „Das Kind“ als Abstraktion, als Symbol – Eine Einleitung
- Die Darstellung Kindheit ist daher auch häufig ein Motiv der persönlichen, oft gar der kollektiven Erinnerung.
- Das Kind als Symbol in der Bibel: Kinderopfer, Kinderkult und Kinderschutz
- Das pädagogisierte Kind in der Zeit der Aufklärung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Thesenpapier untersucht die Symbolkraft des Kindes in der Aufklärung, insbesondere im Kontext der Pädagogik. Es analysiert, wie der Begriff „Kind“ in der Literatur und Philosophie dieser Epoche verstanden und dargestellt wurde, unter Berücksichtigung der Veränderung seiner Bedeutung im Vergleich zu früheren Epochen.
- Die Entwicklung des Begriffs „Kind“ in der Kultur- und Literaturgeschichte
- Das Kind als Symbol in der christlichen Religion
- Die Pädagogisierung des Kindes in der Aufklärung
- Der Wandel des Kindheitsverständnisses in der Aufklärung
- Gellerts Fabel "Das Kind mit der Schere" als Beispiel für die aufklärerische Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
„Das Kind“ als Abstraktion, als Symbol – Eine Einleitung: Dieses einleitende Kapitel beleuchtet die vielschichtigen und oft widersprüchlichen Vorstellungen vom Kind in der Kultur- und Literaturgeschichte. Es unterstreicht die unterschiedlichen Perspektiven verschiedener Disziplinen – von der Erziehungswissenschaft bis zur Literaturwissenschaft – auf den Begriff „Kind“ und die daraus resultierende Begriffsverwirrung. Es wird gezeigt, dass die Darstellung von Kindheit sowohl abstrakte als auch konkrete Formen annimmt, von idealisierten Kindheitsbildern bis hin zu realistischen Darstellungen individueller Kindheiten. Das Kapitel legt den Grundstein für die anschließende Analyse der pädagogisierten Kindheitsvorstellung der Aufklärung, indem es den Kontrast zur modernen, differenzierteren Betrachtungsweise von Kindheit herausarbeitet.
Die Darstellung Kindheit ist daher auch häufig ein Motiv der persönlichen, oft gar der kollektiven Erinnerung: Der Abschnitt erweitert die einleitenden Überlegungen, indem er die Darstellung von Kindheit als Motiv in der Literatur beleuchtet. Er veranschaulicht, wie Schriftsteller, wie z.B. Martin Walser, Kindheitserfahrungen in ihren Werken verarbeiten und so sowohl individuelle als auch kollektive Erinnerungen an Kindheit gestalten. Es wird der Unterschied zwischen konkreten, individuellen Kindheitsdarstellungen in der Nachkriegsliteratur und der abstrakteren, pädagogisierten Vorstellung von Kindheit in der Aufklärung herausgestellt. Der Abschnitt bereitet den Leser auf die folgende Analyse der Aufklärungspädagogik vor, indem er den Kontrast zwischen individueller Erfahrung und pädagogischer Norm deutlich macht.
Das Kind als Symbol in der Bibel: Kinderopfer, Kinderkult und Kinderschutz: Dieses Kapitel untersucht die symbolische Bedeutung des Kindes im Christentum. Es analysiert biblische Beispiele, die Kinder als Opfer (Isaak), als Gegenstand von Kult (Jesuskind) und als schutzbedürftige Wesen darstellen. Die unterschiedlichen Aspekte – Opferbereitschaft, Unschuld, Schutzbedürftigkeit – werden herausgearbeitet und ihre Bedeutung für die spätere Entwicklung des Kindheitsverständnisses erläutert. Die Analyse dieses Kapitels bildet einen wichtigen Kontext für das Verständnis der Veränderungen im Kindheitsverständnis während der Aufklärung, da sie die religiösen Wurzeln des traditionellen Bildes vom Kind aufzeigt.
Das pädagogisierte Kind in der Zeit der Aufklärung: Dieser Abschnitt bildet den Kern des Thesenpapiers und analysiert die Vorstellung vom Kind in der Aufklärungsepoche. Im Mittelpunkt steht die zunehmende Bedeutung der Pädagogik und die damit verbundene „Pädagogisierung“ des Kindes. Die Zitate von Kant und Baader verdeutlichen die aufklärerische Vorstellung vom Kind als einem Wesen, das durch Erziehung zur Autonomie und Vernunft geführt werden muss. Gellert wird als Beispiel für die aufklärerische Pädagogik genannt, wobei die Bedeutung der Erziehung als Weg zum Glück, aber auch die Unvermeidbarkeit von Kinderleid betont wird. Das Kapitel beleuchtet den Wandel vom religiösen zum pädagogischen Verständnis des Kindes in der Aufklärung.
Schlüsselwörter
Aufklärung, Kind, Pädagogik, Erziehung, Kindheitsbilder, Symbol, Metapher, Gellert, Kant, Christentum, Abstraktion, Objektivierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thesenpapier: Das Kind in der Aufklärung
Was ist der Gegenstand des Thesenpapiers?
Das Thesenpapier untersucht die Symbolkraft des Kindes in der Aufklärung, insbesondere im Kontext der Pädagogik. Es analysiert, wie der Begriff „Kind“ in der Literatur und Philosophie dieser Epoche verstanden und dargestellt wurde und vergleicht dies mit früheren Epochen.
Welche Themen werden im Thesenpapier behandelt?
Das Papier behandelt die Entwicklung des Begriffs „Kind“, das Kind als Symbol in der christlichen Religion, die Pädagogisierung des Kindes in der Aufklärung, den Wandel des Kindheitsverständnisses und Gellert's Fabel "Das Kind mit der Schere" als Beispiel für die aufklärerische Pädagogik.
Wie ist das Thesenpapier strukturiert?
Das Papier enthält eine Einleitung, die die vielschichtigen Vorstellungen vom Kind beleuchtet. Es folgt eine Analyse der Darstellung von Kindheit als Motiv in der Literatur, eine Untersuchung der symbolischen Bedeutung des Kindes in der Bibel (Kinderopfer, Kinderkult, Kinderschutz) und schließlich eine detaillierte Analyse der pädagogisierten Kindheitsvorstellung der Aufklärungsepoche, inklusive der Betrachtung von Kant und Baader. Schlüsselwörter und eine Zusammenfassung der Kapitel ergänzen die Arbeit.
Welche Autoren und Philosophen werden im Thesenpapier erwähnt?
Das Thesenpapier erwähnt unter anderem Kant, Baader und Gellert. Martin Walser wird als Beispiel für die Darstellung von Kindheitserfahrungen in der Literatur genannt.
Welche Aspekte der Darstellung des Kindes werden im Thesenpapier untersucht?
Das Thesenpapier untersucht die abstrakten und konkreten Formen der Kindheitsdarstellung, idealisierte Kindheitsbilder, realistische Darstellungen, den Kontrast zwischen individuellen Kindheitsdarstellungen und der pädagogisierten Vorstellung von Kindheit, sowie den Wandel vom religiösen zum pädagogischen Verständnis des Kindes.
Welche Bedeutung hat die Bibel für das Verständnis des Kindes in der Aufklärung?
Das Thesenpapier untersucht die symbolische Bedeutung des Kindes im Christentum anhand biblischer Beispiele (Isaak, Jesuskind). Es zeigt auf, wie die religiösen Wurzeln des traditionellen Bildes vom Kind das Verständnis der Aufklärung beeinflussten.
Welche Rolle spielt die Pädagogik in der aufklärerischen Vorstellung vom Kind?
Die zunehmende Bedeutung der Pädagogik und die damit verbundene „Pädagogisierung“ des Kindes stehen im Mittelpunkt der Analyse der Aufklärungsepoche. Das Kind wird als ein Wesen betrachtet, das durch Erziehung zur Autonomie und Vernunft geführt werden muss.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Thesenpapiers?
Schlüsselwörter sind: Aufklärung, Kind, Pädagogik, Erziehung, Kindheitsbilder, Symbol, Metapher, Gellert, Kant, Christentum, Abstraktion, Objektivierung.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, das Thesenpapier enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die Kernaussagen und Argumentationslinien jedes Abschnitts zusammenfasst.
Für welche Zielgruppe ist das Thesenpapier geschrieben?
Das Thesenpapier richtet sich an eine akademische Leserschaft, die sich mit der Geschichte des Kindheitsverständnisses und der Rolle der Pädagogik in der Aufklärung auseinandersetzen möchte.
- Citation du texte
- Udo Lihs (Auteur), 2008, Das abstrakte, pädagogisierte Kind in der Literatur der Aufklärung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146383