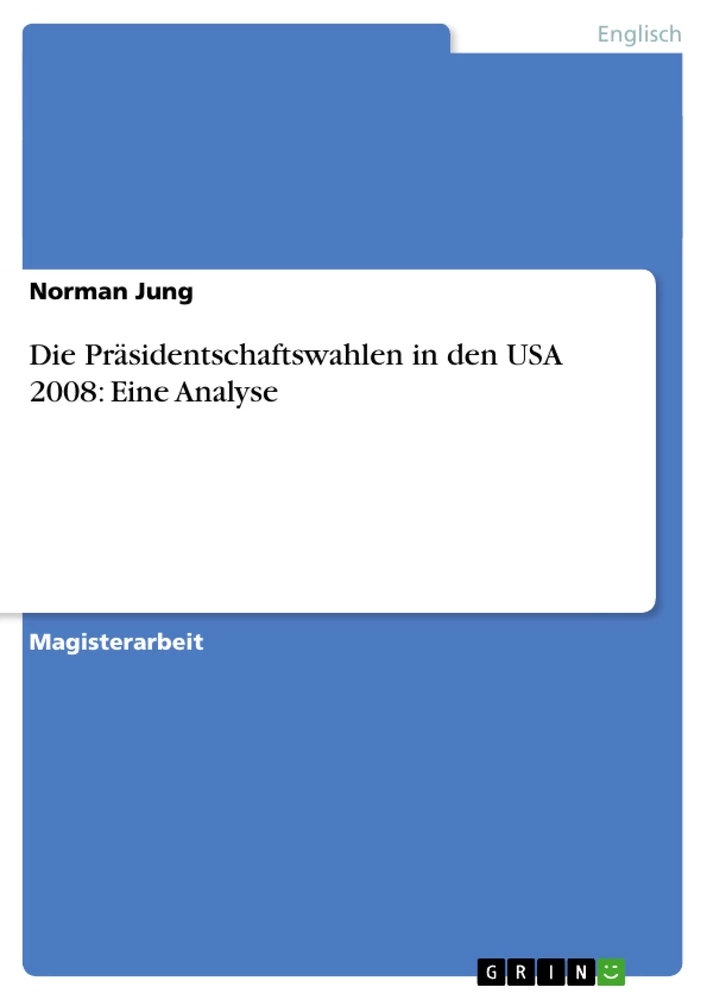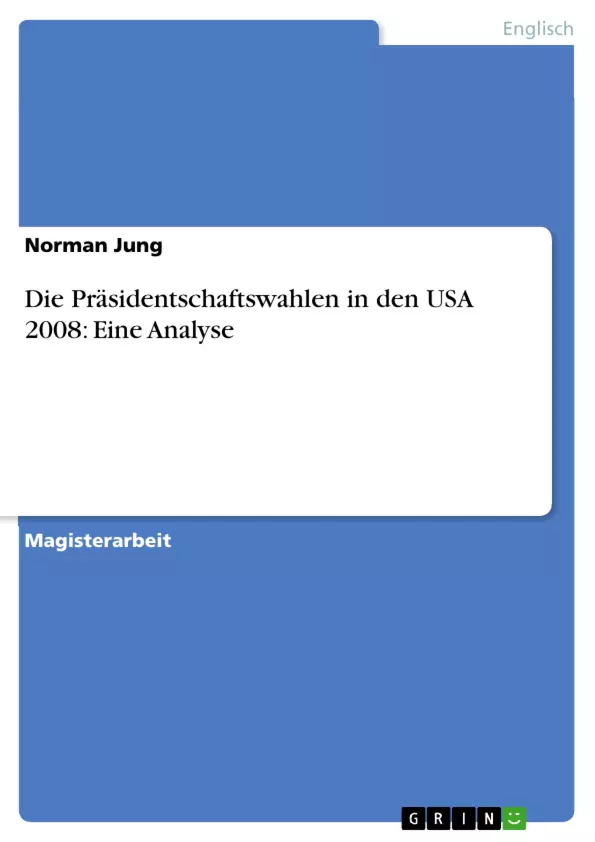1. Einleitung
Seit der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika wählt das wahlberechtigte Volk alle vier Jahre einen neuen Präsidenten und entscheidet somit über die zukünftige Ausrichtung der Politik des Landes. Einige dieser Wahlen markierten Wendepunkte in der Geschichte Amerikas und daher oft auch in der Geschichte der Welt. So beendete Abraham Lincoln die Sklaverei, Franklin D. Roosevelt etablierte die USA in einer weltweiten Führungsrolle und John F. Kennedy inspirierte Millionen von Amerikanern. Im Jahre 2008 ist ein weiterer dieser Wendepunkte erreicht worden. Erstmals schaffte es ein Afroamerikaner, an die Spitze der Vereinigten Staaten gewählt zu werden. Dies ist ein großer Schritt auf dem Weg zur Realisierung der verfassungsmäßigen Gleichheit aller Amerikaner. Darüber hinaus ist mit Barack Obamas Wahl die Hoffnung auf einen grundlegenden Wandel der USA weg von der neokonservativen Machtpolitik George W. Bushs und hin zu einem weltoffenen und dialogbereiten Amerika verbunden. “Change” war das Zauberwort des Wahlkampfes und eine Veränderung, einen Neuanfang versprachen sich alle Wähler Barack Obamas. Eine gesundheitliche Absicherung für jeden Bürger, wirtschaftliche Stabilität, freier Zugang zur Bildung, Energiesicherheit, ein Abzug aus dem Irak und ein besseres Ansehen in der Welt - diese Dinge standen vor den Wahlen auf den Wunschzetteln der meisten Amerikaner. Diesbezüglich könnten die politischen Ansätze von George W. Bush und seinem Nachfolger unterschiedlicher nicht sein. Wie es Obama gelang, diesen gravierenden Wechsel im Wählerverhalten auszulösen und wie der Verlauf der Wahlkampagnen dazu beitrug, soll Thema dieser Arbeit sein.
Da es sich bei den US-Wahlen 2008 noch mehr als sonst um einen Kampf der Persönlichkeiten und Ideologien handelte, sollen die politischen Sachthemen nur eine untergeordnete Rolle in dieser Betrachtung spielen. Vielmehr sollen der Wahl- und Meinungsbildungsprozess sowie die kulturellen, medialen und persönlichen Voraussetzungen für den epochalen Triumph eines Mannes herausgearbeitet werden, der noch zwei Jahre vor der Wahl kaum einem Amerikaner bekannt war.
Nach einer Erläuterung der Besonderheiten des amerikanischen Wahlsystems sollen kurz die Themen dargelegt werden, die großen Einfluss auf den Wahlausgang hatten...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Wahlsystem der USA
- Die historische Entwicklung
- Der Ablauf der Wahlen heute
- Die Vorwahlen
- Die Nominierungsparteitage
- Die Präsidentschaftswahlen
- Die Arbeit des Electoral College
- Kritik
- Die entscheidenden Themen
- Der Krieg im Irak
- Die Finanz- und Wirtschaftskrise
- Das Gesundheitssystem
- Die Unbeliebtheit Bushs
- Wandel gegen Erfahrung
- Die Vorwahlen
- Invisible Primaries
- Iowa, New Hampshire und der Kampf um frühe Wahltermine
- Die Vorwahlen der Demokraten
- John Edwards' Kampagne
- Hillary Clinton - im Porträt
- Barack Obama - ein unwahrscheinlicher Aufstieg
- Die Entstehung der “Obamania”
- Sein Team
- Popstar - und Kritik
- Die ersten Einzelstaaten
- Super Tuesday
- Das lange Ringen
- Die Vorwahlen der Republikaner
- Die Kandidaten
- John McCain - Die Geschichte eines Kämpfers
- Die ersten Einzelstaaten
- Super Tuesday
- Die schnelle Entscheidung
- Die Hauptwahlen
- Drittkandidaten
- Der Verlauf bis September
- Die Wahl der Vizekandidaten
- Obama – Biden
- McCain - Palin
- Die Finanzkrise als entscheidendes Thema
- Die großen TV-Duelle
- Die Wahlkampffinanzierung
- Die Rolle der Medien
- Die Rolle der Religion
- Die heiße Phase
- Wahltag
- Auswertung der Wahlergebnisse
- Die Bedeutung der Wahlen
- Internationale Reaktionen
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit analysiert die Präsidentschaftswahlen in den USA im Jahr 2008 und fokussiert dabei auf den Aufstieg von Barack Obama zum Präsidenten. Die Arbeit untersucht den Wahlkampfprozess, die beteiligten Kandidaten und die entscheidenden Themen, die den Wahlausgang beeinflusst haben. Die Analyse konzentriert sich auf den außergewöhnlichen Erfolg Obamas, der den Aufstieg eines afroamerikanischen Politikers an die Spitze der USA markierte. Die Arbeit befasst sich auch mit den kulturellen, medialen und persönlichen Voraussetzungen, die zu diesem epochalen Triumph führten.
- Das amerikanische Wahlsystem und seine Besonderheiten
- Die Rolle von Themen wie dem Krieg im Irak, der Finanz- und Wirtschaftskrise und dem Gesundheitssystem im Wahlkampf
- Die Vorwahlen und der Aufstieg Barack Obamas im Vergleich zu seinen Konkurrenten
- Die Hauptwahlen, die Rolle der Medien und die Bedeutung der Wahlkampffinanzierung
- Die Bedeutung der Wahlen 2008 für die Zukunft der USA
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Präsidentschaftswahlen 2008 im historischen Kontext dar und hebt die besondere Bedeutung des Wahlsiegs von Barack Obama hervor. Die Kapitel 2 und 3 befassen sich mit dem amerikanischen Wahlsystem und den entscheidenden Themen des Wahlkampfes. Kapitel 4 beleuchtet die Vorwahlen, insbesondere den Aufstieg von Barack Obama und den Verlauf der Vorwahlen der Republikaner. Kapitel 5 befasst sich mit den Hauptwahlen, den Kandidaten, den entscheidenden Themen, der Rolle der Medien und den Auswirkungen der Finanzkrise auf den Wahlkampf. Das Resümee fasst die zentralen Ergebnisse der Analyse zusammen und beleuchtet die Bedeutung der Präsidentschaftswahlen 2008 für die Zukunft der USA.
Schlüsselwörter
Präsidentschaftswahlen, USA, Barack Obama, Wahlkampf, Wahlsystem, Vorwahlen, Hauptwahlen, Finanzkrise, Medien, Politik, Kultur, Geschichte, Afroamerikaner, Wandel, Neuanfang, Hoffnung.
Häufig gestellte Fragen
Warum galt die US-Wahl 2008 als historischer Wendepunkt?
Erstmals wurde mit Barack Obama ein Afroamerikaner zum Präsidenten gewählt, was als großer Schritt zur Realisierung der verfassungsmäßigen Gleichheit in den USA angesehen wurde.
Welche Themen waren für den Wahlausgang entscheidend?
Zentrale Themen waren der Irak-Krieg, die Finanz- und Wirtschaftskrise, das Gesundheitssystem und die allgemeine Unbeliebtheit des Amtierenden George W. Bush.
Was ist das Electoral College?
Das Electoral College ist das Gremium der Wahlmänner, das den Präsidenten offiziell wählt. Die Arbeit erläutert die Funktionsweise und die Kritik an diesem System.
Wie gelang Barack Obama der Aufstieg vom Unbekannten zum Präsidenten?
Die Analyse untersucht den Wahlkampfprozess, die „Obamania“, die Rolle seines Teams und die mediale Inszenierung des Slogans „Change“.
Welche Rolle spielten die Vorwahlen (Primaries)?
Die Arbeit beleuchtet das lange Ringen zwischen Obama und Hillary Clinton bei den Demokraten sowie die schnelle Entscheidung bei den Republikanern für John McCain.
- Citation du texte
- Norman Jung (Auteur), 2009, Die Präsidentschaftswahlen in den USA 2008: Eine Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146612