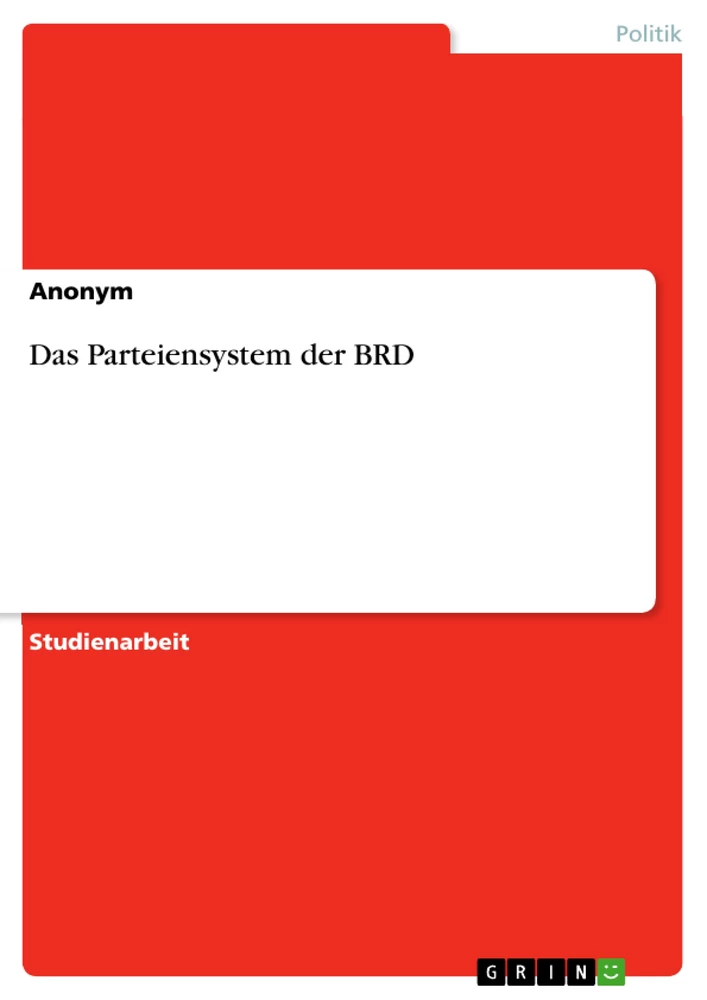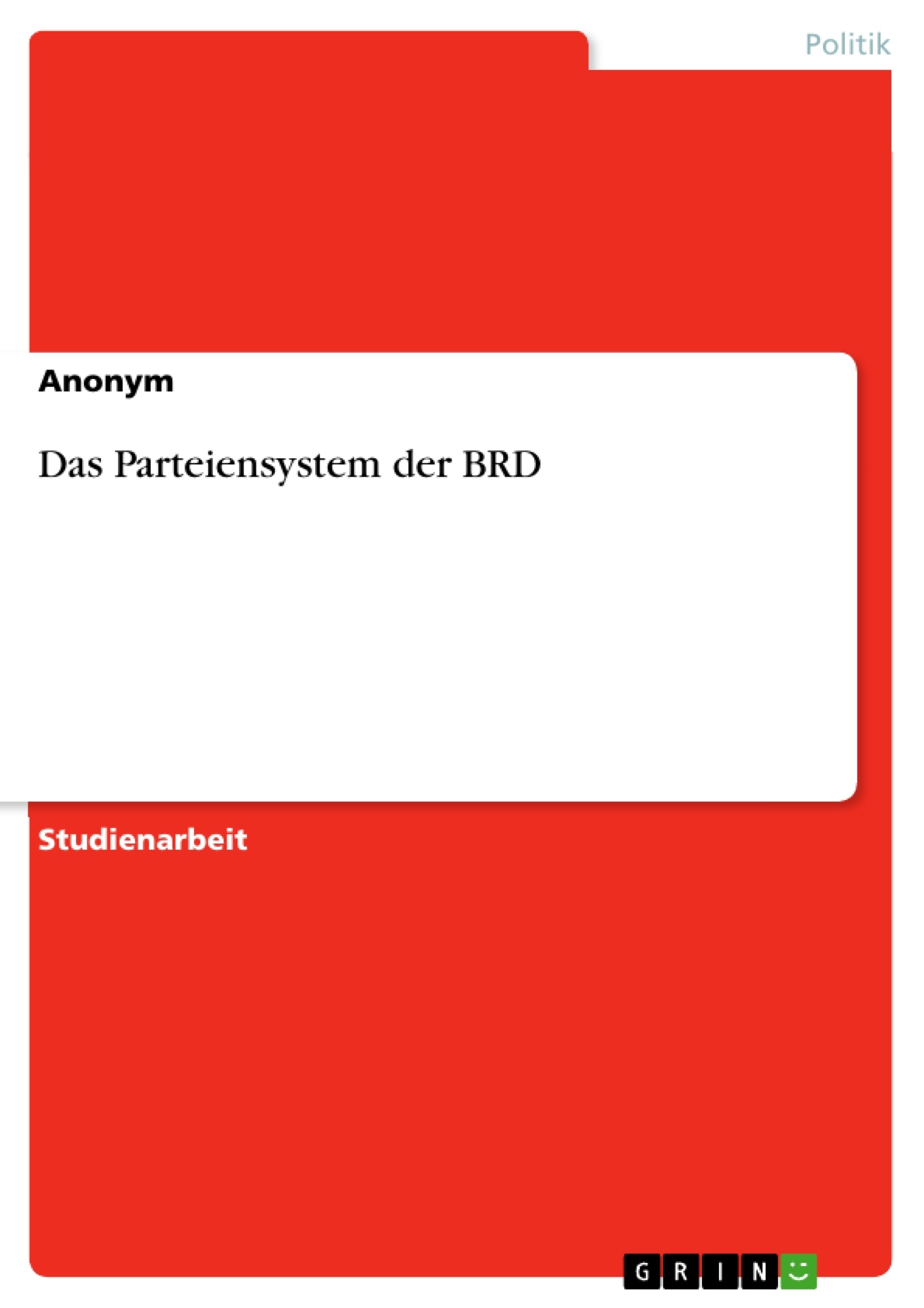„Der Parteienstaat wurde von den Vätern des Grundgesetzes als ein positives Gut ver-standen“ (Hartmann 2004: 112). Dennoch muss man nicht erst seit der Wiedervereini-gung feststellen, dass dieser Begriff in der Politikwissenschaft für Polarisierung sorgt und bei weitem nicht als ein durchweg positiv konnotierter einzuordnen ist. Kritik am Partei-enstaat Deutschland lässt sich insbesondere mit dem geflügelten Wort der „Parteiverdros-senheit“ in Verbindung bringen. Nicht nur die politische Kultur seit den 80er Jahren be-sagt eine solche. Auch Kritiker wie Hans Herbert von Arnim unterstellen dem politischen System der Bundesrepublik einen „überdehnten Einfluss der Parteien“ (Rudzio 2006: 94) und bezeichnen „Staat und Verwaltung als Beute“ und die wuchernde Parteienfinanzie-rung als „Selbstbedienung“ (Rudzio 2006: 94). So stellt Peter Lösche fest: „Das Problem des bundesdeutschen Parteienstaates besteht heute nicht in zu wenig, sondern – zumindest in publizistischen Meinungen – in zuviel Macht und Einfluss“ (Lösche 2006: 23). Karl-heinz Niclauß dagegen gehört zu jenen, die das Parteiensystem der Bundesrepublik wei-testgehend verteidigen. Wenngleich er auch Kritik hinsichtlich der innerparteilichen De-mokratie und der Intransparenz der Parteienfinanzierung übt, würdigt er „die Verdienste der Parteien um die politisch-wirtschaftliche Stabilität der Bundesrepublik und tritt damit einer oberflächlichen Parteiverdrossenheit entgegen“ (Niclauß 1995: Einband).
An dieser Stelle stellt sich die Frage, wie weit die Bundesrepublik tatsächlich als Partei-enstaat zu bezeichnen ist. Auch hierüber gibt es unterschiedlichste Meinungen, da der Parteienstaat nicht von den Vätern des Grundgesetzes als solcher deklariert wurde, son-dern lediglich einer Verfassungsinterpretation zu Grunde liegt. Peter Lösche beispielswei-se versteht unter einem Parteienstaat ganz generell „eine repräsentative Demokratie […], in der Parteien in der Verfassungsrealität, das heißt beim Zustandekommen politischer Entscheidungen und bei deren Legitimation, die dominierende Rolle spielen“ (Lösche 2006: 13).
Und welche Rolle das ist, die die politischen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland spielen, soll an Hand des folgenden Überblicks über das deutsche Parteiensystem zumin-dest ansatzweise verdeutlicht werden, um anschließend nach einer Antwort auf die Frage suchen zu können, ob Deutschland tatsächlich als Parteienstaat bezeichnet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- A. Vorwort
- B. Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland
- I. Die rechtliche Fundierung der Parteien
- II. Definition des Parteienbegriffs
- III. Entstehung und Entwicklung des Parteiensystems in Deutschland
- 1. Cleavages-Theorie
- 2. Wurzeln des bundesdeutschen Parteiensystems
- IV. Parteientypologie
- 1. Honoratiorenpartei
- 2. Massenintegrationspartei
- 3. Volkspartei
- V. Aufgaben und Funktionen
- VI. Struktur und Organisation
- 1. Innerparteiliche Demokratie: Parteiengliederung und Parteiorgane
- 2. Parteienfinanzierung.
- C. Deutschland – ein Parteienstaat?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem deutschen Parteiensystem und untersucht dessen rechtliche Fundierung, Entwicklung, Typologie, Funktionen und Struktur. Ziel ist es, die Rolle der Parteien in der Bundesrepublik Deutschland zu beleuchten und die Frage zu beantworten, ob Deutschland tatsächlich als Parteienstaat bezeichnet werden kann.
- Rechtliche Fundierung der Parteien in Deutschland
- Entwicklung des deutschen Parteiensystems
- Typologie der deutschen Parteien
- Aufgaben und Funktionen der Parteien in der Demokratie
- Struktur und Organisation der politischen Parteien
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der rechtlichen Fundierung der politischen Parteien in Deutschland. Es wird die Verankerung der Parteien im Grundgesetz und im Parteiengesetz sowie das „Parteienprivileg“ erläutert. Das zweite Kapitel widmet sich der Definition des Parteienbegriffs. Verschiedene Definitionen werden vorgestellt und es wird auf die historische Entwicklung des Parteienverständnisses eingegangen. Das dritte Kapitel beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Parteiensystems in Deutschland. Hier werden die Cleavages-Theorie und die Wurzeln des bundesdeutschen Parteiensystems analysiert.
Das vierte Kapitel behandelt die Typologie der deutschen Parteien. Verschiedene Parteitypen werden vorgestellt und analysiert. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit den Aufgaben und Funktionen der Parteien in der Demokratie. Das sechste Kapitel analysiert die Struktur und Organisation der politischen Parteien, insbesondere die innerparteiliche Demokratie und die Parteienfinanzierung.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Parteiensystem, Bundesrepublik Deutschland, Parteienstaat, Parteienprivileg, Parteiengesetz, Grundgesetz, Cleavages-Theorie, Parteientypologie, innerparteiliche Demokratie, Parteienfinanzierung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff „Parteienstaat“?
Ein Parteienstaat ist eine repräsentative Demokratie, in der politische Parteien eine dominierende Rolle bei der Willensbildung, der Entscheidungsgewalt und der Legitimation des politischen Systems spielen.
Wo sind die Rechte der Parteien im deutschen Recht verankert?
Die Rechtsstellung der Parteien basiert primär auf Artikel 21 des Grundgesetzes sowie auf dem Parteiengesetz (PartG), welches Aufgaben, Finanzierung und innere Ordnung regelt.
Was besagt die Cleavages-Theorie?
Die Cleavages-Theorie erklärt die Entstehung von Parteiensystemen durch historische gesellschaftliche Konfliktlinien (z.B. Arbeit vs. Kapital, Stadt vs. Land oder Kirche vs. Staat).
Welche Parteitypen werden in der Politikwissenschaft unterschieden?
Es wird klassischerweise zwischen Honoratiorenparteien, Massenintegrationsparteien und den modernen Volksparteien unterschieden.
Was versteht man unter dem „Parteienprivileg“?
Das Parteienprivileg schützt Parteien vor willkürlichen Verboten. Über die Verfassungswidrigkeit einer Partei darf in Deutschland ausschließlich das Bundesverfassungsgericht entscheiden.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2008, Das Parteiensystem der BRD, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146624