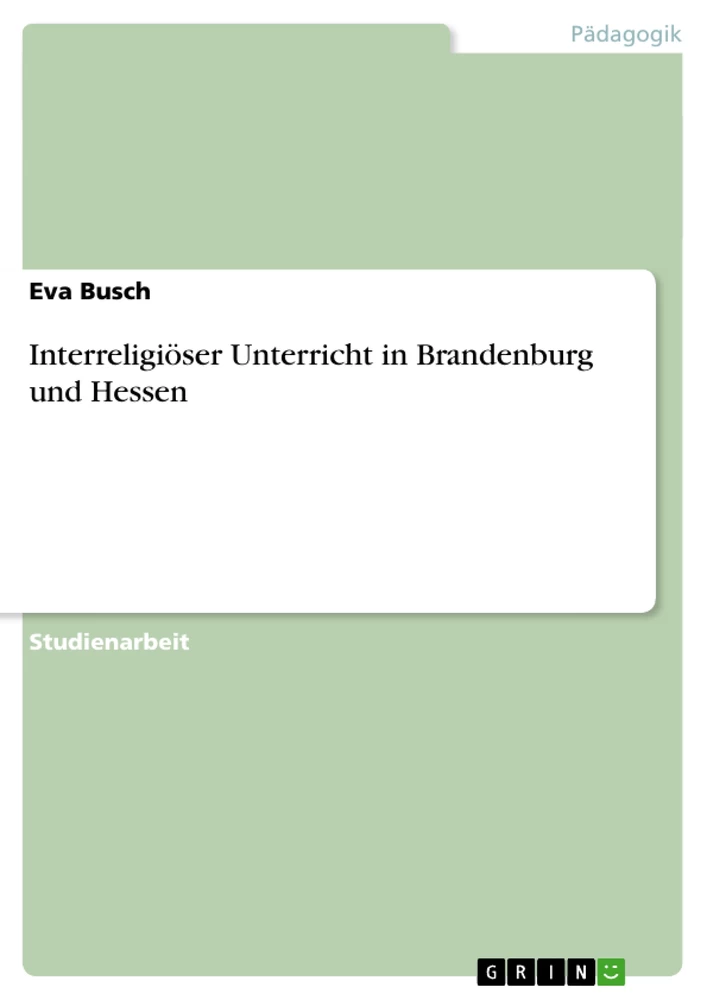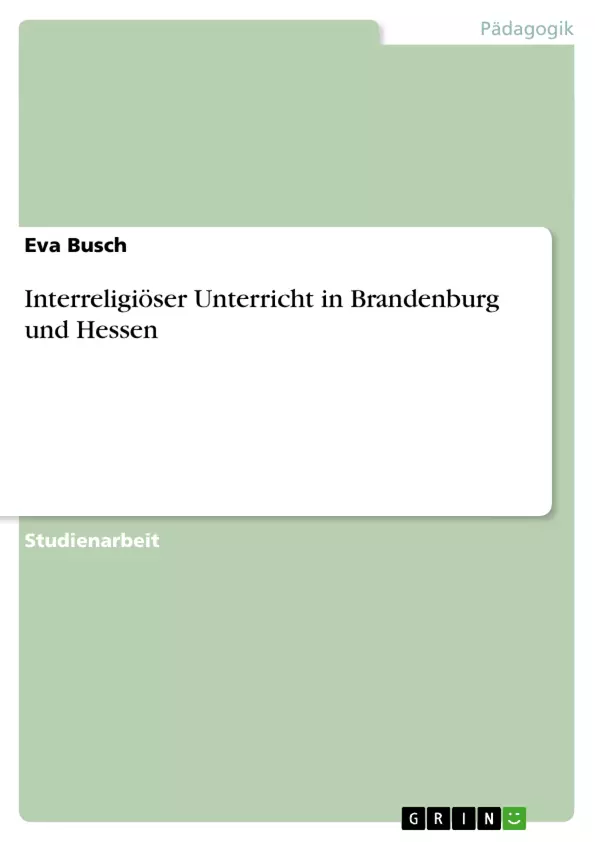Als die ersten Gastarbeiter nach Deutschland kamen, fanden sie zunächst noch wenig
Beachtung, da sie einen nur sehr geringen Anteil der Bevölkerung ausmachten.
Da sich nach dem Rotationsprinzip zwischen den 50er und den 70er Jahren die Zuzüge und
Abwanderungen ungefähr die Waage hielten und die Arbeiter nur selten ihre Familien mit nach
Deutschland brachten, da ihr Aufenthalt nur für einen kürzeren Zeitraum geplant war, war noch
keine massenhafte Migration zu verzeichnen.
Erst zum Beginn der 70er Jahre fand eine Familienzusammenführung statt, was eine hohe
Einwanderungsrate bedeutete und größere soziale Veränderungen auch kultureller und
religiöser Art bewirkte. Diese Auswirkungen zeigten sich in Folge auch in der Schule, wodurch
die Situation der Kinder mit Migrationshintergrund in deutschen Schulen zu einem öffentlichen
Skandal wurde und pädagogische Wissenschaftler im staatlichen Auftrag damit begannen, sich
mit dieser Situation zu beschäftigen. Allerdings darf bei dieser Entwicklung keinesfalls
vergessen werden, dass Heterogenität auch vor der Phase der Arbeitsmigration vorhanden war,
diese allerdings aufgrund ihrer nicht so auffälligen Ausprägung entweder nicht wahrgenommen
oder aber ignoriert wurde.
Dies läutete in der Pädagogik in den 70er Jahren die erste Phase ein, die von der
Ausländerpädagogik als kompensatorische Erziehung und der Assimilationspädagogik geprägt
war und den kulturellen sowie religiösen Hintergrund dieser Kinder nicht beachtete.
In dieser Phase wurden die Sprachschwierigkeiten als dominantes, weil auffälligstes Problem
wahrgenommen, dem man versuchte beizukommen. Die deutsche Sprache sollte erlernt
werden, damit sich die Kinder mit Migrationshintergrund möglichst schnell in den
Regelunterricht einfügen konnten. Zudem sollte durch den muttersprachlichen
Ergänzungsunterricht, der von muttersprachlichen Lehrern nach dem Curriculum des
Herkunftslandes, ohne Bezug zum sonstigen Unterricht der Kinder unterrichtet wurde, die
Rückkehrfähigkeit erhalten bleiben.
Im Vordergrund stand also ein Abbau von Defiziten, der die Assimilation der Kinder mit
Migrationshintergrund ermöglichen sollte.
Die grundsätzliche monokulturelle, monolinguale und auch monoreligiöse Ausrichtung des
Schulsystems sowie des Unterrichts wurden dabei nicht hinterfragt und die Entstehung einer
multikulturellen Gesellschaft, die sich bereits zu der Zeit auch in der Schule bemerkbar machte, wurde noch nicht wahrgenommen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Die pädagogische Reaktion auf die durch Migration entstandene Heterogenität in Deutschland
- Die plurale Realität in der Gesellschaft und die daraus resultierende Notwendigkeit eines interkulturellen und interreligiösen Unterrichts
- Interreligiöses Lernen und interreligiöser Unterricht
- Die interreligiöse Dimension des Religionsunterrichts in Hessens neuen Lehrplänen
- LER (Lebensgestaltung – Ethik - Religionskunde) in Brandenburg als Alternative zum konfessionellen Religionsunterricht
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Herausforderungen und Möglichkeiten des interreligiösen Unterrichts in Brandenburg und Hessen im Kontext der durch Migration entstandenen kulturellen und religiösen Heterogenität in Deutschland. Die Arbeit beleuchtet den historischen Hintergrund und die Entwicklung der Interkulturellen Pädagogik und ihre Relevanz für den Umgang mit religiöser Vielfalt im Bildungssystem.
- Entwicklung der Interkulturellen Pädagogik in Deutschland
- Die Bedeutung der Pluralität in der Gesellschaft für den Religionsunterricht
- Interreligiöses Lernen und interreligiöser Unterricht
- Die interreligiöse Dimension des Religionsunterrichts in Hessen und Brandenburg
- Die Rolle von LER (Lebensgestaltung – Ethik - Religionskunde) in Brandenburg
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 befasst sich mit der pädagogischen Reaktion auf die zunehmende Heterogenität in Deutschland, die durch Migration entstanden ist. Es werden die verschiedenen Phasen der Interkulturellen Pädagogik beleuchtet und die Herausforderungen im Umgang mit kultureller und religiöser Vielfalt im Bildungssystem aufgezeigt.
- Kapitel 2 analysiert die Auswirkungen der Pluralität in der Gesellschaft auf den Religionsunterricht. Es wird die Notwendigkeit eines interkulturellen und interreligiösen Unterrichts betont und die Bedeutung der religiösen und kulturellen Dimensionen der Pluralität für die Gestaltung des Unterrichts herausgestellt.
- Kapitel 3 beleuchtet das Konzept des interreligiösen Lernens und interreligiösen Unterrichts. Es werden verschiedene Ansätze und Methoden diskutiert, die zur Förderung des interreligiösen Dialogs und des gegenseitigen Verständnisses beitragen können.
- Kapitel 4 untersucht die interreligiöse Dimension des Religionsunterrichts in den neuen Lehrplänen von Hessen. Es werden die Herausforderungen und Chancen des interreligiösen Unterrichts in Hessen analysiert.
- Kapitel 5 beschäftigt sich mit dem LER (Lebensgestaltung – Ethik - Religionskunde) in Brandenburg als Alternative zum konfessionellen Religionsunterricht. Es werden die Ziele und Inhalte des LER-Unterrichts im Kontext der interreligiösen und interkulturellen Bildung diskutiert.
Schlüsselwörter
Interreligiöser Unterricht, Interkulturelle Pädagogik, Migration, Heterogenität, Pluralität, Religionsunterricht, LER, Lebensgestaltung – Ethik - Religionskunde, Hessen, Brandenburg, Deutschland, Familienzusammenführung, Assimilation, Integration.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Ausländerpädagogik und interkultureller Pädagogik?
Die Ausländerpädagogik der 70er Jahre war auf Assimilation und Defizitabbau ausgerichtet, während die interkulturelle Pädagogik die Vielfalt als Chance begreift und interreligiöses Lernen fördert.
Was bedeutet LER in Brandenburg?
LER steht für „Lebensgestaltung – Ethik – Religionskunde“ und ist ein integratives Fach in Brandenburg, das als Alternative zum konfessionellen Religionsunterricht dient.
Wie geht Hessen mit interreligiösem Unterricht um?
Hessen hat in seinen neuen Lehrplänen eine interreligiöse Dimension im Religionsunterricht verankert, um der pluralen Realität der Schüler gerecht zu werden.
Warum ist interreligiöses Lernen heute so wichtig?
Durch die Familienzusammenführung und Migration ist eine religiöse Heterogenität entstanden, die einen Dialog zwischen den Kulturen in der Schule notwendig macht.
Was war das Ziel des muttersprachlichen Ergänzungsunterrichts?
Ursprünglich sollte er die Rückkehrfähigkeit der Kinder in ihre Herkunftsländer erhalten, ohne Bezug zum restlichen deutschen Curriculum.
Welche Rolle spielt die Heterogenität in dieser Arbeit?
Die Arbeit zeigt auf, dass Heterogenität schon immer existierte, aber erst durch die Migration der 70er Jahre als pädagogische Herausforderung wahrgenommen wurde.
- Citar trabajo
- Eva Busch (Autor), 2003, Interreligiöser Unterricht in Brandenburg und Hessen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14723