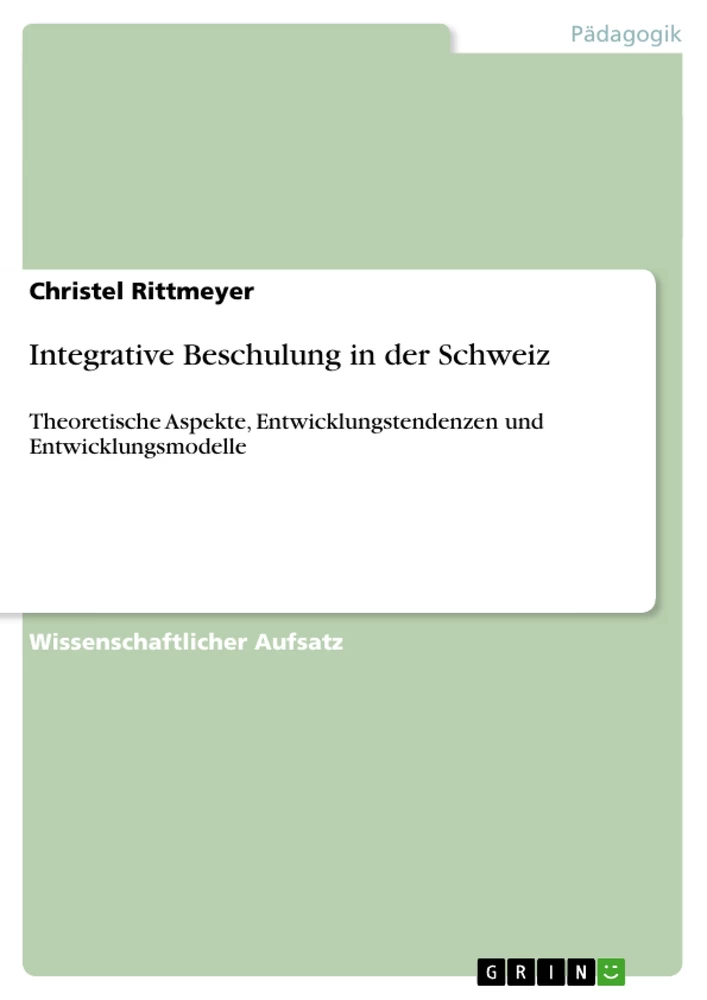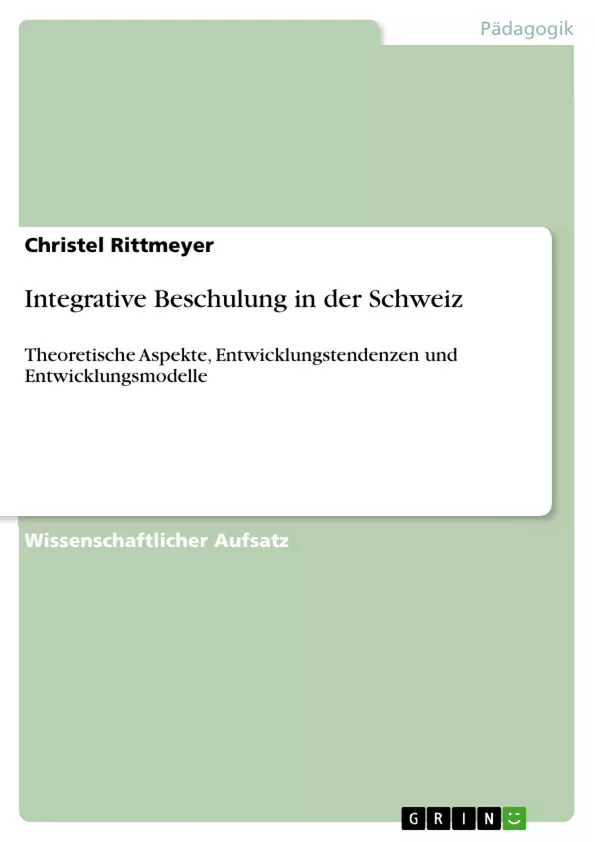Es wird gezeigt, dass es neben den Arbeiten der in der wissenschaftlichen Fachöffentlichkeit bekannten Autoren Haeberlin und Bächtold aus den 90er Jahren auch in der Gegenwart eine Reihe von Schweizer Wissenschaftlern oder hier tätigen Wissenschaftlern gibt, die wichtige Beiträge zur Auseinandersetzung mit dem Terminus Integration und Inklusion geleistet haben und zu diesem Themenbereich forschen: insbesondere Bless, Strasser und Hoyningen-Süess sowie Liesen.
Wie in Deutschland ist in der Schweiz - offenbar noch akzentuierter - eine zweigleisige und in sich gegenläufige Entwicklung festzustellen: neben integrativer Beschulung nimmt die Zahl der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu.
Außerdem geht es in diesem Beitrag um die soziale Position von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten und sozial-emotionalem Förderbedarf in integrativen Zusammenhängen. Es wird dargelegt, dass sie weiterhin unbefriedigend ist und wie Strategien der Verbesserung aussehen könnten.
Abschließend wird auf aktuelle Formen des gemeinsamen Unterrichts in der Schweiz eingegangen und kurz das Kaskadenmodell beschrieben, das zukünftig noch mehr Beachtung nicht nur in der Schweiz finden sollte und von daher einen hohen Anregungscharakter haben könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überblick
- Zur Terminologie: Was bedeutet „Integrative Pädagogik“?
- Warum „Integration“?
- Erforschte Wirkungen der Integration
- Inklusive Pädagogik ist Annedore PRENGEL zufolge durch ein Menschenbild der Gleichheit und Freiheit im Sinne der internationalen Menschenrechte verpflichtet.
- Lösungsstrategien für Probleme bei der Integration (Literaturbeiträge)
- Schüler mit Beeinträchtigungen im Lernen
- Forschungsbeiträge zur Förderung von Schülern mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Beitrag bietet einen umfassenden Überblick über die integrative Beschulung in der Schweiz. Er beleuchtet die theoretischen Aspekte, die Entwicklungstendenzen und Entwicklungsmodelle, die in diesem Kontext relevant sind.
- Abgrenzung der Begriffe „Integration“ und „Inklusion“
- Begründung und wissenschaftliche Fundierung integrativer Pädagogik
- Herausforderungen und Lösungsstrategien bei der Integration von Schülern mit Lernschwierigkeiten und emotionalen und sozialen Entwicklungsproblemen
- Aktuelle Entwicklungen der schulischen Integration in der Schweiz
- Das Kaskadenmodell als relevantes Beispiel für zukünftige Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Relevanz von Integration und Inklusion in europäischen Staaten dar und hebt die Besonderheiten der Schweizer Situation hervor.
- Der Überblick gibt einen kompakten Einblick in die wichtigsten Themen des Beitrags, von der Terminologie bis hin zu den aktuellen Entwicklungen.
- Das Kapitel „Zur Terminologie: Was bedeutet „Integrative Pädagogik“?“ definiert die zentralen Begriffe „Integration“ und „Inklusion“ und diskutiert deren Bedeutung im Kontext der Schweizer Bildungslandschaft.
- Das Kapitel „Warum „Integration“?“ präsentiert die ethischen und wissenschaftlichen Argumente für integrative Pädagogik und beleuchtet die relevanten Forschungsergebnisse.
- Das Kapitel „Erforschte Wirkungen der Integration“ analysiert die positiven und negativen Auswirkungen von Integration auf die Schüler, Eltern und Lehrkräfte.
- Das Kapitel „Inklusive Pädagogik ist Annedore PRENGEL zufolge durch ein Menschenbild der Gleichheit und Freiheit im Sinne der internationalen Menschenrechte verpflichtet.“ stellt die philosophischen Grundlagen inklusiver Pädagogik dar und diskutiert die Bedeutung von Gleichheit und Freiheit.
- Das Kapitel „Lösungsstrategien für Probleme bei der Integration (Literaturbeiträge)“ beleuchtet die Herausforderungen bei der Integration von Schülern mit Lernschwierigkeiten und emotionalen und sozialen Entwicklungsproblemen und präsentiert Lösungsansätze aus der Literatur.
- Das Kapitel „Schüler mit Beeinträchtigungen im Lernen“ fokussiert auf die Schwierigkeiten, die Schüler mit Lernschwierigkeiten im integrativen Unterricht erleben, und diskutiert die Ursachen und möglichen Lösungsansätze.
- Das Kapitel „Forschungsbeiträge zur Förderung von Schülern mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung“ untersucht die Herausforderungen und Fördermöglichkeiten für Schüler mit emotionalen und sozialen Entwicklungsproblemen im integrativen Unterricht.
Schlüsselwörter
Integrative Pädagogik, Inklusive Pädagogik, Schweiz, Schulsystem, Behinderung, Lernschwierigkeiten, Emotionale und soziale Entwicklung, Forschungsergebnisse, Lösungsstrategien, Kaskadenmodell, Gleichheit, Freiheit, Menschenrechte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Inklusion?
Integration bedeutet die Eingliederung von Kindern mit Förderbedarf in bestehende Strukturen. Inklusion geht weiter und fordert ein Schulsystem, das von vornherein auf die Vielfalt aller Schüler ausgelegt ist.
Wie ist der Stand der integrativen Beschulung in der Schweiz?
In der Schweiz gibt es eine starke Bewegung hin zur integrativen Schule, wobei gleichzeitig die Zahl der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zunimmt.
Was beschreibt das Kaskadenmodell in der Sonderpädagogik?
Das Modell sieht verschiedene Stufen der Unterstützung vor – von der Regelschule mit ambulanter Hilfe bis hin zur Sonderschule als letzte Instanz.
Welche Probleme haben Schüler mit Lernschwierigkeiten in integrativen Klassen?
Oft ist ihre soziale Position innerhalb der Klasse unbefriedigend, was gezielte Strategien zur Verbesserung der sozialen Interaktion und Akzeptanz erfordert.
Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es zur Wirkung von Integration?
Forschungen (z.B. von Bless oder Liesen) zeigen differenzierte Ergebnisse zur Wirksamkeit auf die Lernleistung und die sozial-emotionale Entwicklung der Kinder.
- Quote paper
- Apl. Professor Dr. Christel Rittmeyer (Author), 2010, Integrative Beschulung in der Schweiz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147547