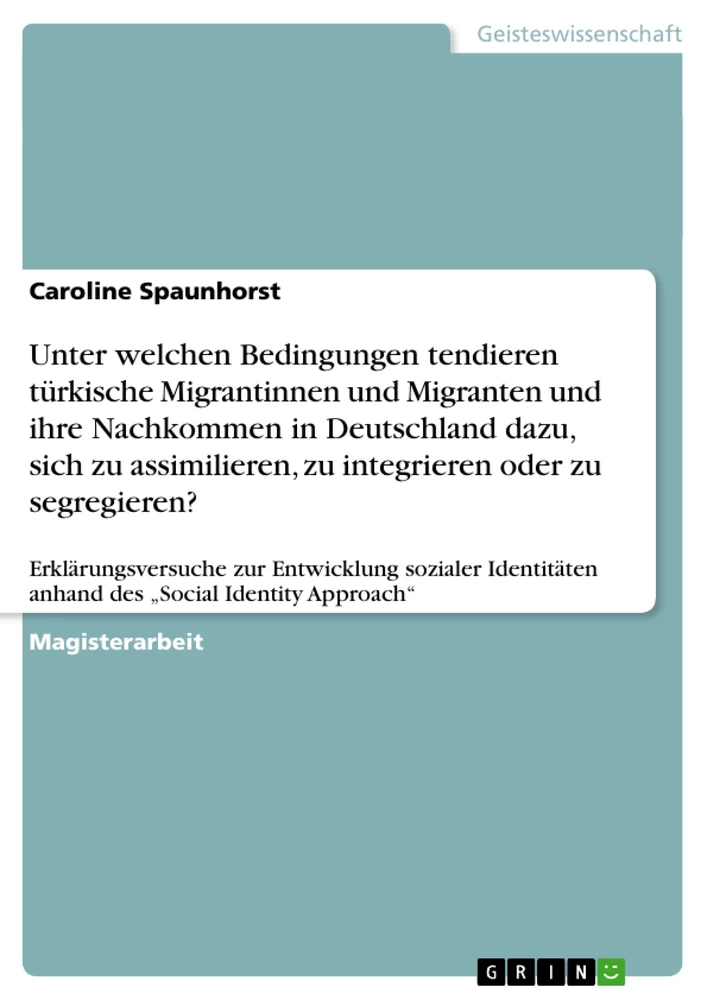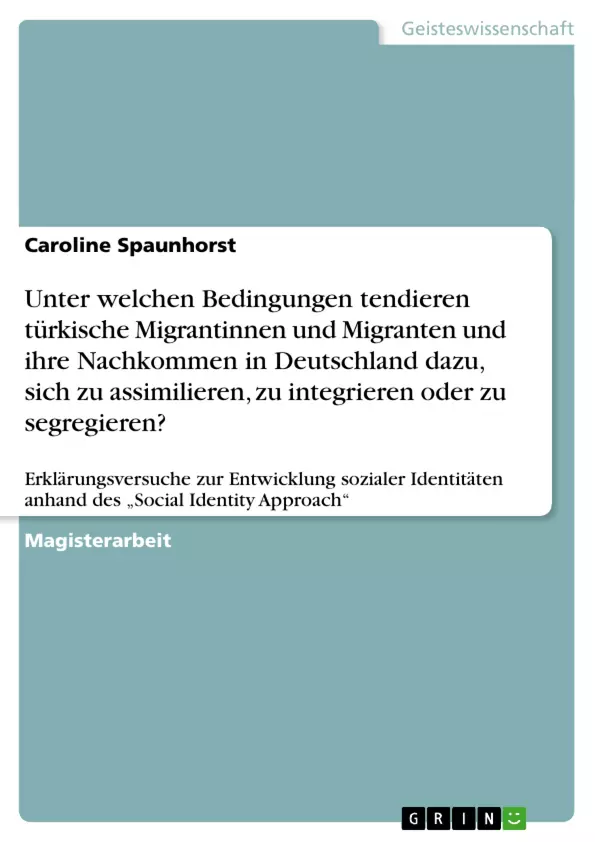„Unter welchen Bedingungen tendieren türkische Migrantinnen und Migranten dazu, sich zu assimilieren, zu integrieren oder zu segregieren?
Erklärungsversuche zur Entwicklung sozialer Identitäten anhand des
,Social Identity Approach‘.“
Es werden aus sozialpsychologischer Sicht die konkreten Bedingungen untersucht, die bei türkischen Migrantinnen und Migranten und ihren Nachkommen in Deutschland zur
Assimilation, Integration oder Segregation führen. Dazu wird zuerst die soziostrukturelle Situation der türkischstämmigen Menschen in Deutschland beschrieben, die dann später mit dem zuvor erläuterten „Social Identity Approach“ verknüpft wird. Die Situation zwischen der türkischen und der deutschen Gruppe wird demnach als Intergruppensituation im sozialpsychologischen Sinne verstanden. Hierbei werden drei wesentliche Einflüsse beleuchtet: die Gruppe der Zuwanderer, die Gruppe der Aufnahmegesellschaft
und die zeitlichen und situativen Kontextbedingungen.
Es werden verschiedene qualitative und quantitative empirische Untersuchung herangezogen und auf Grundlage der Theorie diskutiert. Dabei wird deutlich, dass Assimilation für die türkischen Migrantinnen und Migranten in Deutschland eher selten möglich ist, während die Forderungen danach von Seiten der deutschen Gruppe steigen. Segregation zeigt sich dagegen eher
als Rückzug der inferioren türkischen Gruppe aus dem sozialen Vergleich mit der statushöheren deutschen Gruppe oder als ein Wechsel der Vergleichsdimension, z.B. durch Rückbesinnung auf die Religion. Als wesentliches Ergebnis lässt sich außerdem festhalten, dass ein großer Teil der türkischen Gruppe sich durch übergeordnete Kategorisierungen, so genannte duale Identitäten in die deutsche Gesellschaft integriert hat.
Die deutsche Mehrheitsgesellschaft versucht allerdings vielfach ihre superiore Position zu erhalten und zu stabilisieren. Dadurch werden Segregationsprozesse verstärkt und Integration verzögert. Es werden daher Empfehlungen aus verschieden Studien zusammen
getragen, die Intergruppenkonflikte verringern könnten und die Entwicklung dualer Identitäten begünstigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Soziostrukturelle Lebenslage von Türkinnen und Türken in Deutschland
- Familiäre Situation und Haushalt
- Bildungsbeteiligung
- Erwerbstätigkeit und Einkommen
- Wohnsituation
- Begriffliche Abgrenzung – Assimilation- Integration- Segregation
- Social Identity Approach
- Theorie der sozialen Identität
- Vorannahmen
- Theoretische Grundkonzepte
- Soziale Kategorisierung
- Soziale Identität
- Soziale Vergleichsprozesse
- Positive Distinktheit
- Erlangung und Erhaltung positiver sozialer Identität
- Individuelle Mobilität
- Sozialer Wettbewerb
- Soziale Kreativität
- Selbstkategorisierungstheorie
- Personale und soziale Identität
- Selbstkategorisierung und Depersonalisierung
- Salienz von Selbstkategorisierungen
- Theorie der sozialen Identität
- Soziale Identitäten von Türkinnen und Türken in Deutschland
- Bedingungen für Assimilation
- Legitimität, Stabilität und Durchlässigkeit
- Selbstkategorisierung und Kontext
- Individuelle Mobilität
- Verhalten der Mehrheitsgesellschaft
- Bedingungen für Segregation
- Legitimität, Stabilität und Durchlässigkeit
- Selbstkategorisierung und Kontext
- Sozialer Wettbewerb und Rückzug in die eigene Ethnie
- Verhalten der Mehrheitsgesellschaft
- Bedingungen für Integration
- Legitimität, Stabilität und Durchlässigkeit
- Selbstkategorisierung und Kontext
- Sozialer Wandel, soziale Kreativität und duale Identität
- Verhalten der Mehrheitsgesellschaft
- Bedingungen für Assimilation
- Grenzen und kritische Zusammenfassung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Abstract EMPTY_________
- Abbildungen
- Abbildung 1: Akkulturationsmodell nach Berry (Bourhis, Moise, Perreault & Senécal, 1997, S.90, Änderung v. Verf.)
- Abbildung 2: Soziale Identität als vermittelnder sozialpsychologischer Prozess (Simon & Trötschel, 2006, S.691)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit der Frage, unter welchen Bedingungen türkische Migrantinnen und Migranten sowie ihre Nachkommen in Deutschland dazu tendieren, sich zu assimilieren, zu integrieren oder zu segregieren. Die Arbeit analysiert die Entwicklung sozialer Identitäten anhand des „Social Identity Approach“, einem sozialpsychologischen Theorieansatz, der die Intergruppenbeziehung zwischen Deutschen und Türken als Grundlage für die Akkulturationsorientierungen betrachtet.
- Soziostrukturelle Lebenslage von Türkinnen und Türken in Deutschland
- Begriffliche Abgrenzung von Assimilation, Integration und Segregation
- Der „Social Identity Approach“ als Erklärungsrahmen
- Bedingungen für Assimilation, Segregation und Integration aus sozialpsychologischer Sicht
- Grenzen und kritische Zusammenfassung der Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet die soziostrukturelle Lebenslage von Türkinnen und Türken in Deutschland anhand statistischer Daten und empirischer Untersuchungen. Es werden die familiäre Situation, die Bildungsbeteiligung, die Erwerbstätigkeit, das Einkommen und die Wohnsituation der türkischen Bevölkerung im Vergleich zur deutschen Bevölkerung dargestellt, um auf problematische Strukturen der Benachteiligung aufmerksam zu machen.
Kapitel 3 definiert die Begriffe „Assimilation“, „Segregation“ und „Integration“ für die vorliegende Arbeit, da sie in der Literatur nicht immer einheitlich verwendet werden.
Kapitel 4 stellt die theoretischen Grundlagen des „Social Identity Approach“ dar, der sich aus der „Theorie der sozialen Identität“ und der „Selbstkategorisierungstheorie“ zusammensetzt. Dieser Ansatz wird als Erklärungsrahmen für die Entwicklung sozialer Identitäten von Türkinnen und Türken in Deutschland herangezogen.
Kapitel 5 verknüpft die soziostrukturelle Situation mit dem „Social Identity Approach“ und verschiedenen wissenschaftlichen Befunden. Es werden die Bedingungen für Assimilation, Segregation und Integration aus der Perspektive der Zuwanderer, der zeitlichen und situativen Kontextbedingungen sowie der Mehrheitsgesellschaft beleuchtet.
Kapitel 6 fasst die Erkenntnisse und Empfehlungen aus der Arbeit kritisch zusammen und verdeutlicht die Grenzen der Erklärungskraft des sozialpsychologischen Zugangs.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die soziale Identität, den „Social Identity Approach“, die Akkulturationsorientierungen Assimilation, Integration und Segregation, die Intergruppenbeziehung zwischen Deutschen und Türken, die soziostrukturelle Lebenslage von Türkinnen und Türken in Deutschland, die Selbstkategorisierungstheorie, die Legitimität, Stabilität und Durchlässigkeit von sozialen Strukturen, den sozialen Wettbewerb, die soziale Kreativität und das Verhalten der Mehrheitsgesellschaft.
- Quote paper
- Caroline Spaunhorst (Author), 2009, Unter welchen Bedingungen tendieren türkische Migrantinnen und Migranten und ihre Nachkommen in Deutschland dazu, sich zu assimilieren, zu integrieren oder zu segregieren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148123