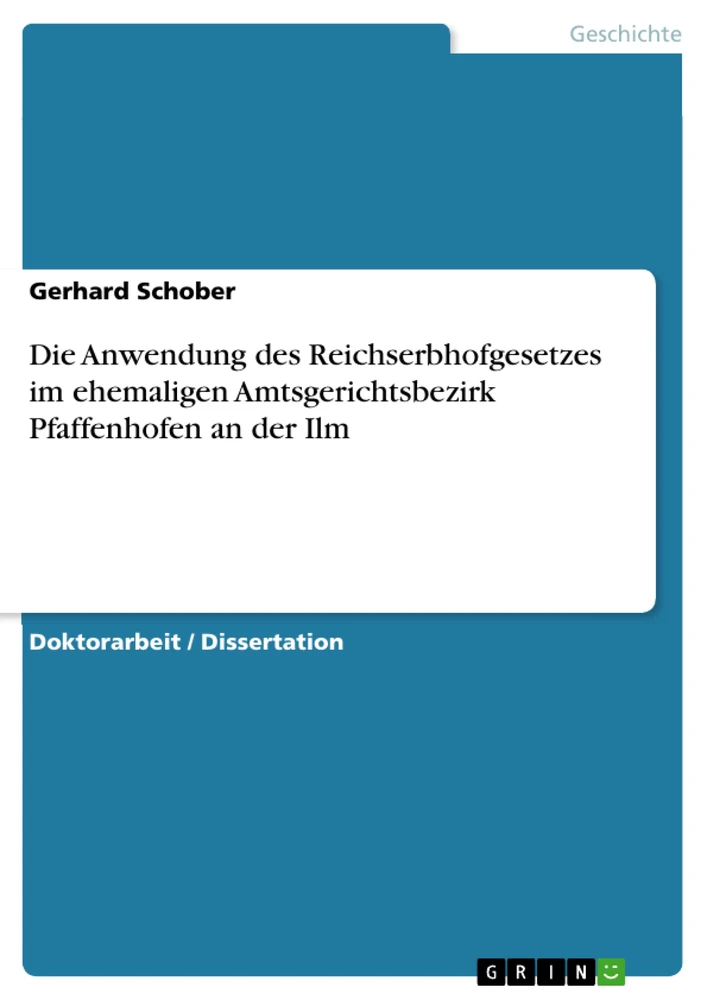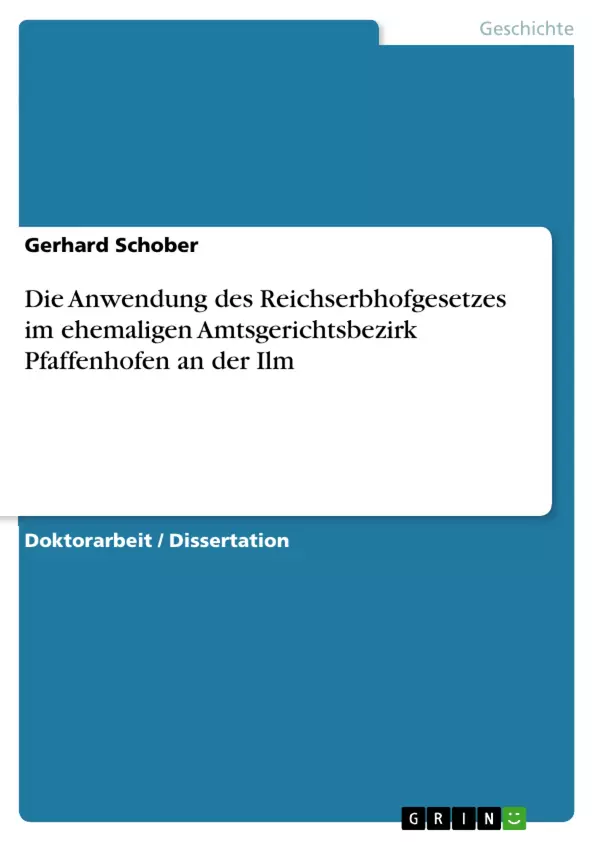Diese Doktorarbeit behandelt die Anwendung des Reichserbhofgesetzes im ehemaligen Amtsgerichtsbezirk Pfaffenhofen an der Ilm.
Die unmittelbar nach dem Beginn der NS-Herrschaft einsetzende nationalsozialistische "Rassenpolitik" beruhte auf dem Gedankengang Hitlers, dass die Blutsmischung die alleinige Ursache des Absterbens alter Kulturen sei. "Die Blutsmischung und das dadurch bedingte Senken des Rassenniveaus ist die alleinige Ursache des Absterbens alter Kulturen; denn die Menschen gehen nicht an verlorenen Kriegen zugrunde, sondern am Verlust jener Widerstandskraft, die nur dem reinen Blute zu eigen ist."
Um die Qualität des deutschen Erbgutes zu verbessern, sollte deshalb eine Steigerung der eigenen Rassenqualität durch eine "Aufzüchtung" (bzw. "Aufnordung") geplant. Für diese Aufgabe schien den Nationalsozialisten der geburtenstarke Bauernstand prädestiniert. Denn "die Bevölkerung auf dem Land ist...durchweg gesünder, kräftiger und noch kaum durch artfremdes Blut verdorben."
Zur Umsetzung der Wiederaufzucht sollten die germanischen Bauern auf sog. Erbhöfen "erbgesunden" Nachwuchs aus ihrem „noch unbefleckten Erbgut“ hervorbringen, um ihn an die übrige Bevölkerung abzugeben und so der angestrebten "Aufordnung” Schritt für Schritt näher zu kommen. "Der Blutsstrom steigt [nämlich] vom Lande auf und fließt in die Stadt, nicht umgekehrt, und wer also die Quelle reinigt, schafft auch in der Stadt mittelbare Blutsbereinigung."
Seine rechtliche Grundlage fand dieses Vorhaben in dem bereits Ende September 1933 verabschiedeten Reichserbhofgesetz (REG). Wegen seiner Ausrichtung verwundert es nicht, dass es unter allen agrarpolitischen Maßnahmen des NS-Staates als das am stärksten ideologisch geprägte Gesetz gilt. Um so interessanter ist es, wie die handelnden Personen vor Ort mit der neuartigen Regelung umgingen. Folgten sie den ideologisch bedingten Vorgaben oder ließen sie sich von anderen Motiven leiten. Die vorliegende Studie macht es sich deshalb zur Aufgabe, die Handhabung des REG durch die ausführenden Organe d.h. die Gerichte und den Reichsnährstand in einem überschaubaren Bereich darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel I: Die NSDAP auf „Bauernfang“
- Die große Krise der deutschen Landwirtschaft am Ende der Weimarer Republik
- Die nationalsozialistische Bauernpolitik bis zur „Machtergreifung“
- Die landwirtschaftliche Struktur und das Wahlverhalten im Landkreis Pfaffenhofen/Ilm 1928 – 1933
- Kapitel II: Durchsetzung nationalsozialistischer Agrarpolitik: Entschuldung, Reichsnährstand und Reichserbhofgesetz
- Das Gesetz zur Regelung der landwirtschaftlichen Schuldverhältnisse (Schuldenregelungsgesetz)
- Der Reichsnährstand
- Die ideengeschichtlichen Hintergründe des Erbhofkonzeptes
- Das Anerbenrecht und die bäuerliche Erbsitte unter besonderer Berücksichtigung Bayerns und des Landkreises Pfaffenhofen/Ilm
- Die Entwicklung des Anerbenrechts bis 1933
- Die Erbsitte in Bayern und im Landkreis Pfaffenhofen/Ilm
- Die Blut und Boden Ideologie
- Das Anerbenrecht und die bäuerliche Erbsitte unter besonderer Berücksichtigung Bayerns und des Landkreises Pfaffenhofen/Ilm
- Das Reichserbhofgesetz
- Das preußische Erbhofrecht als Vorläufer
- Das Reichserbhofgesetz vom 29. September 1933
- Das Reichserbhofgesetz im Verhältnis zum Bürgerlichen Gesetzbuch
- Das Reichserbhofgesetz als Kern eines neuen völkischen Privatrechts
- Der Erbhof als Teil des konkreten Ordnungsdenkens
- Die „Fortbildung“ des Reichserbhofgesetzes
- Das Anerbenrecht in Deutschland nach 1945
- Kapitel III: Die Anwendung des Reichserbhofgesetzes im ehemaligen Amtsgerichtsbezirk Pfaffenhofen/Ilm
- Die Bedeutung der erbhofrechtlichen Bestimmungen im untersuchten Gebiet
- Die Anlegungsverfahren
- Die Ersterfassung
- Die weiteren Anlegungsverfahren
- Bewertung der Anlegungsverfahren
- Gerichtsverfahren vor dem Anerbengericht Pfaffenhofen/Ilm
- Erbhofstatus
- Verfahren zur Streichung des Erbhofstatus
- Einspruchsverfahren
- Feststellungsverfahren
- Gründe für die Streichung des Erbhofstatus
- Verfahren zur Anerkennung des Erbhofstatus
- Einschätzung
- Verhältnis des Einspruchs- zum Feststellungsverfahren
- Schaffung von sippengebundenen Ehegattenerbhöfen
- Verfahren zur Streichung des Erbhofstatus
- Bodenmobilität
- Verkauf von Grundstücken
- An die öffentliche Hand
- An Privatpersonen
- Verkauf des gesamten Erbhofes
- Verpachtung/Pachtverlängerung
- Grundstückstausch
- Verkauf von Grundstücken
- Vererbung
- Die vorweggenommene Erbfolge
- Die gesetzliche Erbfolge
- Die Stellung der Altenteiler und weichenden Erben
- Altenteiler
- Weichende Erben
- Teilung des Erbhofes
- Versorgungsstreitigkeiten
- Anerbenbestimmung
- Belastungsverbot
- Sanktionen
- Treuhänderische Wirtschaftsführung
- Aberkennung der Bauernfähigkeit
- Erbhofstatus
- Einflussnahme von Seiten des Reichsnährstandes
- Einflussnahme seitens der NSDAP
- Reaktionen der Bauern auf das Reichserbhofgesetz
- Die Beschwerdeverfahren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen des nationalsozialistischen Reichserbhofgesetzes auf die Landwirtschaft im Landkreis Pfaffenhofen/Ilm. Ziel ist es, die Umsetzung der agrarpolitischen Maßnahmen der NSDAP auf lokaler Ebene zu analysieren und die Reaktionen der betroffenen Bauern zu beleuchten.
- Die landwirtschaftliche Krise in der Weimarer Republik
- Die nationalsozialistische Bauernpolitik und ihre Ideologie
- Die Umsetzung des Reichserbhofgesetzes im Landkreis Pfaffenhofen/Ilm
- Die Rechtspraxis des Anerbengerichts
- Die Reaktionen der Bauern auf das Reichserbhofgesetz
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I: Die NSDAP auf „Bauernfang“: Dieses Kapitel analysiert die wirtschaftliche Notlage der deutschen Landwirtschaft am Ende der Weimarer Republik und die Strategien der NSDAP, um die Bauernschaft für ihre Ideologie zu gewinnen. Es untersucht die nationalsozialistische Bauernpolitik vor der „Machtergreifung“ und die sozioökonomischen Faktoren, die das Wahlverhalten der Bauern im Landkreis Pfaffenhofen/Ilm beeinflussten. Die Analyse umfasst die Herausforderungen der Landwirtschaft und die propagandistischen Ansätze der NSDAP, um diese Schwierigkeiten zu ihrem Vorteil zu nutzen und Unterstützung unter den Bauern zu gewinnen.
Kapitel II: Durchsetzung nationalsozialistischer Agrarpolitik: Entschuldung, Reichsnährstand und Reichserbhofgesetz: Dieses Kapitel befasst sich mit der Durchsetzung der nationalsozialistischen Agrarpolitik nach der „Machtergreifung“, insbesondere mit dem Schuldenregelungsgesetz, dem Reichsnährstand und dem Reichserbhofgesetz. Es analysiert die ideengeschichtlichen Hintergründe des Erbhofkonzeptes, einschließlich des Anerbenrechts und der „Blut und Boden“-Ideologie, und untersucht die rechtlichen Aspekte des Reichserbhofgesetzes im Vergleich zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Das Kapitel beleuchtet die Entwicklung und die Ziele des Gesetzes und wie es im Kontext der nationalsozialistischen Ideologie einzuordnen ist.
Kapitel III: Die Anwendung des Reichserbhofgesetzes im ehemaligen Amtsgerichtsbezirk Pfaffenhofen/Ilm: Dieses Kapitel untersucht die praktische Anwendung des Reichserbhofgesetzes im Landkreis Pfaffenhofen/Ilm. Es analysiert die Anlegungsverfahren, die Gerichtsverfahren vor dem Anerbengericht, und die verschiedenen Aspekte der Bodenmobilität, Vererbung und die damit verbundenen rechtlichen Konflikte. Der Fokus liegt auf der Erörterung der Auswirkungen des Gesetzes auf die lokale Bevölkerung, auf die Rolle des Gerichts und die Reaktion der Bauern auf die neuen Bestimmungen. Es untersucht die verschiedenen Verfahren vor dem Gericht, die Sanktionen bei Verstößen und den Einfluss des Reichsnährstandes und der NSDAP auf die Umsetzung des Gesetzes.
Schlüsselwörter
Reichserbhofgesetz, NSDAP, Agrarpolitik, Landwirtschaft, Bauern, Landkreis Pfaffenhofen/Ilm, Anerbenrecht, Blut und Boden, Weimarer Republik, Reichsnährstand, Bodenmobilität, Rechtspraxis, Gerichtsverfahren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Die Auswirkungen des Reichserbhofgesetzes auf die Landwirtschaft im Landkreis Pfaffenhofen/Ilm"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen des nationalsozialistischen Reichserbhofgesetzes auf die Landwirtschaft im Landkreis Pfaffenhofen/Ilm. Sie analysiert die Umsetzung der agrarpolitischen Maßnahmen der NSDAP auf lokaler Ebene und beleuchtet die Reaktionen der betroffenen Bauern.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die landwirtschaftliche Krise in der Weimarer Republik, die nationalsozialistische Bauernpolitik und ihre Ideologie (inkl. "Blut und Boden"), die Umsetzung des Reichserbhofgesetzes im Landkreis Pfaffenhofen/Ilm, die Rechtspraxis des Anerbengerichts, und die Reaktionen der Bauern auf das Reichserbhofgesetz. Sie betrachtet auch die Rolle des Reichsnährstandes und der NSDAP bei der Umsetzung des Gesetzes.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Kapitel I: Die NSDAP auf „Bauernfang“: Analysiert die wirtschaftliche Notlage der deutschen Landwirtschaft und die Strategien der NSDAP, um die Bauernschaft zu gewinnen. Untersucht die nationalsozialistische Bauernpolitik vor 1933 und das Wahlverhalten der Bauern im Landkreis Pfaffenhofen/Ilm.
Kapitel II: Durchsetzung nationalsozialistischer Agrarpolitik: Entschuldung, Reichsnährstand und Reichserbhofgesetz: Behandelt die Durchsetzung der nationalsozialistischen Agrarpolitik nach 1933, insbesondere das Schuldenregelungsgesetz, den Reichsnährstand und das Reichserbhofgesetz. Analysiert die ideengeschichtlichen Hintergründe des Erbhofkonzeptes (Anerbenrecht, "Blut und Boden") und die rechtlichen Aspekte des Reichserbhofgesetzes.
Kapitel III: Die Anwendung des Reichserbhofgesetzes im ehemaligen Amtsgerichtsbezirk Pfaffenhofen/Ilm: Untersucht die praktische Anwendung des Reichserbhofgesetzes im Landkreis Pfaffenhofen/Ilm. Analysiert Anlegungsverfahren, Gerichtsverfahren vor dem Anerbengericht, Bodenmobilität, Vererbung und rechtliche Konflikte. Fokus liegt auf den Auswirkungen des Gesetzes auf die lokale Bevölkerung, der Rolle des Gerichts und der Reaktion der Bauern.
Was sind die zentralen Fragestellungen der Arbeit?
Die Arbeit versucht zu beantworten, wie das Reichserbhofgesetz konkret im Landkreis Pfaffenhofen/Ilm umgesetzt wurde, welche Auswirkungen es auf die lokale Landwirtschaft und die Bauern hatte, und wie die Bauern auf die neuen Bestimmungen reagierten. Sie untersucht auch den Einfluss von NSDAP und Reichsnährstand auf die Umsetzung des Gesetzes.
Welche Quellen wurden für die Arbeit verwendet?
Die genaue Quellenangabe ist nicht im bereitgestellten HTML-Code enthalten. Diese Information müsste aus dem vollständigen Dokument entnommen werden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Reichserbhofgesetz, NSDAP, Agrarpolitik, Landwirtschaft, Bauern, Landkreis Pfaffenhofen/Ilm, Anerbenrecht, Blut und Boden, Weimarer Republik, Reichsnährstand, Bodenmobilität, Rechtspraxis, Gerichtsverfahren.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Historiker und Studenten, die sich mit der Agrargeschichte des Nationalsozialismus, der Rechtsgeschichte und der lokalen Geschichte des Landkreises Pfaffenhofen/Ilm beschäftigen.
- Quote paper
- Gerhard Schober (Author), 2007, Die Anwendung des Reichserbhofgesetzes im ehemaligen Amtsgerichtsbezirk Pfaffenhofen an der Ilm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1485195