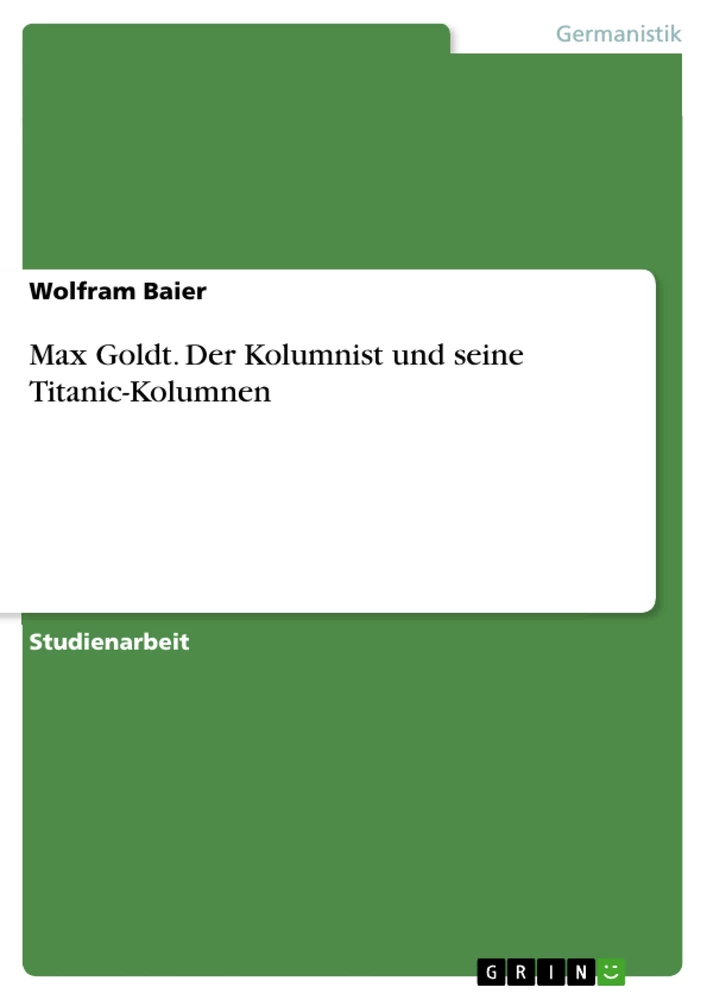Max Goldt gehört zu der Autorengeneration, die nach dem 2. Weltkrieg und nach dem Wirtschaftswunder aufgewachsen sind. Von einem Berliner Lokalautor in den 1980er Jahren, mit Texten in der Szenezeitschrift Ich und mein Staubsauger und im Kleinstverlag a-verbal herausgegebenen Büchern, wird er vom Literaturbetrieb seit 1990 zum Kultautor, Helden der Subkultur oder Szeneschriftsteller emporkritisiert und findet Eingang in den Feuilletons und Kulturteilen von FAZ, Die Zeit oder Süddeutsche Zeitung.
In dieser Arbeit werden der Kolumnist Max Goldt, seine Kolumnen und die Rezeption vorgestellt. Hauptgegenstand meiner Untersuchung sind seine Titanic-Kolumnen aus den Jahren 1989 bis 1998.
Im zweiten Kapitel werde ich die Person Max Goldt kurz vorstellen.
Kapitel 3.1. gibt einen Überblick über die Merkmale und Stilelemente seiner Texte, in 3.2. behandele ich die Stellung des Autors und den Gestus des Kolumnisten-Ich. Der Abschnitt 3.3. befaßt sich mit den Absichten Goldts und den Funktionen der Kolumnen.
In Kapitel 4 werden chronologisch Auszüge aus ausgesuchten Rezensionen und Kritiken u.a. aus Der Spiegel, taz und Die Zeit angeführt, mit einem besonderen Augenmerk auf die Artikel und Aufsätze, die dem Autor einerseits Risikoscheue, andererseits zu harte Urteile vorwerfen.
Inhaltsverzeichnis
- Einstieg
- Wer ist Max Goldt?
- Der Kolumnist und seine Kolumnen
- Merkmale und Stilelemente
- Stellung des Autors und Gestus des Kolumnisten-Ich
- Funktionen und Absichten
- Rezeption und Kritik
- Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Kolumnisten Max Goldt, seinen Kolumnen und der Rezeption seiner Werke. Der Fokus liegt auf den Titanic-Kolumnen aus den Jahren 1989 bis 1998. Die Arbeit analysiert die Merkmale und Stilelemente von Goldts Texten, untersucht die Position des Autors und den Gestus des Kolumnisten-Ichs und beleuchtet die Absichten und Funktionen der Kolumnen. Darüber hinaus werden Rezensionen und Kritiken von Goldts Werk im zeitlichen Verlauf betrachtet, insbesondere Artikel, die dem Autor sowohl Risikoscheue als auch zu harte Urteile vorwerfen.
- Max Goldt als Kultautor und seine Entwicklung vom Lokalautor zum Helden der Subkultur
- Merkmale und Stilelemente von Goldts Kolumnen: Temporeich, schlagfertig, wechselhaft, mit Elementen aus der Popkultur
- Der Gestus des Kolumnisten-Ichs und die Position des Autors in seinen Texten
- Die Absichten und Funktionen von Goldts Kolumnen: Gesellschaftskritik, Humor, Alltagsbeobachtung
- Rezeption und Kritik an Goldts Werk: Risikoscheue, zu harte Urteile, Einordnung in das Genre der Kolumne
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Arbeit ein und stellt die Forschungsfrage vor. Im zweiten Kapitel wird Max Goldt als Person vorgestellt, seine Entwicklung vom Lokalautor zum Kultautor wird nachgezeichnet. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit Goldts Kolumnen. Hier werden die Merkmale und Stilelemente seiner Texte, die Stellung des Autors und der Gestus des Kolumnisten-Ichs sowie die Funktionen und Absichten der Kolumnen beleuchtet. Kapitel vier analysiert die Rezeption und Kritik von Goldts Werk im zeitlichen Verlauf.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: Max Goldt, Kolumne, Satire, Popkultur, Gesellschaftskritik, Humor, Rezeption, Kritik, Literaturbetrieb, Titanic-Kolumnen.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist Max Goldt?
Max Goldt ist ein deutscher Schriftsteller und Kolumnist, der in den 1990er Jahren vom Berliner Szeneschriftsteller zum Kultautor des Feuilletons aufstieg.
Was zeichnet Goldts Titanic-Kolumnen aus?
Seine Texte sind bekannt für Sprachwitz, scharfe Alltagsbeobachtungen, Stilelemente der Popkultur und einen oft wechselhaften, temporeichen Gestus.
Welche Absichten verfolgt Goldt mit seinen Texten?
Goldt nutzt die Kolumne für humorvolle Gesellschaftskritik und zur Reflexion über Sprache und menschliche Verhaltensweisen.
Wie reagierte die Kritik auf sein Werk?
Die Rezeption ist gespalten: Während viele ihn als Genie der Subkultur feiern, werfen ihm andere Rezensenten gelegentlich Risikoscheue oder zu harte Urteile vor.
In welchen Zeitungen wurden Goldts Texte besprochen?
Seine Werke fanden Eingang in renommierte Medien wie die FAZ, Die Zeit, die Süddeutsche Zeitung, den Spiegel und die taz.
- Citar trabajo
- Wolfram Baier (Autor), 2000, Max Goldt. Der Kolumnist und seine Titanic-Kolumnen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1486