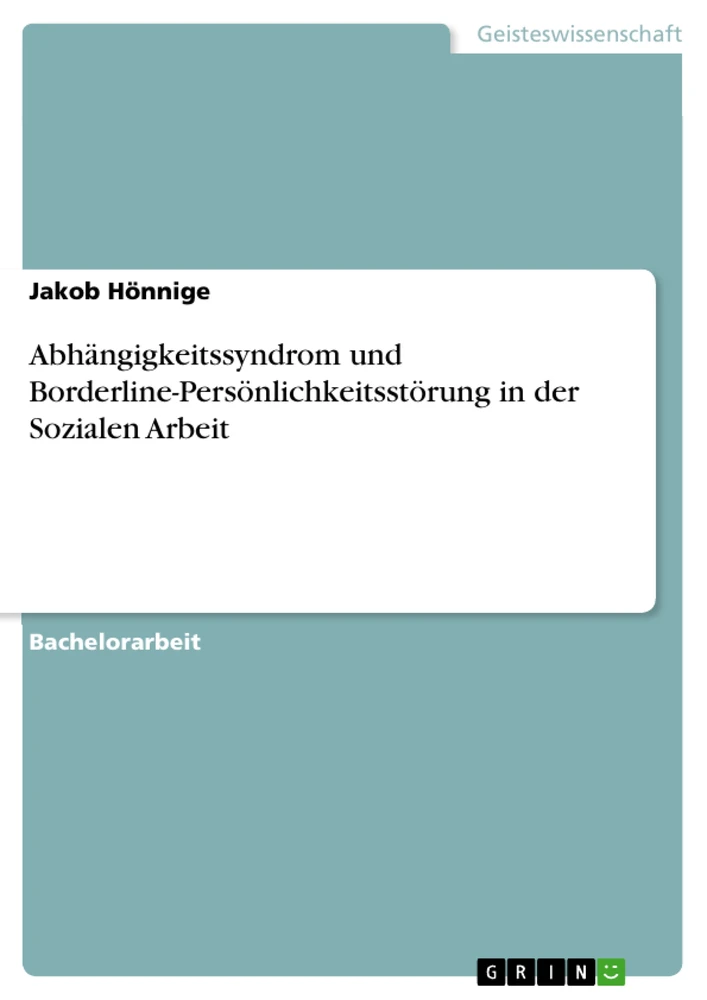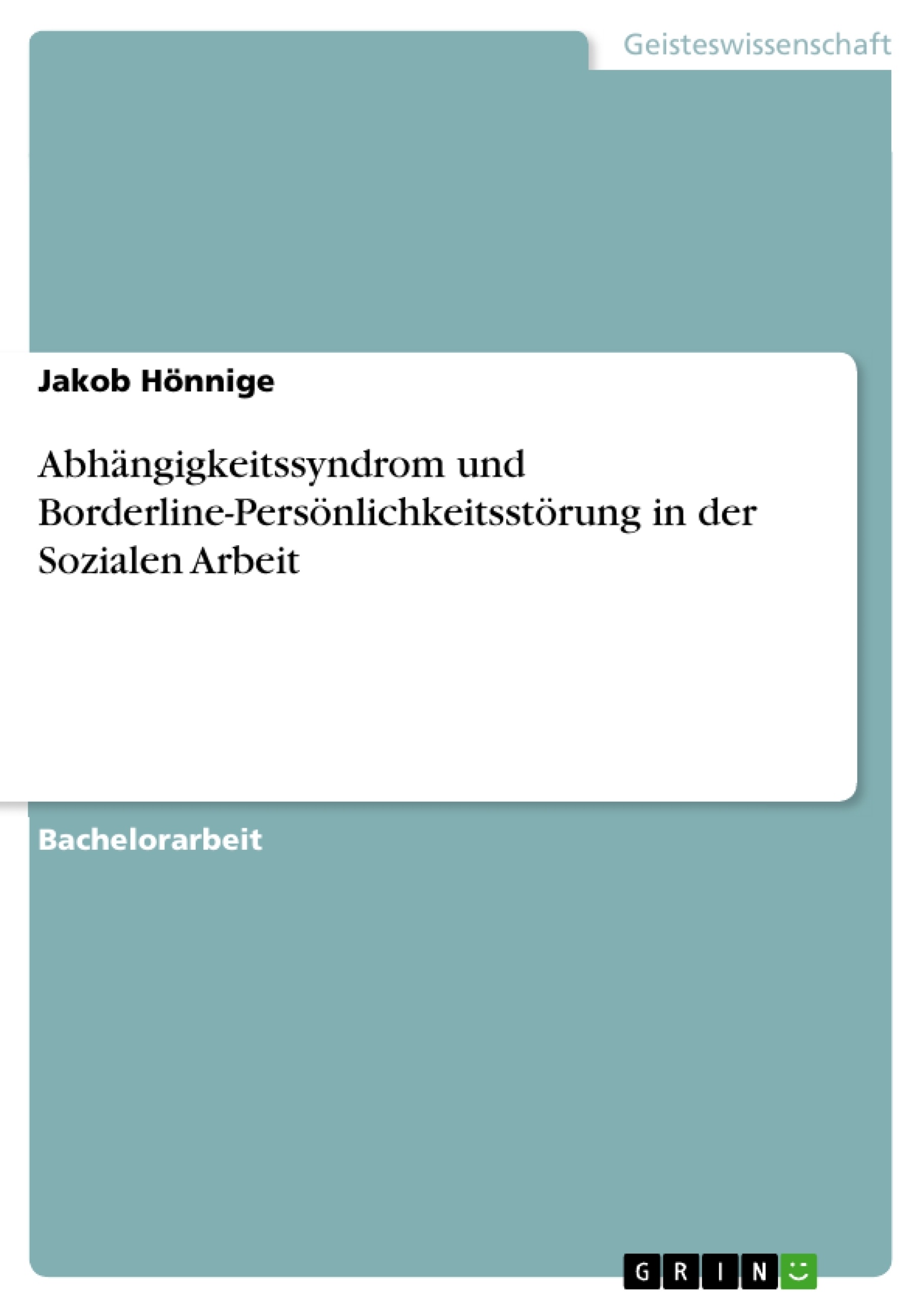Die Zielsetzung dieser Arbeit ist die Heranführung der Sozialen Arbeit an das Krankheitsbild der Doppeldiagnose sowie der Sensibilisierung gegenüber dieser.
Weitergehend ist das Ziel der vorliegenden Arbeit, mögliche sozialarbeiterische Methoden beziehungsweise Handlungsempfehlungen zu erarbeiten, die sich innerhalb der Profession wieder finden. Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet dahingehend: „Welche Handlungsmöglichkeiten bieten sich der Sozialen Arbeit in der Praxis mit Doppeldiagnose Patient*innen die unter einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden?“
„Herr B., der Mitte der Siebzigerjahre geboren wurde, wuchs als einziges Kind bei seiner Mutter und deren Eltern in Hessen auf. Herr B. hat keine Berufsausbildung absolviert. Er sei nach Schulende zu Hause "rausgeflogen". Danach habe er mehr als ein Jahrzehnt wechselnd auf der Straße, in eigener Wohnung oder in Einrichtungen der Jugendfürsorge verbracht. Später in Süddeutschland habe er teils auf der Straße, teils in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, teils in Einrichtungen für Menschen mit psychischen Störungen gelebt. Dabei wurde eine Schizophrenia Simplex diagnostiziert, daneben in der Vorgeschichte Alkohol- und weitere Substanzabhängigkeiten, weiterhin eine antisoziale Persönlichkeitsstörung.“ Der Krankheitsverlauf und die Biografie des Betroffenen B. spiegelt die häufige Lebensrealität von Personen mit einer Doppeldiagnose und deren massiven Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen.
Der beschriebene Fall des Betroffenen B. ist dabei charakteristisch für die möglichen Situationen von Doppeldiagnose Patient*innen. Die Problembereiche erstrecken sich in fast alle Lebensbereiche der Betroffenen sowie deren Angehörigen. Die erkrankten Personen weißen oft problematische Beziehungen zu ihrem Umfeld auf und sind von Armut bedroht. In vielen Fällen führt diese Dynamik zu einer gesetzlichen Auffälligkeit der Betroffenen. Durch die häufig starken Konsummuster leidet die Gesundheit der Erkrankten längerfristig.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theorie
- 2.1 Abhängigkeitssyndrom
- 2.1.1 Definition
- 2.1.2 Klassifikation
- 2.1.3 Substanzgebundene Süchte
- 2.1.4 Substanzungebundene Süchte
- 2.1.5 Ätiologie
- 2.2 Borderline-Persönlichkeitsstörung
- 2.2.1 Störungsbild
- 2.2.2 Klassifikation
- 2.2.3 Epidemiologie
- 2.2.4 Ätiologie Borderline Persönlichkeitsstörung
- 2.2.5 Kognitive Theorie
- 2.2.6 Skillstraining
- 2.2.7 Schwierigkeiten und Probleme
- 2.3 Doppeldiagnose
- 2.3.1 Definition
- 2.3.2 Klassifikation
- 2.3.3 Epidemiologie
- 2.3.4 Differenzialdiagnose
- 2.3.5 Ätiologie
- 2.3.6 Komorbidität von Borderline-Persönlichkeits- und Substanzstörung
- 2.3.7 Lebenssituationen
- 2.1 Abhängigkeitssyndrom
- 3 Handlungsweise der Sozialen Arbeit
- 3.1 Grundlagen des Case Management
- 3.1.1 Geschichte des Case Management
- 3.1.2 Case Manager*in
- 3.1.3 Phasen des Case Managements
- 3.1.4 Risiken des Case Management
- 3.1.4 Interprofessionelle Zusammenarbeit
- 4 Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit im Umgang mit Menschen, die gleichzeitig von einer Abhängigkeitserkrankung und einer Borderline-Persönlichkeitsstörung betroffen sind (Doppeldiagnose). Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Doppeldiagnose zu entwickeln und daraus resultierende Handlungsempfehlungen für die Soziale Arbeit abzuleiten.
- Definition und Klassifikation von Abhängigkeitssyndrom und Borderline-Persönlichkeitsstörung
- Epidemiologie und Ätiologie von Doppeldiagnosen
- Komorbidität von Abhängigkeitserkrankungen und Borderline-Persönlichkeitsstörungen
- Möglichkeiten und Grenzen des Case Managements in der Sozialen Arbeit
- Interprofessionelle Zusammenarbeit bei der Betreuung von Menschen mit Doppeldiagnose
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung präsentiert den Fall eines Betroffenen mit Doppeldiagnose, um die Problematik und die weitreichenden Auswirkungen auf den Alltag der Betroffenen und deren Angehörigen zu veranschaulichen. Sie führt in das Thema Doppeldiagnose ein und hebt die Forschungslücke bezüglich empirischer Daten hervor.
2 Theorie: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über Abhängigkeitssyndrome und Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Es beschreibt Definitionen, Klassifikationen (ICD-10, DSM-V), Epidemiologie und Ätiologie unter Berücksichtigung verschiedener Modelle (bio-psycho-soziales Modell, lerntheoretische Modelle, kognitive Modelle, neurobiologische und genetische Ansätze). Besonders wird die Komorbidität beider Störungsbilder und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Betroffenen und ihr Umfeld detailliert dargestellt. Die Kapitelteile zu den einzelnen Störungsbildern liefern fundierte theoretische Grundlagen für das Verständnis der komplexen Interaktion von Abhängigkeit und Borderline-Persönlichkeitsstörung.
3 Handlungsweise der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rolle der Sozialen Arbeit im Umgang mit Menschen, die unter einer Doppeldiagnose leiden. Es erläutert die Grundlagen des Case Managements als ein wichtiges Instrument der Sozialen Arbeit, einschließlich seiner Geschichte, der Rolle des Case Managers, der Phasen des Case Managements und der damit verbundenen Risiken. Der Fokus liegt auf der interprofessionellen Zusammenarbeit als unerlässliche Komponente für eine erfolgreiche Betreuung und Unterstützung dieser Personengruppe.
Schlüsselwörter
Doppeldiagnose, Abhängigkeitssyndrom, Borderline-Persönlichkeitsstörung, Komorbidität, Soziale Arbeit, Case Management, Interprofessionelle Zusammenarbeit, Ätiologie, Epidemiologie, Behandlung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Doppeldiagnose - Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit im Umgang mit Menschen, die gleichzeitig an einer Abhängigkeitserkrankung und einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden (Doppeldiagnose). Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Doppeldiagnose zu entwickeln und daraus resultierende Handlungsempfehlungen für die Soziale Arbeit abzuleiten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Klassifikation von Abhängigkeitssyndrom und Borderline-Persönlichkeitsstörung, die Epidemiologie und Ätiologie von Doppeldiagnosen, die Komorbidität von Abhängigkeitserkrankungen und Borderline-Persönlichkeitsstörungen, die Möglichkeiten und Grenzen des Case Managements in der Sozialen Arbeit sowie die interprofessionelle Zusammenarbeit bei der Betreuung von Menschen mit Doppeldiagnose.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf theoretische Grundlagen zu Abhängigkeitssyndromen und Borderline-Persönlichkeitsstörungen, inklusive Definitionen, Klassifikationen (ICD-10, DSM-V), Epidemiologie und Ätiologie. Verschiedene Modelle werden berücksichtigt (bio-psycho-soziales Modell, lerntheoretische Modelle, kognitive Modelle, neurobiologische und genetische Ansätze). Die Komorbidität beider Störungsbilder und die daraus resultierenden Herausforderungen werden detailliert dargestellt.
Welche Rolle spielt das Case Management?
Die Arbeit erläutert die Grundlagen des Case Managements als wichtiges Instrument der Sozialen Arbeit im Umgang mit Menschen mit Doppeldiagnose. Es werden die Geschichte des Case Managements, die Rolle des Case Managers, die Phasen des Case Managements und die damit verbundenen Risiken beschrieben. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der interprofessionellen Zusammenarbeit für eine erfolgreiche Betreuung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Theoriekapitel (mit Unterkapiteln zu Abhängigkeitssyndrom, Borderline-Persönlichkeitsstörung und Doppeldiagnose), ein Kapitel zur Handlungsweise der Sozialen Arbeit (mit Schwerpunkt Case Management und interprofessioneller Zusammenarbeit) und eine Schlussfolgerung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Doppeldiagnose, Abhängigkeitssyndrom, Borderline-Persönlichkeitsstörung, Komorbidität, Soziale Arbeit, Case Management, Interprofessionelle Zusammenarbeit, Ätiologie, Epidemiologie, Behandlung.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse jedes Kapitels kurz und prägnant beschreibt.
Welche Forschungslücke wird angesprochen?
Die Einleitung der Arbeit hebt eine Forschungslücke bezüglich empirischer Daten zu Doppeldiagnosen hervor.
Wie wird die Problematik der Doppeldiagnose veranschaulicht?
Die Einleitung präsentiert den Fall eines Betroffenen mit Doppeldiagnose, um die Problematik und die weitreichenden Auswirkungen auf den Alltag der Betroffenen und deren Angehörigen zu veranschaulichen.
- Citar trabajo
- Jakob Hönnige (Autor), 2021, Abhängigkeitssyndrom und Borderline-Persönlichkeitsstörung in der Sozialen Arbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1488135