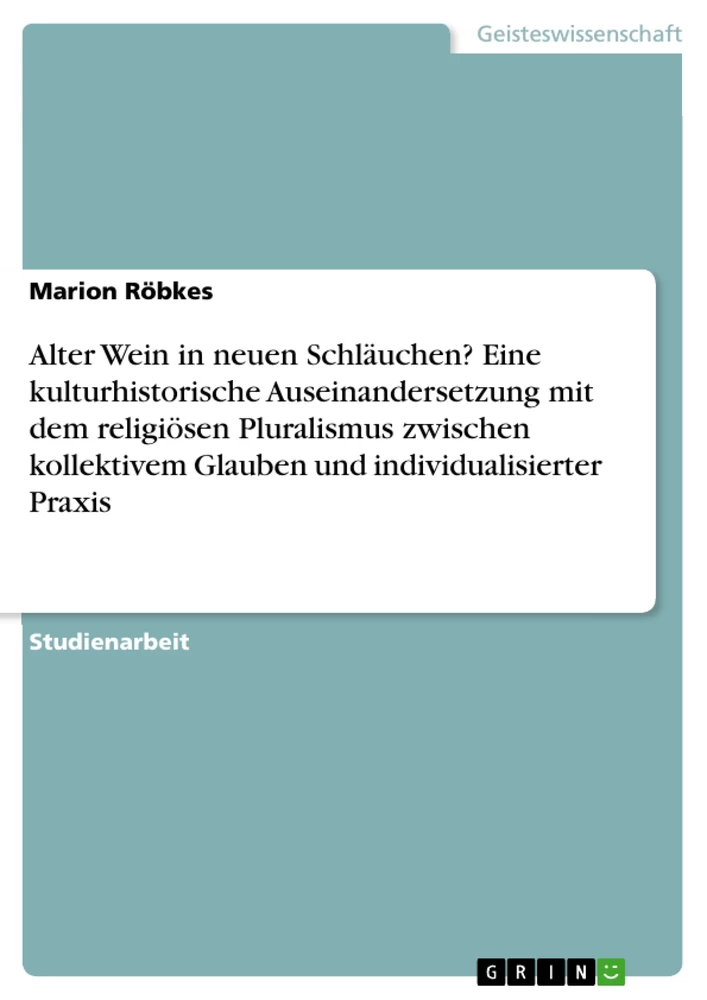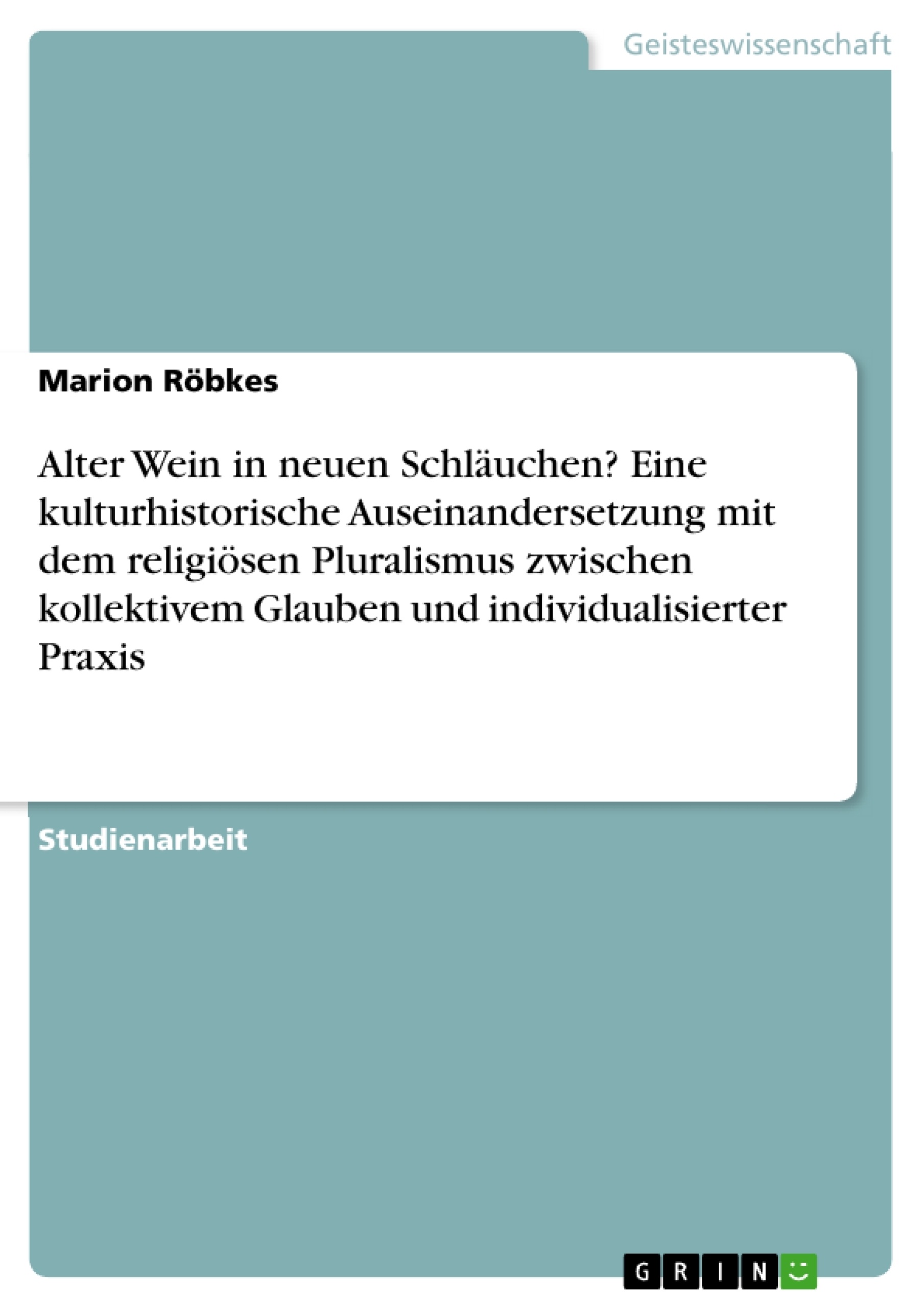Die unterschiedlichen Formen der Religion bzw. der Religiosität wurden in den vergangenen Jahrzehnten mit schlagkräftigen Begriffen belegt, wie z.B. 'unsichtbare Religion', 'Patchwork-Religion/-Religiosität', 'moderne/populäre Religion' und weitere mehr. Daneben behandeln zahlreiche Schriften diese Phänomene der Abwendung von den traditionellen Religionsformen und der Hinwendung zu 'neuen' Formen der Religionsausübung als diejenigen der 'postsäkularen' oder auch 'postkonfessionellen' Gesellschaft. Es stellt sich die Frage, ob ein solcher Blick nicht ungebührlich die Möglichkeit zur Transformation und Metamorphose des Religiösen in früheren Zeiten ausklammert. Zum einen wird die Phase der 'Aufklärung' dabei auf die Zeit nach der Renaissance reduziert, zum anderen Beschäftigung mit Religionskritik und Säkularisierung inhaltlich in die Zeit der letzten fünf Jahrhunderte verkürzt datiert. Seit der Antike liegen wissenschaftlich-naturkundliche, wie auch religionskritische Schriften vor, zudem erfolgte auch ein stetiger Wandel und Integrationsprozess des Religiösen, sei es durch Eingliederung der Kulte und Riten eroberter Völker in die Großreiche.
...
Die vorliegende Arbeit möchte sich daher mit den Fragen beschäftigen, in welcher Form bereits in den Zeiten vor der und bis zur 'europäischen Aufklärung' Krisen des Religiösen auftraten (s. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2), in welcher Form schon seinerzeit Privatisierung der Religion stattgefunden hat (s. Pt. 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.5 ) und welchen historischen Werdegang die – so genannten postmodernen/ postkonfessionellen/ postsäkularen – Formen des Religiösen dabei angenommen haben (s. Pt. 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.4), zumindest beispielhaft auch im Hinblick auf die heute so genannte Esoterik. Dabei wird von der Grundannahme ausgegangen, dass sich Religionsformen aufgrund von symbolischen Distinktionskämpfen und symbolischer Herrschaft (in Anlehnung an die Theorie des religiösen Feldes bei BOURDIEU ) positionieren konnten und die Religionen daher im Zeitverlauf mitunter sichtbar bzw. unsichtbar wurden, aber trotz ihrer Unsichtbarkeit auch weiterhin vorhanden blieben. (Geringfügige Änderungen des Einleitungstextes für vorliegende Darstellung vorgenommen. Fußnoten des Hauptdokuments an dieser Stelle nicht übernommen.)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Antike
- Eine frühe Kritik der Religiosität und des Aberglaubens
- Interpretatio Romana - 'Patchwork' der Kulte und der Religionen in der Antike
- Orte der Verehrung und private Hausgötter
- Astrologie, Magie und Weissagung
- Mittelalter
- Religionspluralismus in Zeiten der Krise
- Häretische Bewegungen des Mittelalters
- Volks- und Aberglauben
- Die Entstehung und Umformung einer Divinationstechnik im Mittelalter
- Private Beträume
- Von den 'esoterischen' über die 'apokryphen Schriften' zur 'Esoterik' - eine jahrtausendelange Wanderung?
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern bereits in der Antike und im Mittelalter Krisen des Religiösen auftraten und wie sich die Privatisierung der Religion in diesen Epochen vollzog. Sie untersucht den historischen Werdegang der so genannten postmodernen/postkonfessionellen/postsäkularen Formen des Religiösen, insbesondere im Hinblick auf die heutige Esoterik. Die Arbeit geht von der Annahme aus, dass sich Religionsformen aufgrund von symbolischen Distinktionskämpfen und symbolischer Herrschaft positionieren konnten und im Zeitverlauf sichtbar oder unsichtbar wurden, aber trotz ihrer Unsichtbarkeit weiterhin vorhanden blieben.
- Krisen des Religiösen in der Antike und im Mittelalter
- Privatisierung der Religion in historischen Kontexten
- Historischer Werdegang der postmodernen/postkonfessionellen/postsäkularen Formen des Religiösen
- Die Rolle von symbolischen Distinktionskämpfen und symbolischer Herrschaft in der Entwicklung von Religionsformen
- Die Bedeutung der Unsichtbarkeit von Religionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die These auf, dass die heutige Diskussion um den religiösen Pluralismus und die 'neue Spiritualität' nicht neu ist, sondern bereits in der Antike und im Mittelalter Parallelen aufweist. Sie beleuchtet die Entwicklung des Religiösen im Kontext von Kirchenaustritten, Migration und der Entstehung neuer Formen der Religiosität.
Das erste Kapitel befasst sich mit der Antike und untersucht die frühe Kritik der Religiosität und des Aberglaubens, die Interpretatio Romana als 'Patchwork' der Kulte und Religionen, die Orte der Verehrung und private Hausgötter sowie die Rolle von Astrologie, Magie und Weissagung.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Mittelalter und beleuchtet den Religionspluralismus in Zeiten der Krise, die häretischen Bewegungen, den Volks- und Aberglauben, die Entstehung und Umformung von Divinationstechniken sowie die Bedeutung von privaten Beträumen.
Das dritte Kapitel untersucht die Entwicklung der 'esoterischen' Schriften und ihre Verbindung zur heutigen Esoterik.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den religiösen Pluralismus, die Privatisierung der Religion, die 'neue Spiritualität', die Esoterik, die Antike, das Mittelalter, die Interpretatio Romana, häretische Bewegungen, Volks- und Aberglauben, symbolische Distinktionskämpfe und symbolische Herrschaft. Der Text beleuchtet die historischen Wurzeln des heutigen religiösen Pluralismus und die Transformation des Religiösen im Laufe der Zeit.
Häufig gestellte Fragen
Ist der heutige religiöse Pluralismus ein neues Phänomen?
Nein, die Arbeit zeigt, dass Transformationen des Religiösen und Formen des Pluralismus bereits in der Antike und im Mittelalter existierten.
Was bedeutet "Interpretatio Romana" im Kontext von Religion?
Es beschreibt ein antikes "Patchwork" der Kulte, bei dem fremde Religionen und Götter in das römische System integriert wurden.
Gab es bereits früher eine Privatisierung der Religion?
Ja, Beispiele hierfür sind private Hausgötter in der Antike oder private Beträume im Mittelalter, die eine individuelle Glaubenspraxis ermöglichten.
Welche Rolle spielt die Esoterik in der historischen Betrachtung?
Die Arbeit untersucht die jahrtausendelange Wanderung von apokryphen Schriften hin zur modernen Esoterik als Form der religiösen Transformation.
Was sind symbolische Distinktionskämpfe in der Religion?
In Anlehnung an Bourdieu wird erklärt, wie sich Religionsformen durch Machtkämpfe positionieren und dadurch mal sichtbar oder unsichtbar werden.
- Citation du texte
- Marion Röbkes (Auteur), 2010, Alter Wein in neuen Schläuchen? Eine kulturhistorische Auseinandersetzung mit dem religiösen Pluralismus zwischen kollektivem Glauben und individualisierter Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149350