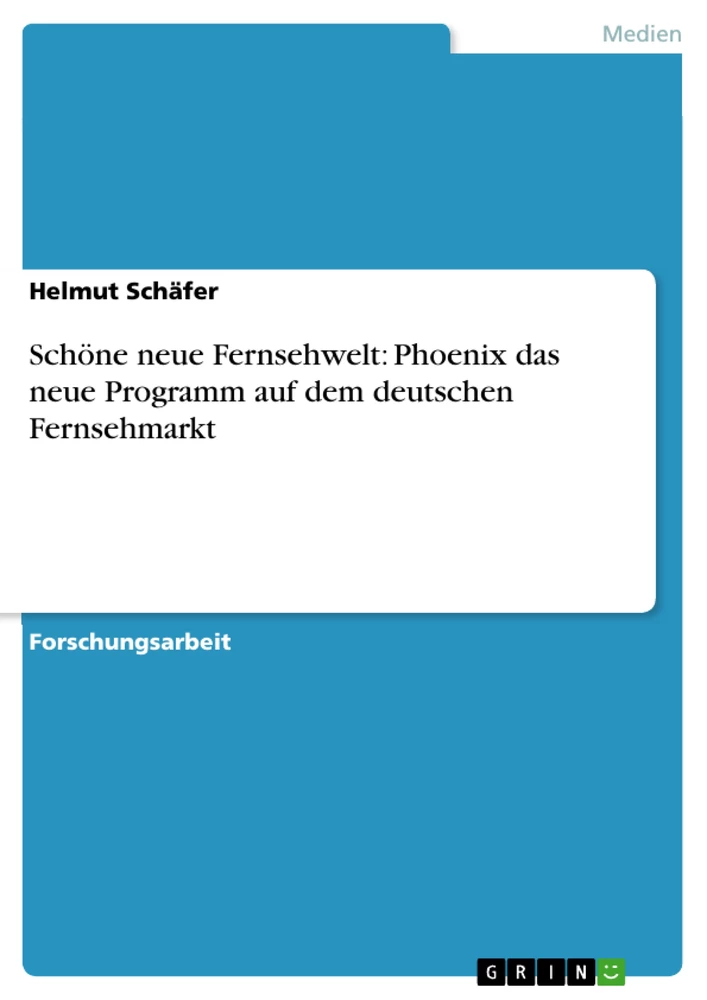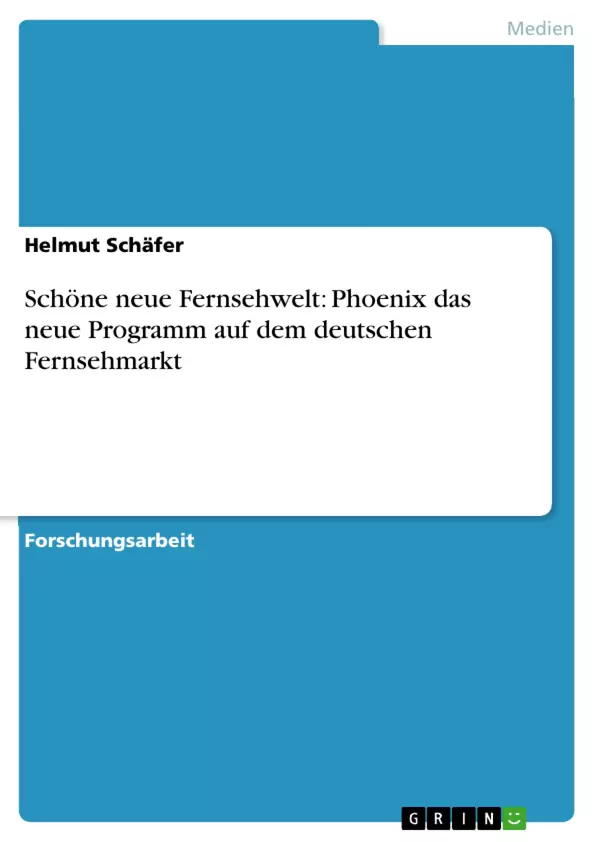[...] Auch unsere Medienwelt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten rasant verändert. Der hier zu untersuchende Bereich des Fernsehens in Deutschland unterzog sich mit der Einführung des dualen Systems Mitte der achtziger Jahre einem deutlichen Wandel: Während man bis zur Einführung des kommerziellen Rundfunks in der Regel nicht mehr als drei (Teilzeit-) Programme empfangen konnte, verfügen heute die meisten Haushalte via Satellit oder Kabel über weit mehr als 30 Kanäle, die rund um die Uhr senden. 1990 besaßen nur 3% der westdeutschen Bevölkerung und nur 1% aller Ostdeutschen kein Fernsehgerät. [...]
1.2. Aufbau der Arbeit
Zunächst wird allgemein die Rolle des Massenmediums Fernsehen im politischen Kommunikationsprozeß untersucht (2.1.). Es geht darum aufzuzeigen, daß für den Bürger politische Erfahrung eine zumeist medial vermittelte Erfahrung darstellt. Hierbei soll auch nach unterschiedlichen Modellen zum Realitätsbegriff gefragt und die Logik des Mediums Fernsehen beleuchtet werden. Im folgenden Abschnitt des zweiten Kapitels (2.2.) wird die Wirkung unterschiedlicher Medienformate im Mittelpunkt stehen. Es geht also beispielsweise darum aufzuzeigen, welches Fernseh-Konsumverhalten zu einer Politisierung des Rezipienten führt. Gleichzeitig sollen der seit Einführung des dualen Systems zunehmende Trend zur Vermeidbarkeit politischer Inhalte und die daraus resultierenden Konsequenzen erläutert werden. Außerdem werden allgemeine Entwicklungen der Programmgestaltung im deutschen Fernsehen herausgearbeitet und der 1997 von ARD und ZDF gegründete Sender „Phoenix“ dazu in Beziehung gesetzt. Es gilt also zu fragen, inwieweit „Phoenix“ sich einem zu erwartenden Trend in der Programmentwicklung anschließt oder sich diesem eher entzieht.
Dazu werden im dritten Kapitel die Organisation des Senders, seine Rolle innerhalb der öffentlich-rechtlichen Anstalten, der Programmauftrag sowie die Struktur des Programms vorgestellt.
Im vierten Kapitel schließt sich eine Datenanalyse zur Rezeption des Programms von Phoenix und zum allgemeinen Konsum von Nachrichten- und Informationsprogrammen an. Ausgehend von den Hypothesen des zweiten Kapitels soll also ein Rückschluß auf die Wirkung beim Rezipienten und die Rolle des Senders innerhalb der bundesdeutschen Fernsehlandschaft gezogen werden können.
Eine Zusammenfassung und eine abschließende Stellungnahme zu den erzielten Ergebnissen werden am Ende dieser Arbeit stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Vorbemerkung
- Themenfindung
- Aufbau der Arbeit
- Probleme, Vorgehen und Rechercheabläufe
- Theoretischer Bezugsrahmen
- Die Rolle des Massenmediums Fernsehen im politischen Kommunikationsprozeß
- Entwicklungstendenzen politischer Kommunikation
- Politische Erfahrung als vermittelte Erfahrung
- Zur Vermittelbarkeit des Politischen: Realitätsbegriff und Medienlogik des Fernsehens
- Funktionen der Medienrealität
- Politisierung oder Entpolitisierung in unterschiedlichen Medienformaten
- Die Modifizierung der Videomalaise-Hypothese
- Verändertes Nachrichten- und Informationsangebot seit Einführung des dualen Rundfunksystems in Deutschland
- Die Vermeidbarkeit des Politischen als Trend
- Kurzer Exkurs zur Konvergenzhypothese
- Phoenix - ein Sender gegen den Trend?
- Phoenix - institutioneller Aspekt
- Phoenix als Gemeinschaftseinrichtung von ARD und ZDF
- Organisation des Senders
- Programmauftrag und Programmstruktur
- Phoenix - Datenanalyse zur Rezeption
- Darstellung und Interpretation der GfK-Zahlen zum Phoenix-Programm seit Erhebung
- Zielgruppen, und besonders frequentierte Sendezeiten
- Empfangbarkeit von Phoenix und die Entwicklung der Marktanteile
- Entwicklung der Sendung „Phoenix/Schwerpunkt mit call-in“
- Darstellung und Interpretation der GfK-Zahlen zum Konsum von Nachrichten und politischen Informationsprogrammen seit 1992
- Einschaltquoten und Marktanteile der Nachrichten und Sendungen mit politischen Themen bei den fünf führenden Fernsehanstalten
- Seh- und Sendedauer der Nachrichten und Sendungen mit politischen Themen bei den fünf führenden Fernsehanstalten
- Zusammenfassung
- Schlußbemerkung und Ausblick
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender Phoenix, der 1997 von ARD und ZDF gegründet wurde. Ziel ist es, die Rolle des Senders im deutschen Fernsehmarkt zu untersuchen und seine Rezeption im Kontext der Entwicklungstendenzen politischer Kommunikation zu analysieren. Dabei werden die Programmstruktur, die Organisation des Senders sowie die Rezeption des Programms anhand von Datenanalysen betrachtet.
- Die Rolle des Fernsehens im politischen Kommunikationsprozeß
- Die Entwicklungstendenzen politischer Kommunikation und die Vermittlung von politischer Erfahrung durch Medien
- Die Medienlogik des Fernsehens und die Frage der Politisierung oder Entpolitisierung in unterschiedlichen Medienformaten
- Die Rezeption von Nachrichten und politischen Informationsprogrammen im deutschen Fernsehen
- Die Positionierung von Phoenix im Kontext der Programmentwicklung im deutschen Fernsehen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Themenfindung, den Aufbau der Arbeit und die Probleme, das Vorgehen und die Rechercheabläufe erläutert. Im zweiten Kapitel wird der theoretische Bezugsrahmen vorgestellt, der die Rolle des Fernsehens im politischen Kommunikationsprozeß, die Entwicklungstendenzen politischer Kommunikation, die Vermittlung von politischer Erfahrung durch Medien und die Medienlogik des Fernsehens beleuchtet. Außerdem werden die Auswirkungen unterschiedlicher Medienformate auf die Politisierung oder Entpolitisierung des Rezipienten untersucht. Das dritte Kapitel widmet sich dem institutionellen Aspekt von Phoenix, wobei die Organisation des Senders, seine Rolle innerhalb der öffentlich-rechtlichen Anstalten und der Programmauftrag sowie die Programmstruktur vorgestellt werden. Im vierten Kapitel erfolgt eine Datenanalyse zur Rezeption des Programms von Phoenix und zum allgemeinen Konsum von Nachrichten und politischen Informationsprogrammen. Ausgehend von den Hypothesen des zweiten Kapitels soll ein Rückschluß auf die Wirkung beim Rezipienten und die Rolle des Senders innerhalb der bundesdeutschen Fernsehlandschaft gezogen werden können.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Nachrichtensender Phoenix, die öffentlich-rechtlichen Anstalten ARD und ZDF, die Entwicklungstendenzen politischer Kommunikation, die Medienlogik des Fernsehens, die Politisierung und Entpolitisierung in unterschiedlichen Medienformaten, die Rezeption von Nachrichten und politischen Informationsprogrammen, die Datenanalyse zur Rezeption von Phoenix und die Positionierung des Senders im deutschen Fernsehmarkt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Sender "Phoenix" und wer betreibt ihn?
Phoenix ist ein öffentlich-rechtlicher Ereignis- und Dokumentationskanal, der 1997 als Gemeinschaftseinrichtung von ARD und ZDF gegründet wurde.
Welchen Programmauftrag verfolgt Phoenix?
Der Sender hat den Auftrag, politische Kommunikation umfassend abzubilden, unter anderem durch die Übertragung von Parlamentsdebatten, Dokumentationen und Diskussionsrunden.
Wie wirkt sich das Fernsehen auf die politische Erfahrung der Bürger aus?
Politische Erfahrung ist in der modernen Gesellschaft zumeist eine medial vermittelte Erfahrung. Die Arbeit untersucht, wie die Medienlogik des Fernsehens die Wahrnehmung der politischen Realität formt.
Was besagt die "Videomalaise-Hypothese" im Kontext dieser Arbeit?
Sie thematisiert die Befürchtung, dass bestimmter Fernsehkonsum zu einer Entpolitisierung oder einem Vertrauensverlust in die Politik führen kann. Die Arbeit prüft, ob Phoenix diesem Trend entgegenwirkt.
Wie wird die Rezeption des Senders Phoenix analysiert?
Die Arbeit nutzt eine Datenanalyse der GfK-Zahlen, um Zielgruppen, Marktanteile und die Nutzung von Informationsprogrammen seit den 90er Jahren zu interpretieren.
Was versteht man unter der "Vermeidbarkeit des Politischen"?
Durch das duale Rundfunksystem und die Vielzahl an Kanälen können Rezipienten politische Inhalte leichter umgehen. Phoenix positioniert sich als Sender, der diesem Trend der Entpolitisierung widerspricht.
- Citar trabajo
- Helmut Schäfer (Autor), 2000, Schöne neue Fernsehwelt: Phoenix das neue Programm auf dem deutschen Fernsehmarkt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149823