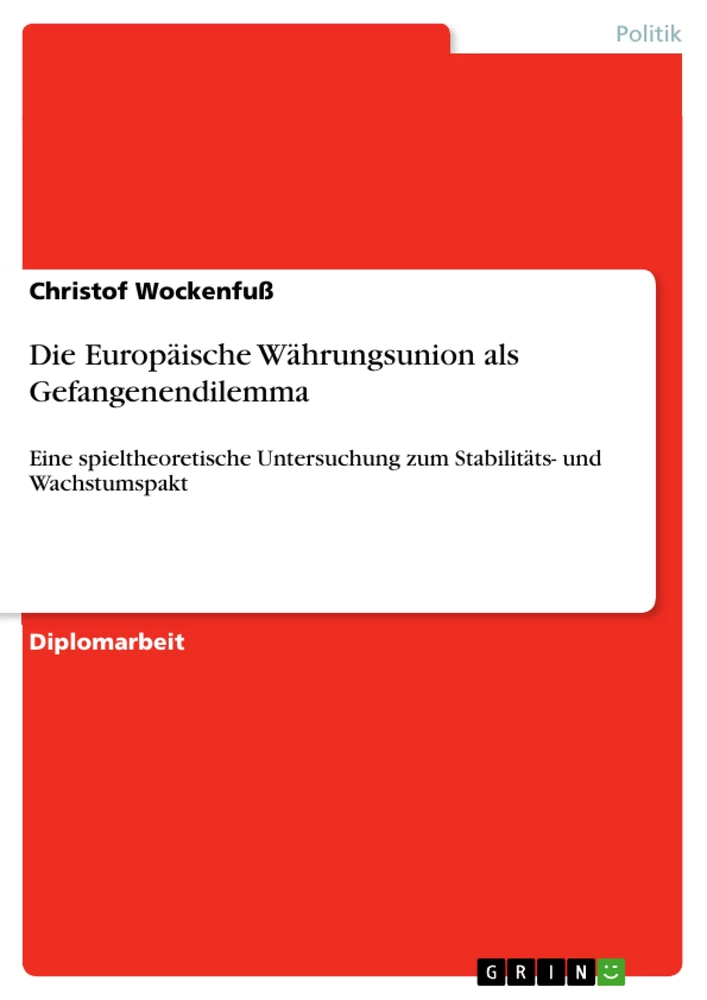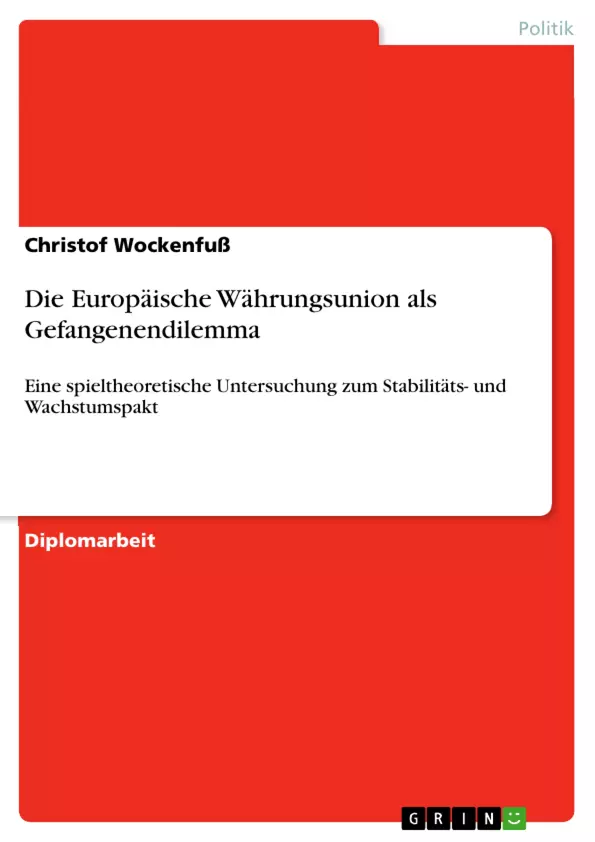Weshalb missachten viele Regierungen systematisch die Kriterien des „Stabilitäts- und Wachstumspaktes“ der Euro-Zone? Die vorliegende Schrift beantwortet diese Frage auf der Grundlage der „ökonomischen Theorie der Politik“. Hierzu wird ein einfaches spieltheoretisches Modell der europäischen Währungsunion vorgestellt. Demnach wäre ordnungspolitisch nicht eine „Flexibilisierung“, sondern im Gegenteil eine Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspakts anzustreben. Andernfalls wäre mit einer übermäßigen Verschuldung insbesondere durch kleinere Länder der Eurozone zu rechnen – mit dann allerdings höchst unerwünschten und für die Eurozone insgesamt bedrohlichen Folgen.
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG
- II. THEORETISCHER HINTERGRUND
- 1. Der Rational-Choice-Ansatz als politikwissenschaftliche Theorie
- 1.1 Ideengeschichtliche Entwicklung
- 1.2 Grundthesen der Rational-Choice-Theorie
- 1.3 Individuelles Rationalverhalten und kollektive Folgen
- 1.4 Zusammenfassung
- 2. Die Spieltheorie und die Analyse interdependenter Entscheidungen
- 2.1 Bestandteile spieltheoretischer Modelle
- 2.1.1 Spieler, Regeln und Strategien
- 2.1.2 Herleitung individueller Präferenzordnungen für die Spielstände
- 2.2 Kooperative und nicht-kooperative Spiele
- 2.2.1 Das Gefangenendilemma als nicht-kooperatives Spiel
- 2.2.2 Interdependenzen und deren Auswirkungen auf die Präferenzordnungen
- 2.2.3 Ergebnis des nicht-kooperativen Spiels und kollektive Bewertung
- 2.2.4 Kooperationsmöglichkeiten zur Überwindung eines Nash-Gleichgewichts
- 2.3 Zusammenfassung
- 2.1 Bestandteile spieltheoretischer Modelle
- 1. Der Rational-Choice-Ansatz als politikwissenschaftliche Theorie
- III. EIN SPIELTHEORETISCHES MODELL DER EUROPÄISCHEN WÄHRUNGSUNION
- 1. Die Haushaltspolitik einer einzelnen, rationalen Regierung
- 1.1 Die haushaltpolitischen Empfehlungen makroökonomischer Schulen
- 1.2 Die Defizit-Politik einer einzelnen, rationalen Regierung
- 1.2.1 Regierungen als kollektive, rationale Akteure
- 1.2.2 Handlungsrelevante Zustimmungsgewinne und Zustimmungsverluste
- 1.2.3 Bestimmung des rationalen Haushaltsdefizits
- 1.2.4 Auswirkungen des Konjunkturverlaufs auf das rationale Defizit
- 1.3 Zusammenfassung
- 2. Rationale Haushaltspolitik in der europäischen Währungsunion
- 2.1 Die europäische Währungsunion als Gefangenendilemma
- 2.1.1 Spieler, Regeln und Strategien
- 2.1.2 Darstellung der Interdependenzen im Modell
- 2.1.3 Herleitung individueller Präferenzordnungen
- 2.1.4 Ergebnis des nicht-kooperativen Spiels und kollektive Bewertung
- 2.2 Die europäische Währungsunion als kooperatives Spiel
- 2.2.1 Veränderung der Spielregeln durch Kooperation
- 2.2.2 Darstellung einer rationalen, kollektiven Selbstbindung im Modell
- 2.2.3 Herleitung individueller Präferenzordnungen
- 2.2.4 Ergebnis des kooperativen Spiels und kollektive Bewertung
- 2.3 Zusammenfassung
- 2.1 Die europäische Währungsunion als Gefangenendilemma
- 1. Die Haushaltspolitik einer einzelnen, rationalen Regierung
- IV. EMPIRISCHE ÜBERPRÜFUNG DER AUSSAGEN DES MODELLS
- 1. Die Haushaltspolitik europäischer Regierungen vor Inkrafttreten der dritten Stufe der Währungsunion
- 1.1 Programmatische Positionen zur Haushalts- und Konjunkturpolitik
- 1.1.1 Zutreffende Prognosen des Modells
- 1.1.2 Einschränkungen
- 1.2 Die Defizit-Politik europäischer Regierungen
- 1.2.1 Zutreffende Prognosen des Modells
- 1.2.2 Einschränkungen
- 1.3 Zusammenfassung
- 1.1 Programmatische Positionen zur Haushalts- und Konjunkturpolitik
- 2. Die Haushaltspolitik europäischer Regierungen seit Inkrafttreten der dritten Stufe der Währungsunion
- 2.1 Die europäische Währungsunion als potentielles Gefangenendilemma
- 2.1.1 Plausible Aussagen des Modells
- 2.1.2 Einschränkungen
- 2.2 Die europäische Währungsunion als bedingt kooperatives Spiel
- 2.2.1 Die Funktionsweise des Stabilitäts- und Wachstumspaktes
- 2.2.2 Die Wirkung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes
- 2.3 Zusammenfassung
- 2.1 Die europäische Währungsunion als potentielles Gefangenendilemma
- 1. Die Haushaltspolitik europäischer Regierungen vor Inkrafttreten der dritten Stufe der Währungsunion
- V. FAZIT
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die europäische Währungsunion aus spieltheoretischer Perspektive, insbesondere im Hinblick auf den Stabilitäts- und Wachstumspakt. Ziel ist es, die rationale Entscheidungsfindung von Regierungen im Kontext der Währungsunion zu analysieren und zu erklären, warum einige Staaten das Konvergenzkriterium des Paktes missachten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Anwendung des Gefangenendilemmas als Modell für die Interdependenzen zwischen den Mitgliedstaaten und die Auswirkungen auf die Haushaltspolitik.
- Rational-Choice-Theorie und Spieltheorie als analytische Werkzeuge
- Das Gefangenendilemma als Modell für die europäische Währungsunion
- Die Rolle des Stabilitäts- und Wachstumspaktes
- Rationale Entscheidungsfindung von Regierungen im Kontext der Währungsunion
- Empirische Überprüfung der theoretischen Aussagen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Problem der Verletzung des Konvergenzkriteriums im Stabilitäts- und Wachstumspakt dar und führt in die Thematik der Diplomarbeit ein. Kapitel II erläutert die theoretischen Grundlagen der Arbeit, indem es den Rational-Choice-Ansatz und die Spieltheorie als analytische Werkzeuge vorstellt. Kapitel III entwickelt ein spieltheoretisches Modell der europäischen Währungsunion, das die Haushaltspolitik einer einzelnen, rationalen Regierung und die Interdependenzen zwischen den Mitgliedstaaten im Kontext des Gefangenendilemmas analysiert. Kapitel IV überprüft die Aussagen des Modells empirisch, indem es die Haushaltspolitik europäischer Regierungen vor und nach Inkrafttreten der dritten Stufe der Währungsunion untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die europäische Währungsunion, den Stabilitäts- und Wachstumspakt, das Gefangenendilemma, die Rational-Choice-Theorie, die Spieltheorie, die Haushaltspolitik, das Konvergenzkriterium, die Interdependenzen zwischen den Mitgliedstaaten und die empirische Überprüfung der theoretischen Aussagen.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird die Währungsunion als Gefangenendilemma bezeichnet?
Weil es für einzelne Staaten rational sein kann, hohe Defizite zu machen, während dies kollektiv für die Stabilität des Euro schädlich ist.
Was ist der Stabilitäts- und Wachstumspakt?
Ein Regelwerk der Eurozone, das die Haushaltsdefizite der Mitgliedstaaten begrenzt, um die Stabilität der gemeinsamen Währung zu sichern.
Was besagt die Rational-Choice-Theorie in diesem Kontext?
Sie analysiert Regierungen als rationale Akteure, die ihre Entscheidungen an Zustimmungsgewinnen und politischen Kosten ausrichten.
Sollte der Stabilitatspakt flexibler gestaltet werden?
Die Arbeit argumentiert spieltheoretisch gegen eine Flexibilisierung und stattdessen für eine Verschärfung, um übermäßige Verschuldung zu verhindern.
Was ist ein Nash-Gleichgewicht?
Ein Zustand in der Spieltheorie, in dem kein Spieler durch einseitige Änderung seiner Strategie einen Vorteil erlangt, was hier zu einer suboptimalen Defizitpolitik führen kann.
- Quote paper
- Christof Wockenfuß (Author), 2006, Die Europäische Währungsunion als Gefangenendilemma, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149921