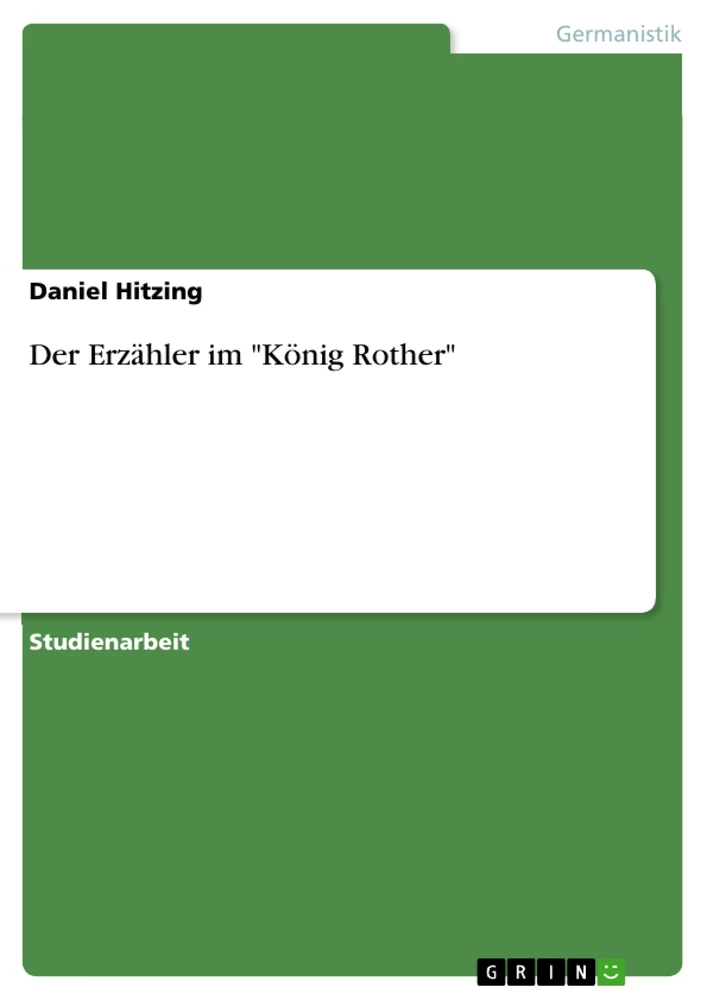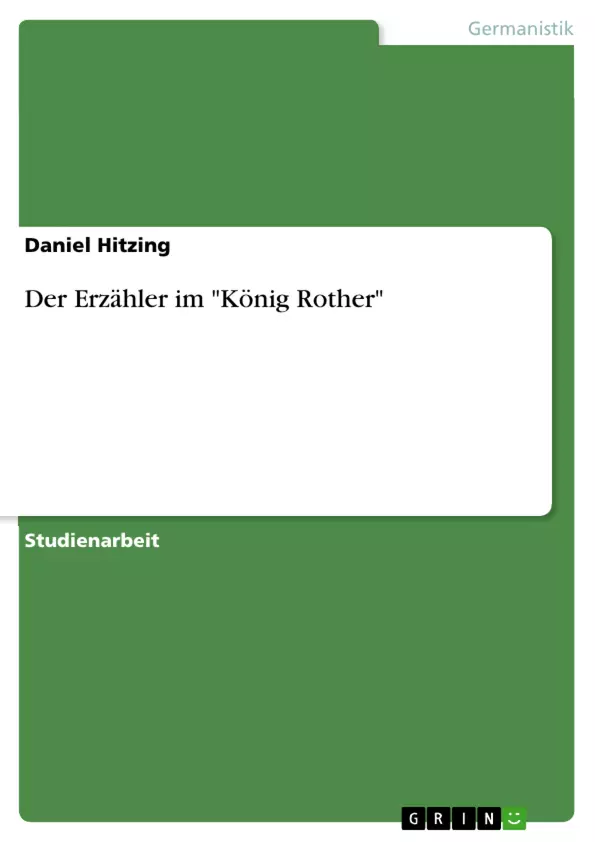Der Autor des König Rother (KR) ist uns nicht bekannt. Auch wenn über das Leben eines Wolfram von Eschenbach nur gemutmaßt werden kann, so liegt uns in diesem Fall nicht einmal der Name des Schriftstellers vor.
Trotz allem bleibt er uns nicht vollständig verborgen, da es im KR zahlreiche Textstellen gibt, in denen der Epiker aus der Erzählung hervortritt. Die Analyse dieser Ausschnitte, der die Textausgabe von Peter Stein zugrundeliegt, ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Dabei ist die zentrale Frage, ob Informationen über die Erzählerpersönlichkeit gewonnen werden können, wobei die Diskussion, ob es sich beim Erzähler um einen Spielmann handelte, nicht aufgegriffen werden soll.
Hierzu werden die entsprechenden Belege aus dem Text in Kategorien zusammengefasst und interpretiert. Zunächst werden die Textstellen näher betrachtet, bei denen der Autor auf eine zugrundeliegende Quelle verweist und die Wahrheit seiner Erzählung beteuert. Desweiteren ist die Verwendung des Gedankenstrichs und exklamatorischer Formeln auffällig, mit denen sich, zusammen mit den direkten Publikumsanreden, eingehender beschäftigt wird. Zuletzt richtet sich der Fokus der Analyse auf Aussagen, in denen der Erzähler als moralische Instanz oder Normgeber fungiert.
Daran anschließend folgt eine Diskussion, die die gewonnenen Ergebnisse in den Kontext der bisherigen Forschung setzt.
In einem letzten Schritt sollen die Resultate der vorherigen Arbeitsschritte prägnant zusammengefasst werden.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DER ERZÄHLER IM KÖNIG ROTHER.
- QUELLE UND WAHRHEIT.
- ORALITÄT
- NORM UND MORAL
- DISKUSSION.
- FAZIT
- LITERATUR
- ANHANG: BERÜCKSICHTIGTE TEXTSTELLEN.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Rolle des Erzählers im mittelhochdeutschen Epos „König Rother“. Sie untersucht, inwieweit sich durch die Analyse von metasprachlichen Äußerungen des Erzählers Rückschlüsse auf seine Persönlichkeit ziehen lassen.
- Die Verweise des Erzählers auf Quellen und seine Beteuerungen der Wahrheit
- Die Verwendung von Parenthesen, exklamatorischen Wendungen und direkten Publikumsanreden als Zeichen von Oralität
- Die Rolle des Erzählers als moralische Instanz und Normgeber
- Die Einordnung der Ergebnisse in den Kontext der bisherigen Forschung
- Die Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit vor. Kapitel 2 analysiert die Textstellen, in denen der Erzähler auf Quellen verweist und die Wahrheit seiner Erzählung bekräftigt. Zudem werden die Verwendung von Parenthesen, exklamatorischen Formeln und direkten Publikumsanreden als Indizien für die Oralität des Textes untersucht. Kapitel 2.3 konzentriert sich auf die Rolle des Erzählers als moralische Instanz und Normgeber. Die Diskussion setzt die gewonnenen Erkenntnisse in den Kontext der bisherigen Forschung. Im Fazit werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst.
Schlüsselwörter
König Rother, Erzähler, Metasprache, Quelle, Wahrheit, Oralität, Parenthese, Exklamation, Publikumsansprache, Moral, Normgeber, Forschung, Mittelhochdeutsch
Häufig gestellte Fragen
Wer ist der Autor des "König Rother"?
Der Autor ist unbekannt. Anders als bei Zeitgenossen wie Wolfram von Eschenbach ist nicht einmal der Name des Verfassers überliefert.
Wie tritt der Erzähler im Text in Erscheinung?
Der Erzähler nutzt metasprachliche Äußerungen, verweist auf Quellen, beteuert die Wahrheit seiner Geschichte und wendet sich direkt mit Ausrufen oder Anreden an das Publikum.
Was verrät die Erzählweise über die "Oralität" des Werkes?
Die Verwendung von Gedankenstrichen (Parenthesen) und exklamatorischen Formeln deutet auf eine mündliche Erzähltradition oder eine für den Vortrag konzipierte Struktur hin.
Welche moralische Rolle nimmt der Erzähler ein?
Der Erzähler fungiert oft als moralische Instanz oder Normgeber, indem er das Verhalten der Figuren bewertet und dem Publikum gegenüber als Autorität auftritt.
Was ist das Ziel der Analyse der Erzählerpersönlichkeit?
Die Arbeit untersucht, ob trotz der Anonymität des Autors durch die Textstellen Informationen über die Persönlichkeit und die Intentionen des Erzählers gewonnen werden können.
- Quote paper
- Bachelor Daniel Hitzing (Author), 2010, Der Erzähler im "König Rother", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150168