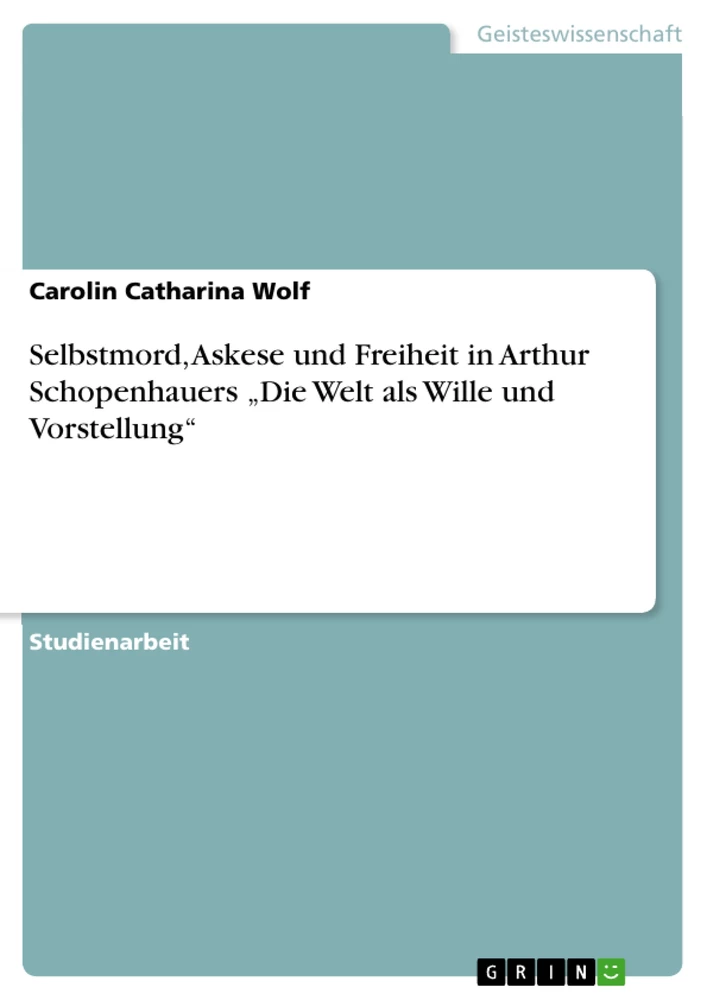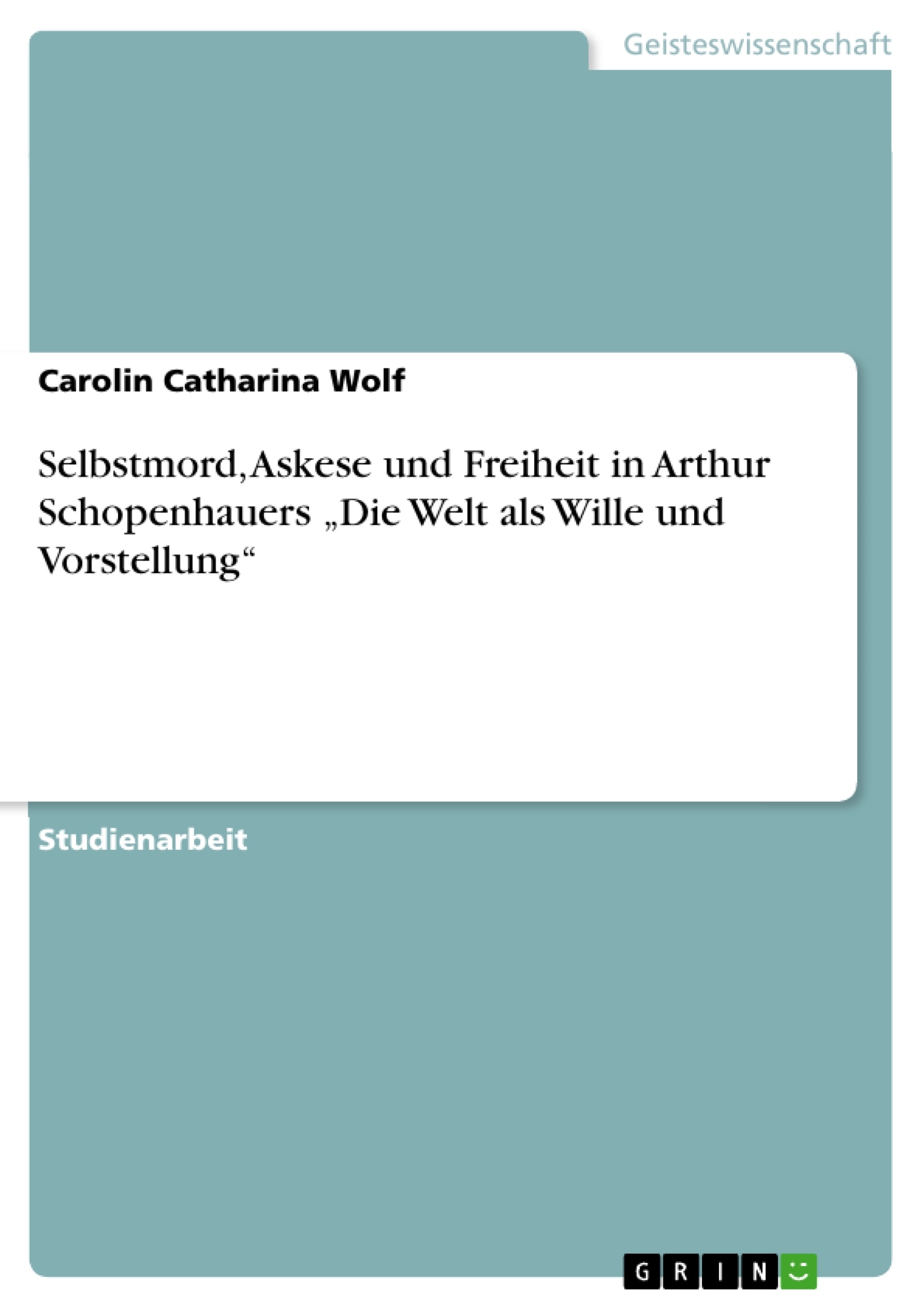Abseits von Gesellschaft und akademischer Welt entsteht Arthur Schopenhauers (1788-1860) philosophisches Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung in Dresden, wo es 1818 vollendet wird. Bereits dem Titel ist die Hauptaussage des Werks inhärent, welches sich in vier verschiedene Teile, beziehungsweise Bücher gliedert: Erkenntnistheorie, Metaphysik, Ästhetik und Ethik. Als Vorbilder gibt Schopenhauer die Philosophie Platons, vor allen Dingen auch diejenige Kants und der altindischen Upanischaden an.
In der vorliegenden Arbeit soll der Zusammenhang zwischen Freiheit und Selbstmord, welcher im vierten Buch der Welt als Wille und Vorstellung Ausführung findet, auseinandergesetzt werden.
Arthur Schopenhauer in eigener Person wird vielfach als Selbstmörder bezeichnet, der sich nie das Leben nahm. Doch nicht nur die persönliche Disposition des Frankfurter Philosophen macht eine solche Fragestellung interessant, handelt es sich doch hierbei um ein viel diskutiertes Thema in der Philosophie überhaupt.
Im Grunde geht es dabei um Eines: Die Selbstbestimmung des Einzelnen. Selbstmord lässt sich unter diesem Gesichtspunkt also als „Signatur der Freiheit“ verstehen. Der Selbstmörder beweist seine Freiheit, indem er über sich selbst verfügt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Welt als Vorstellung
- Die Welt als Wille
- Der Charakter und die Täuschung vom freien Willen
- Der Wille zum Leben
- Der Selbstmord: Bejahung des Willens zum Leben
- Die Askese: Verneinung des Willens zum Leben
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Freiheit und Selbstmord in Arthur Schopenhauers philosophischem Hauptwerk „Die Welt als Wille und Vorstellung“. Sie analysiert Schopenhauers Philosophie des Willens und die Rolle des Selbstmords innerhalb dieser.
- Schopenhauers Philosophie des Willens
- Die Beziehung zwischen Selbstmord und Freiheit
- Der Selbstmord als Ausdruck von Bejahung oder Verneinung des Willens zum Leben
- Die Rolle der Askese in Schopenhauers Philosophie
- Die Kritik an Schopenhauers Argumentation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Werk „Die Welt als Wille und Vorstellung“ von Arthur Schopenhauer (1788-1860) vor und skizziert die Hauptaussage des Werks, die sich in vier Bücher gliedert: Erkenntnistheorie, Metaphysik, Ästhetik und Ethik. Die Arbeit konzentriert sich auf den Zusammenhang zwischen Freiheit und Selbstmord, welcher im vierten Buch ausgeführt wird.
Die Welt als Vorstellung
Dieses Kapitel erläutert Schopenhauers Theorie der Welt als Vorstellung. Er argumentiert, dass die Welt für den Menschen nur durch seine Sinnesorgane zugänglich ist und somit nur mittelbar wahrgenommen wird. Die Welt ist ein Objekt für ein erkennendes Subjekt, eine Anschauung für einen Anschauenden. Schopenhauer folgt hier seinem Vorbild Kant, indem er die Welt als Erscheinungen begreift.
Die Welt als Wille
Dieses Kapitel beleuchtet Schopenhauers Philosophie des Willens, der als das blinde, unpersönliche Streben nach Befriedigung betrachtet wird. Der Wille ist der eigentliche Motor der Welt und treibt alles Geschehen an. Er ist unaufhaltsam und ewig und somit auch der Grund für das menschliche Leid.
Der Charakter und die Täuschung vom freien Willen
Schopenhauer stellt die Idee des freien Willens in Frage und argumentiert, dass der Mensch in seinen Handlungen vom Willen geleitet wird und somit nicht frei ist. Der Wille bestimmt das Handeln des Menschen, ohne dass er einen freien Willen hat. Dieses Kapitel untersucht die Täuschung des freien Willens und die Folgen für die menschliche Existenz.
Der Wille zum Leben
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Willen zum Leben, der als das Streben nach Befriedigung des Willens interpretiert wird. Das Streben nach Glück ist jedoch aufgrund der Natur des Willens vergeblich und führt zu ständigem Leid. Schopenhauer argumentiert, dass das Leben im Grunde genommen eine Kette von Leid und Enttäuschungen ist.
Der Selbstmord: Bejahung des Willens zum Leben
Dieses Kapitel analysiert Schopenhauers Sicht auf den Selbstmord. Schopenhauer betrachtet den Selbstmord nicht als eine Verneinung des Willens zum Leben, sondern als eine Bejahung desselben. Der Selbstmörder bejaht den Willen, indem er sich von seinem Leiden erlöst.
Die Askese: Verneinung des Willens zum Leben
Schopenhauer beschreibt die Askese als eine Möglichkeit, den Willen zum Leben zu verneinen. Durch Askese kann der Mensch seinen Willen zügeln und sich von seinen Leidenschaften befreien. Die Askese ist somit ein Weg zur Erlösung vom Leiden.
Schlüsselwörter
Schopenhauers „Die Welt als Wille und Vorstellung“ beschäftigt sich mit zentralen Themen der Philosophie wie dem Willen, der Vorstellung, dem Leid, dem Selbstmord und der Askese. Die Arbeit untersucht die Natur des Willens und seine Auswirkungen auf die menschliche Existenz. Wichtige Begriffe sind: Wille, Vorstellung, Leid, Selbstmord, Askese, Freiheit, Bejahung, Verneinung, Willensmetaphysik.
- Citation du texte
- Carolin Catharina Wolf (Auteur), 2008, Selbstmord, Askese und Freiheit in Arthur Schopenhauers „Die Welt als Wille und Vorstellung“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150186