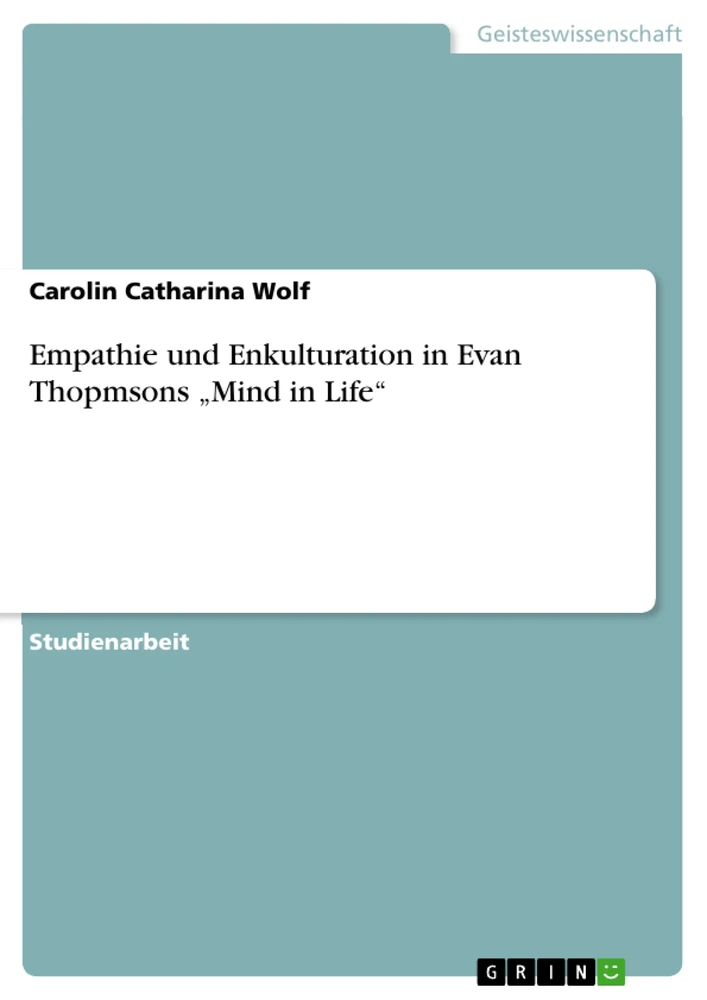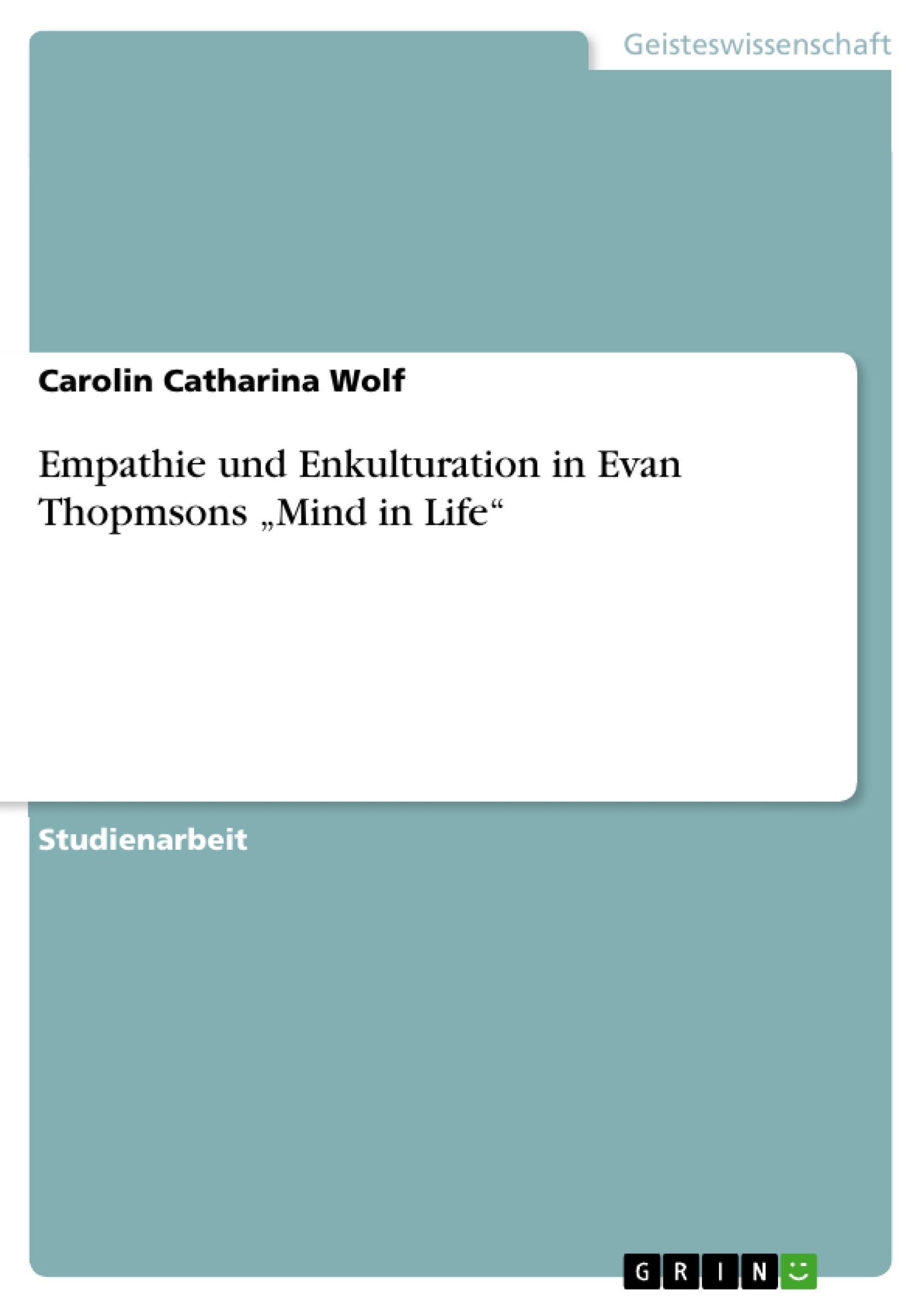Grundlage für die vorliegende Arbeit bildet die Publikation Mind in Life – Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind des kanadischen Professors der Philosophie Evan Thompson (*1962), namentlich Kapitel 13, Empathy and Enculturation.
‚Empathy’, welche Thompson als „central feature of the human experience“ beschreibt, ist eine spätere englische Übersetzung des deutschen Worts ‚Einfühlung’, begründet von Theodor Lipps (1851-1914). Sie bezeichnet die „Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Einstellung anderer Menschen einzufühlen“ oder – mit Thompsons Worten – „the mental capacity, involving cognition and emotion, to understand another person’s perpective, another person’s thoughts and feelings.” Ausschlaggebend ist also das Vermögen einen Menschen von außen zu erfassen und sich in ihn einzufühlen, ohne dabei aber seine eigenen Grenzen zu überscheiten: Gefühle werden nachvollzogen und eingesehen, aber nicht unbedingt geteilt. „Die Identifikation mit einem anderen und die Sorge um ihn, ohne die eigene Identität aufzugeben, ist der springende Punkt bei menschlichem Mitgefühl“, erörtert der Verhaltensforscher Frans De Waal (*1948) in diesem Zusammenhang. Dies setze eine „gewisse kognitive Fähigkeiten voraus, deren wichtigste ein gut entwickelter Sinn für das Ich und die Fähigkeit zur Übernahme der Perspektive eines anderen sind.“ De Waal, dessen Arbeit im vorliegenden Text (ebenfalls) eine tragende Rolle spielt, widmet sich der Frage, ob Tiere, insbesondere Primaten, ebenso wie der Mensch zur Empathie befähigt sind: „Kritiker sagen, es gäbe keine Möglichkeit zu erkennen, was im Kopf eines Tieres vor sich geht,“ erläutert er; Ethologen jedoch versuchen, genau solche mentalen Prozesse bei ihnen zu rekonstruieren.
Im Folgenden sollen nicht nur die Verhaltensforschung, sondern auch die Entwicklungspsychologie und die Phänomenologie nach Edmund Husserl (1859-1938) ihren Beitrag leisten, zwei Erscheinungsformen der Empathie näher zu beleuchten: Erstens die Tatsache, dass das Bewusstsein einer Person ein gewisses Maß empathischen Verhaltens voraussetzt, und zweitens, dass menschliches Bewusstsein aus Entwicklungsprozessen von Enkulturation entsteht. Letzteres ist der Grund, warum menschliche Subjektivität, also die individuelle Wahrnehmung eines Individuums, von Anbeginn Intersubjektivität ist oder wie Thompson sagt: „No mind is an island. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Intentionality and Open Intersubjectivity
- The Phenomenological Concept of Empathy
- Die vier Hauptaspekte der Empathie
- Affective and Sensorimotor Coupling
- Imaginary Transposition
- Mutual Self and Other Understanding
- Moral Perception
- Enculturation
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Evan Thompsons Konzept von Empathie und Enkulturation in seinem Werk „Mind in Life“. Ziel ist es, die philosophischen und wissenschaftlichen Grundlagen von Empathie zu beleuchten und deren enge Verbindung zur Enkulturation aufzuzeigen. Die Arbeit stützt sich dabei auf Erkenntnisse aus der Phänomenologie, der Verhaltensforschung und der Entwicklungspsychologie.
- Das phänomenologische Verständnis von Empathie nach Husserl und Thompson
- Die vier Hauptaspekte der Empathie: affektive und sensomotorische Kopplung, imaginäre Transposition, wechselseitiges Selbst- und Fremdverständnis, moralische Wahrnehmung
- Der Einfluss von Enkulturation auf die Entwicklung und Ausprägung von Empathie
- Die Rolle der Intersubjektivität im Verständnis von Bewusstsein und Empathie
- Die Frage nach der Empathiefähigkeit bei Tieren
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Empathie und Enkulturation ein und benennt die zentrale Forschungsfrage. Sie stellt Evan Thompsons Werk „Mind in Life“ als Grundlage der Arbeit vor und definiert den Begriff der Empathie, wobei sowohl Thompsons Definition als auch die von Frans de Waal miteinbezogen werden. Die Einleitung skizziert den Forschungsansatz, der die Erkenntnisse aus verschiedenen Disziplinen wie Verhaltensforschung, Entwicklungspsychologie und Phänomenologie verbindet, um ein umfassendes Verständnis von Empathie zu entwickeln. Besonderes Augenmerk wird auf die These gelegt, dass menschliches Bewusstsein von Anfang an intersubjektiv ist und Empathie ein integraler Bestandteil dieser Intersubjektivität darstellt.
Intentionality and Open Intersubjectivity: Dieses Kapitel behandelt die Husserlsche These der „intersubjektiv offenen Intentionalität“ des Bewusstseins. Thompson argumentiert, dass unser Bewusstsein nicht in sich geschlossen ist, sondern immer schon auf Begegnungen mit anderen ausgerichtet ist. Der Begriff der Intentionalität im Sinne Husserls und Brentanos wird erläutert, wobei die Gerichtetheit des Bewusstseins auf Objekte und die Offenheit für das Andere betont werden. Das Kapitel untersucht die Rolle kultureller Artefakte in unserer Wahrnehmung und zeigt, wie die Wahrnehmung eines Objektes immer schon die Perspektive anderer impliziert, da wir die uns verborgenen Seiten des Objekts als potentiell wahrnehmbar durch andere Subjekte voraussetzen.
The Phenomenological Concept of Empathy: Das Kapitel widmet sich dem phänomenologischen Verständnis von Empathie. Ausgehend von Husserls Konzept der Appräsentation wird die Fähigkeit erläutert, sich in die Perspektive anderer hineinzuversetzen, auch wenn uns diese Perspektive nicht unmittelbar zugänglich ist. Der Begriff der „Quasi-Erfahrung“ wird eingeführt, um den Prozess des Sich-Hineinversetzens zu beschreiben. Die Bedeutung der Intersubjektivität für das Verständnis von Empathie wird hervorgehoben, wobei die Frage diskutiert wird, ob die Beziehung zwischen Präsentem und Abwesendem in der Erfahrung erklärt werden kann, ohne auf andere Bewusstseine zu verweisen.
Schlüsselwörter
Empathie, Enkulturation, Intentionalität, Intersubjektivität, Phänomenologie, Edmund Husserl, Evan Thompson, Frans de Waal, Verhaltensforschung, Entwicklungspsychologie, Bewusstsein, kulturelle Artefakte, perspektivenübernahme.
Häufig gestellte Fragen zu "Mind in Life": Empathie und Enkulturation
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Evan Thompsons Konzept von Empathie und Enkulturation, basierend auf seinem Werk „Mind in Life“. Sie beleuchtet die philosophischen und wissenschaftlichen Grundlagen von Empathie und deren enge Verbindung zur Enkulturation, unter Einbezug von Erkenntnissen aus der Phänomenologie, der Verhaltensforschung und der Entwicklungspsychologie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das phänomenologische Verständnis von Empathie nach Husserl und Thompson, die vier Hauptaspekte der Empathie (affektive und sensomotorische Kopplung, imaginäre Transposition, wechselseitiges Selbst- und Fremdverständnis, moralische Wahrnehmung), den Einfluss der Enkulturation auf die Entwicklung von Empathie, die Rolle der Intersubjektivität und die Frage nach der Empathiefähigkeit bei Tieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu "Intentionality and Open Intersubjectivity", "The Phenomenological Concept of Empathy", "Die vier Hauptaspekte der Empathie" (mit Unterkapiteln zu den vier Aspekten), "Enculturation" und Schlussbetrachtungen. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert beschrieben.
Wie wird Empathie definiert?
Die Arbeit bezieht sowohl Thompsons als auch Frans de Waals Definition von Empathie mit ein. Es wird ein umfassendes Verständnis von Empathie entwickelt, das Erkenntnisse aus verschiedenen Disziplinen verbindet. Besonderes Augenmerk liegt auf der These, dass menschliches Bewusstsein von Anfang an intersubjektiv ist und Empathie ein integraler Bestandteil dieser Intersubjektivität darstellt.
Welche Rolle spielt die Phänomenologie?
Die Arbeit stützt sich stark auf die Phänomenologie, insbesondere auf Husserls Konzept der Intersubjektivität und Appräsentation. Sie untersucht, wie unser Bewusstsein immer schon auf Begegnungen mit anderen ausgerichtet ist und wie wir uns in die Perspektive anderer hineinversetzen können, auch wenn diese uns nicht unmittelbar zugänglich ist. Der Begriff der „Quasi-Erfahrung“ wird in diesem Zusammenhang verwendet.
Welche Rolle spielt die Enkulturation?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Enkulturation auf die Entwicklung und Ausprägung von Empathie. Es wird beleuchtet, wie kulturelle Artefakte unsere Wahrnehmung beeinflussen und wie die Wahrnehmung eines Objekts immer schon die Perspektive anderer impliziert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Empathie, Enkulturation, Intentionalität, Intersubjektivität, Phänomenologie, Edmund Husserl, Evan Thompson, Frans de Waal, Verhaltensforschung, Entwicklungspsychologie, Bewusstsein, kulturelle Artefakte, Perspektivenübernahme.
Welche Forschungsfrage steht im Zentrum der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage wird in der Einleitung benannt und behandelt die umfassende Untersuchung von Empathie und Enkulturation und deren Zusammenhänge.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verbindet Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung, der Entwicklungspsychologie und der Phänomenologie, um ein umfassendes Verständnis von Empathie zu entwickeln.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die bereitgestellte HTML-Datei enthält Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, die die Kernaussagen und Argumentationslinien jedes Kapitels detailliert beschreiben.
- Citar trabajo
- Carolin Catharina Wolf (Autor), 2008, Empathie und Enkulturation in Evan Thopmsons „Mind in Life“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150187