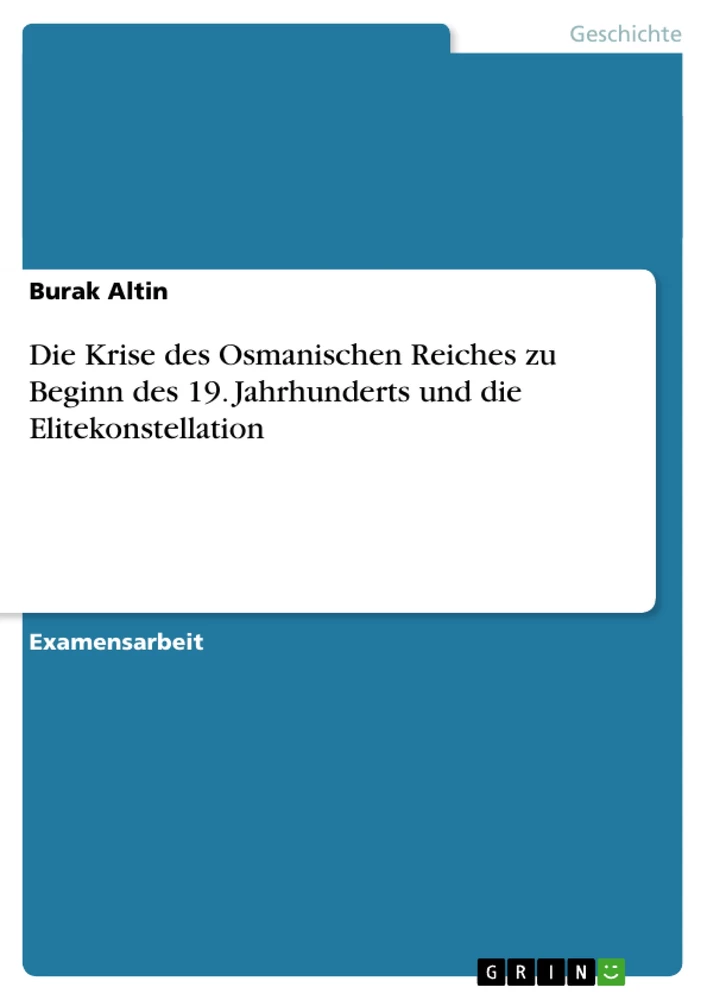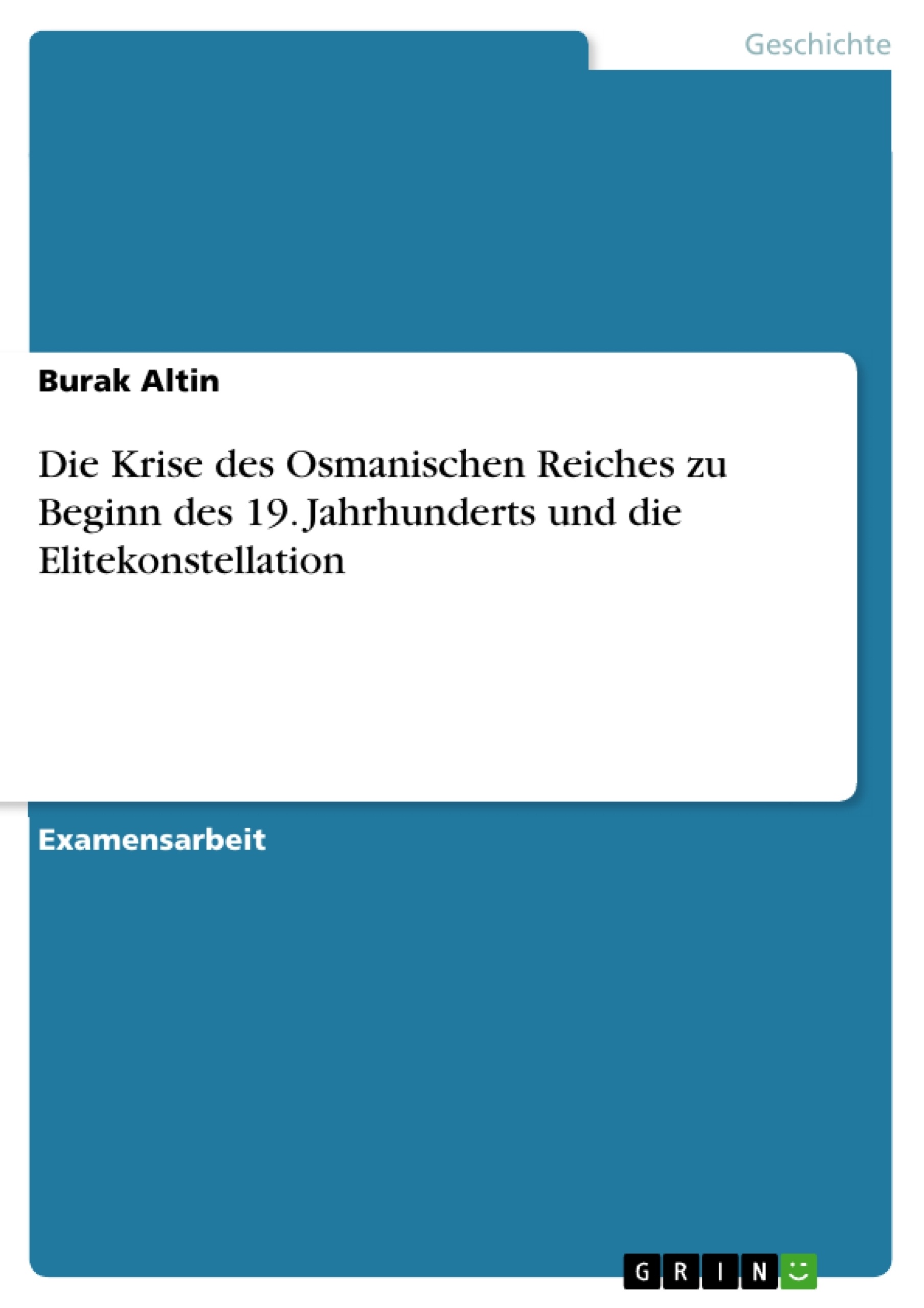In der langen Geschichte des Osmanischen Reiches stellt die Phase zwischen dem letzten Viertel
des 18. Jahrhundert und dem ersten Drittel des 19. Jahrhundert einen Wendepunkt dar, sowohl
militärisch als auch wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich. Noch im 16. und 17. Jahrhundert
erstreckte sich das türkische Großreich über den größten Teil des Balkans bis hin zum Indischen
Ozean, und von der Krim bis zu den Ursprüngen des Nils, und es galt bis ins 18. Jahrhundert hinein
noch als ernstzunehmende internationale Großmacht, die selbst 1780 noch von den europäischen
Staaten als ein mächtiges Gebilde mit Weltrang erachtet wurde.1 Doch mit dem Friedensschluss von
Kücük Kaynarca2, der einen der zahlreichen russisch-türkischen Kriege beendete, begann nicht nur
das kaum aufzuhaltende Vordringen des Zarenreiches auf dem Balkan, sondern auch eine
langfristige externe und - in Folge dessen – interne Krise des Reiches. Aufgrund eines - in allen
Bereichen - explosionsartig expandierenden vormodernen Europas, sahen sich die Osmanen
plötzlich einem Druck von außen ausgesetzt, der, wie sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts
herausstellen sollte, das islamische Imperium in seiner Existenz bedrohen sollte. Die Staats- und
Militärkrisen jener Zeit setzten dem einst mächtigen und erfolgsverwöhnten Reich sehr zu und
einem Moment des Schocks folgte bald das schmerzhafte Eingeständnis in fast allen Belangen den
„Ungläubigen“ unterlegen zu sein. Diese Einsicht war es, die – wie gezeigt werden wird - ein
Umdenken der Eliten im Reich im Bezug auf Europa veranlasste und eine Transformation in Gang
brachte, die sich dann über das „längste Jahrhundert“3 des Reiches, das 19. Jahrhundert hinziehen
sollte, und erst mit dem Untergang des Osmanischen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg ein Ende
nehmen sollte.
Dass dem türkischen Reich dabei nicht das gleiche Schicksal wie anderen außereuropäischen
Großreichen widerfuhr, die - wie z.B. im Falle Chinas oder Indiens – den Druck des Westens nicht
gewachsen waren, vollends in den Einflussbereich der europäischen Großmächte gerieten und
letzten Endes ihre Unabhängigkeit verloren, ist ein Hinweis darauf, dass es im Osmanischen Reich
gelang, gewisse Anpassungen in Politik, Militär und Gesellschaft herbeizuführen, die das Überleben
und die Selbstständigkeit gegenüber dem Kolonialismus des Westens zu verteidigen in der Lage waren.
Inhaltsverzeichnis
- Hinweise zur Transkription und Aussprache
- Die Krise des Osmanischen Reiches zu Beginn des 19. Jahrhunderts und die Elitenkostellation
- Das klassische osmanische Herrschaftssystem
- Ende der klassischen Ordnung
- Ökonomischer Rückstand im 18. Jahrhundert
- Dezentralisierung und Aufstieg der ayan
- Militärische und politische Ereignisse
- Ende der klassischen Ordnung
- Die Eliten und die Krisenzeit
- Existenzkrise und der Machtkampf im Inneren
- Zwischen Alt und Neu
- Selim III. und die neue Sicht auf Europa
- Reformbestrebungen und die Reaktion der Gegeneliten
- Der neue Absolutismus des Mahmud II. (1808-1839)
- Zugeständnisse und Machtsicherung
- Die Sozioökonomie der Macht der ayan
- Der Balkan und Ägypten
- Zerschlagung der Provinzautonomien
- „Das Wohltätige Ereignis“
- Zentralisierung und Verwestlichung
- Der Aufstieg einer neuen Elite: Die neue Bürokratie
- Zwischen Alt und Neu
- Existenzkrise und der Machtkampf im Inneren
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die internen Faktoren, die zu einem Anpassungsschub im Osmanischen Reich um die Wende zum 19. Jahrhundert beitrugen. Der Fokus liegt auf der innenpolitischen Konstellation und der Rolle der Eliten in diesem Transformationsprozess. Die Arbeit basiert auf der Annahme, dass Eliten den Verlauf historischer Prozesse maßgeblich beeinflussen.
- Das klassische osmanische Herrschaftssystem und sein Zerfall
- Der wirtschaftliche und militärische Rückstand des Reiches gegenüber Europa
- Die Rolle der Eliten im Machtkampf und bei Reformen
- Die Reformbemühungen von Sultan Selim III. und Mahmud II.
- Der Wandel der Elitenstruktur und der Aufstieg einer neuen Bürokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Hinweise zur Transkription und Aussprache: Dieses Kapitel bietet eine kurze Anleitung zur Aussprache türkischer Begriffe und Eigennamen, die im Text verwendet werden. Es erläutert die Schreibweise und gibt Hinweise zur korrekten Aussprache verschiedener Buchstabenkombinationen.
Die Krise des Osmanischen Reiches zu Beginn des 19. Jahrhunderts und die Elitenkostellation: Dieses einführende Kapitel beschreibt die Krise des Osmanischen Reiches an der Wende zum 19. Jahrhundert. Es verortet die Krise im Kontext des militärischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels und betont den Verlust von Macht und Einfluss gegenüber europäischen Mächten. Das Kapitel legt den Grundstein für die weitere Analyse, indem es die Bedeutung der Eliten und deren Reaktion auf die Krise hervorhebt. Der Frieden von Küçük Kaynarca wird als Wendepunkt genannt, der das Vordringen Russlands und eine interne Krise des Reiches einleitete. Die Arbeit betont, dass die Fähigkeit des Reiches, sich anzupassen und zu überleben, im Fokus der Untersuchung steht.
Das klassische osmanische Herrschaftssystem: Dieses Kapitel beschreibt das klassische osmanische Herrschaftssystem, das bis Mitte des 17. Jahrhunderts bestand. Es analysiert die Faktoren, die zum Wandel dieses Systems führten, den wirtschaftlichen und militärischen Rückstand des Reiches gegenüber Europa, sowie die daraus resultierenden internen Machtkonstellationen. Es werden die ökonomischen Probleme des 18. Jahrhunderts und die zunehmende Dezentralisierung mit dem Aufstieg der Ayan thematisiert. Die Analyse legt die Grundlage für das Verständnis der nachfolgenden Krisen und Reformen.
Die Eliten und die Krisenzeit: Dieses Kapitel befasst sich mit der Reaktion der Eliten auf die Krise des Reiches. Es analysiert den Machtkampf innerhalb der herrschenden Klasse und die Reformbemühungen der Sultane Selim III. und Mahmud II. Der Fokus liegt auf der Einstellung der Sultane gegenüber dem modernen Europa und wie ihre Maßnahmen die Elitenkonstellation beeinflussten. Die Diskussion um Eliten im Kontext eines islamischen Reiches wird angesprochen, wobei die scheinbare Diskrepanz zwischen islamischem Egalitarismus und der Realität von Eliten und Aristokratien beleuchtet wird.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Analyse der Osmanischen Krise im 19. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand der Analyse in diesem Text?
Der Text analysiert die internen Faktoren, die zu einem Anpassungsschub im Osmanischen Reich um die Wende zum 19. Jahrhundert führten. Der Fokus liegt auf der innenpolitischen Konstellation und der Rolle der Eliten in diesem Transformationsprozess. Die Arbeit basiert auf der Annahme, dass Eliten den Verlauf historischer Prozesse maßgeblich beeinflussen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Analyse behandelt das klassische osmanische Herrschaftssystem und seinen Zerfall, den wirtschaftlichen und militärischen Rückstand des Reiches gegenüber Europa, die Rolle der Eliten im Machtkampf und bei Reformen, die Reformbemühungen von Sultan Selim III. und Mahmud II. sowie den Wandel der Elitenstruktur und den Aufstieg einer neuen Bürokratie.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in jedem Kapitel?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: "Hinweise zur Transkription und Aussprache" (Anleitung zur Aussprache türkischer Begriffe), "Die Krise des Osmanischen Reiches zu Beginn des 19. Jahrhunderts und die Elitenkostellation" (Beschreibung der Krise und die Rolle der Eliten), "Das klassische osmanische Herrschaftssystem" (Analyse des alten Systems und seines Zerfalls), und "Die Eliten und die Krisenzeit" (Reaktion der Eliten auf die Krise, Reformen von Selim III. und Mahmud II.). Ein abschließendes Kapitel bietet eine Zusammenfassung und einen Ausblick.
Welche Rolle spielten die Eliten im Transformationsprozess des Osmanischen Reiches?
Der Text argumentiert, dass die Eliten eine entscheidende Rolle im Transformationsprozess spielten. Ihr Machtkampf, ihre Reaktionen auf die Reformen und ihr Einfluss auf die politische und ökonomische Entwicklung werden eingehend analysiert. Der Aufstieg einer neuen Bürokratie unter Mahmud II. wird als ein wichtiger Aspekt dieses Wandels betrachtet.
Welche Reformen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Reformbemühungen von Sultan Selim III. und Mahmud II. Die Analyse konzentriert sich auf die Motive der Sultane, ihre Maßnahmen und die Reaktion der Eliten auf diese Reformen. Die Frage nach der Modernisierung des Reiches im Kontext des europäischen Einflusses spielt eine wichtige Rolle.
Welche Bedeutung hat der wirtschaftliche und militärische Rückstand für die Krise des Osmanischen Reiches?
Der wirtschaftliche und militärische Rückstand gegenüber Europa wird als wesentlicher Faktor für die Krise des Osmanischen Reiches dargestellt. Dieser Rückstand führte zu internen Machtkämpfen und begünstigte die Dezentralisierung des Reiches.
Wie wird der Frieden von Küçük Kaynarca im Text dargestellt?
Der Frieden von Küçük Kaynarca wird als ein Wendepunkt genannt, der das Vordringen Russlands und eine interne Krise des Reiches einleitete.
Wie wird das klassische osmanische Herrschaftssystem beschrieben?
Das klassische osmanische Herrschaftssystem wird als ein System beschrieben, das bis Mitte des 17. Jahrhunderts bestand. Der Text analysiert die Faktoren, die zum Wandel dieses Systems führten, darunter wirtschaftliche und militärische Probleme sowie die zunehmende Dezentralisierung und den Aufstieg der Ayan.
Gibt es eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse?
Ja, der Text beinhaltet eine Zusammenfassung der Kapitel und einen Ausblick auf die Ergebnisse der Analyse.
- Quote paper
- Burak Altin (Author), 2010, Die Krise des Osmanischen Reiches zu Beginn des 19. Jahrhunderts und die Elitekonstellation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150321