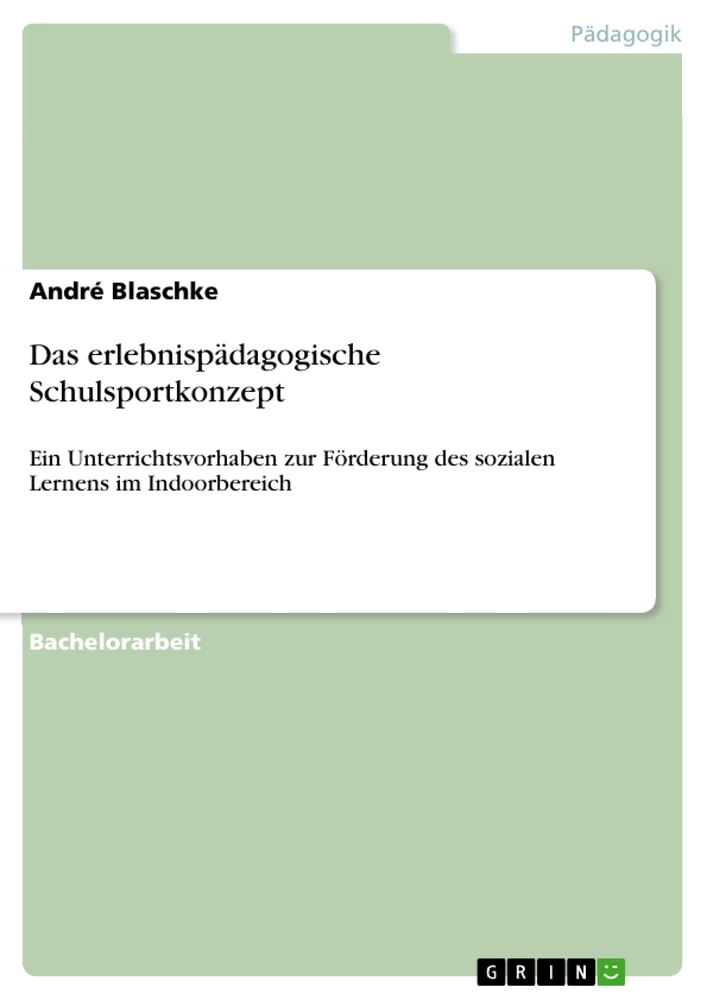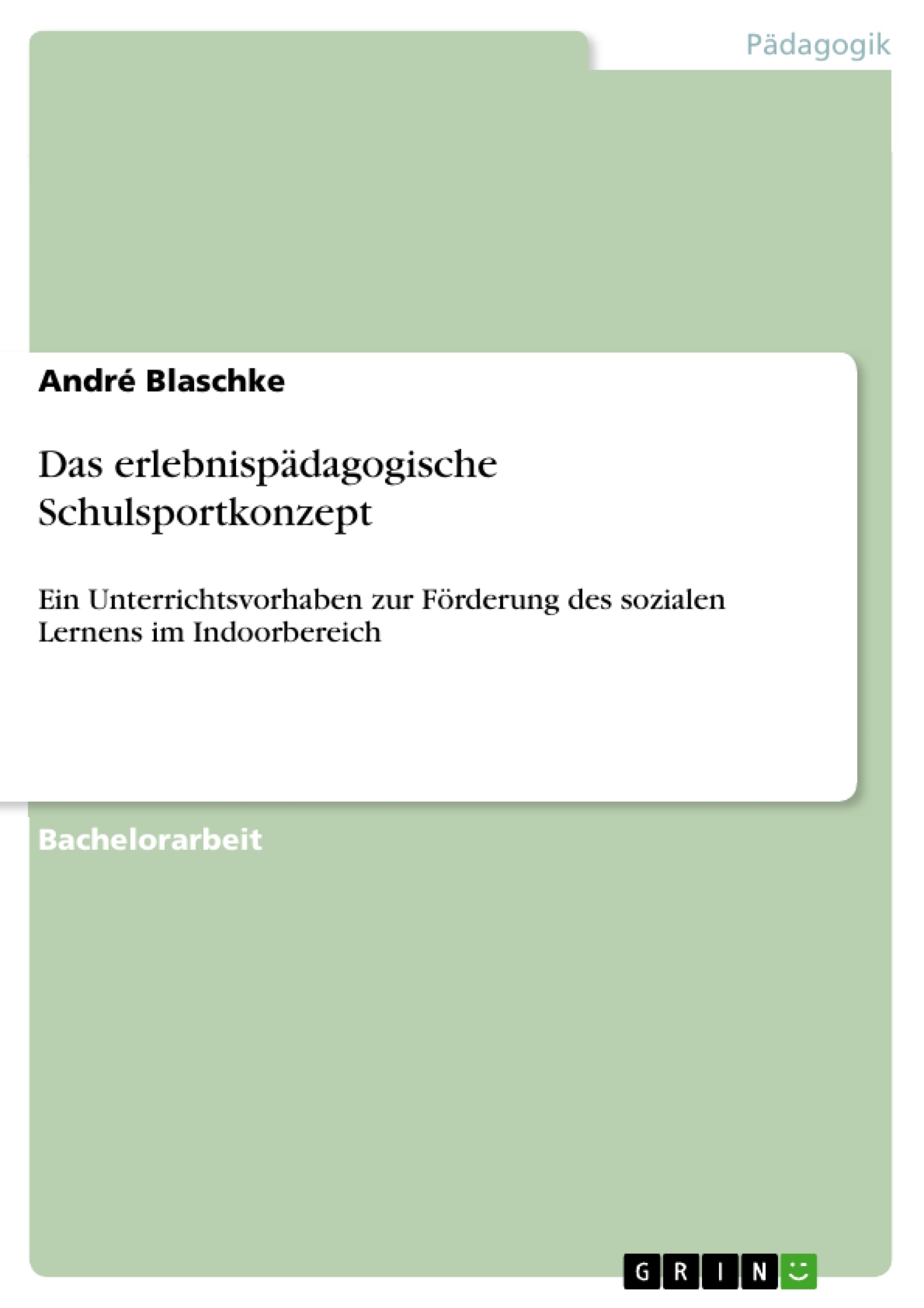Das Besteigen von zerklüfteten Felsen, das Klettern auf hohe Bäume oder das durchstreifen von unbekanntem Gelände sind Naturerlebnisse, welche für heutige Generationen zur Mangelware geworden sind. Kinder früherer Jahrgänge haben bereits von Klein auf in unbebautem Gelände erste, grundlegende Bewegungserfahrungen gesammelt. Auf Grund der zunehmenden Urbanisierung haben die Heranwachsenden des 21. Jahrhunderts kaum noch die Möglichkeit ihren Drang nach Abenteuer und Erlebnis in der „freien Wildbahn“ zu bändigen. Künstlich errichtete Alternativen, wie Erlebnisparks, Erlebnisbäder oder Abenteuerspielplätze müssen entweder bezahlt werden oder lösen in den Kindern und Jugendlichen nur ein kurzes, aber keineswegs einprägsames Erlebnis aus. Zudem stehen ihnen nur künstliche Phantasiewelten im Fernsehen oder in Computerspielen zur Verfügung.
Die Schule hat nun den Auftrag diesem Drang nach Abenteuer, Wagnis und Herausforderung zu bändigen und gleichzeitig zu versuchen, ihn für sich zu Nutze zu machen, um für viele Schüler wieder zu einer „attraktiven Einrichtung“ zu werden, wo sie gerne hingehen und Spaß und Freude haben.
Durch die Gelegenheit, kognitive und motorische Übungen miteinander zu verbinden, erfährt der Sportunterricht hier eine einmalige Stellung.
Erlebnis- und handlungsorientierte Aktivitäten sollen bei Schülern wieder Freude am und im Sport bewirken und diese für ein lebenslanges Sporttreiben motivieren.
Diese Arbeit wurde, v. a. für Lehrer und Übungsleiter, aus dem Hintergrund angefertigt, als Unterrichtsleitfaden für einen erlebnispädagogischen Schulsport zu dienen. Auch verschiedene methodisch - didaktischen Ansätze und Herangehensweisen an dieses noch jungfräuliche Modell werden präsentiert. Das Ziel sollte es sein, Bewegungserlebnisse zu schaffen, welche die Schüler zum Nachdenken anregen und spätere Handlungen, auf Grund dieser Erlebnisse, zu ändern oder zu verbessern.
Da das erlebnispädagogische Schulsportkonzept eine spezielle Form des induktiven Unterrichts darstellt fördert es durch das gemeinsame Erarbeiten von Problemen das soziale Lernen, was nicht nur für andere Unterrichtsfächer, sondern ganz besonders für das tägliche Leben, von enormer Bedeutung ist.
Die Spezialisierung auf den Indoorbereich habe ich vorgenommen, da Spiele und Übungen, welche man im kleinen Raum bzw. in der Sporthalle durchführt, auch immer nach draußen transferiert werden können. Umgekehrt ist dies schwieriger.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Erlebnispädagogik im Schulsport
- "Lernen durch Kopf, Herz und Hand" - Die historische Entwicklung der Erlebnispädagogik von Rousseau bis Hahn
- Das Erlebnis als pädagogisches Mittel" - Der erlebnisorientierte Schulsport
- Die Ausprägung sozialen Lernens im Sportunterricht
- Was ist soziales Lernen?
- Die Bedeutung des sozialen Lernens für den Schulalltag
- Legitimation des erlebnispädagogischen Schulsportkonzeptes durch den brandenburgischen Rahmenlehrplan für die Sekundarstufe I im Fach Sport
- Abschnittsplanung und Stundenentwurf für die Förderung des sozialen Lernens unter Einbeziehung des erlebnispädagogischen Schulsportkonzeptes in der siebten Jahrgangsstufe
- Abschnittsplanung
- Stundenentwurf
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Anwendung des erlebnispädagogischen Schulsportkonzeptes im Indoorbereich zur Förderung des sozialen Lernens. Sie analysiert die historische Entwicklung der Erlebnispädagogik und zeigt die Relevanz des erlebnisorientierten Schulsport für die Motivation und das Interesse von Schülern am Sportunterricht auf.
- Die Bedeutung der Erlebnispädagogik im Schulsport
- Die Förderung des sozialen Lernens durch erlebnispädagogische Methoden
- Die Umsetzung des erlebnispädagogischen Schulsportkonzeptes im Indoorbereich
- Die Entwicklung einer Abschnittsplanung und eines Stundenentwurfs für die praktische Anwendung des Konzeptes
- Die Legitimation des Konzeptes durch den brandenburgischen Rahmenlehrplan
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des erlebnispädagogischen Schulsportkonzeptes ein und beleuchtet die Bedeutung von Naturerlebnissen für die heutige Generation. Sie verdeutlicht den Auftrag der Schule, den Drang nach Abenteuer und Herausforderung bei Schülern zu nutzen, um den Sportunterricht wieder attraktiver zu gestalten. Das erste Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Erlebnispädagogik von Rousseau bis Hahn und stellt die Bedeutung des erlebnisorientierten Schulsport für die Motivation von Schülern dar. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Ausprägung sozialen Lernens im Sportunterricht und erläutert die Bedeutung des sozialen Lernens für den Schulalltag. Das dritte Kapitel legitimiert das erlebnispädagogische Schulsportkonzept durch den brandenburgischen Rahmenlehrplan für die Sekundarstufe I im Fach Sport. Das vierte Kapitel präsentiert eine Abschnittsplanung und einen Stundenentwurf für die Förderung des sozialen Lernens unter Einbeziehung des erlebnispädagogischen Schulsportkonzeptes in der siebten Jahrgangsstufe. Das Kapitel bietet praktische Hinweise für die Umsetzung des Konzeptes im Unterricht. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Potenziale und Herausforderungen des erlebnispädagogischen Schulsportkonzeptes.
Schlüsselwörter
Erlebnispädagogik, Schulsport, Soziales Lernen, Indoorbereich, Abschnittsplanung, Stundenentwurf, Rahmenlehrplan, Motivation, Abenteuer, Herausforderung, Handlungsorientierung, Naturerlebnis, Bewegungserfahrung, Rousseau, Hahn, Brandenburg, Sekundarstufe I, Jahrgangsstufe.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Erlebnispädagogik im Schulsport?
Ziel ist es, durch Abenteuer und Wagnisse die Freude am Sport zu wecken, soziales Lernen zu fördern und die Schüler zur Reflexion ihres Handelns anzuregen.
Warum ist soziales Lernen im Sportunterricht so wichtig?
Durch das gemeinsame Lösen von Problemen in der Gruppe entwickeln Schüler Teamfähigkeit, Empathie und Verantwortungsbewusstsein für das tägliche Leben.
Kann Erlebnispädagogik auch in der Sporthalle stattfinden?
Ja, die Arbeit spezialisiert sich auf den Indoorbereich, da viele Übungen in der Halle durchgeführt und später nach draußen transferiert werden können.
Wer prägte die historische Entwicklung der Erlebnispädagogik?
Wichtige Wegbereiter waren Pädagogen wie Jean-Jacques Rousseau und später Kurt Hahn mit dem Konzept „Lernen durch Kopf, Herz und Hand“.
Ist das Konzept im Lehrplan verankert?
Die Arbeit zeigt die Legitimation des erlebnispädagogischen Konzepts am Beispiel des brandenburgischen Rahmenlehrplans für die Sekundarstufe I auf.
- Quote paper
- André Blaschke (Author), 2009, Das erlebnispädagogische Schulsportkonzept, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150484