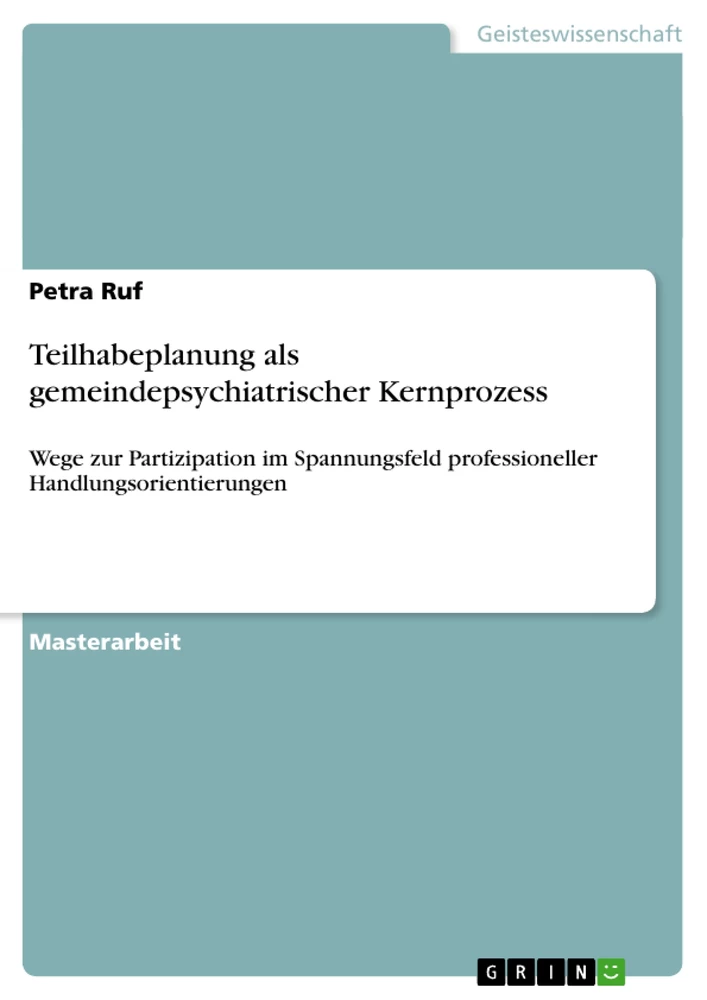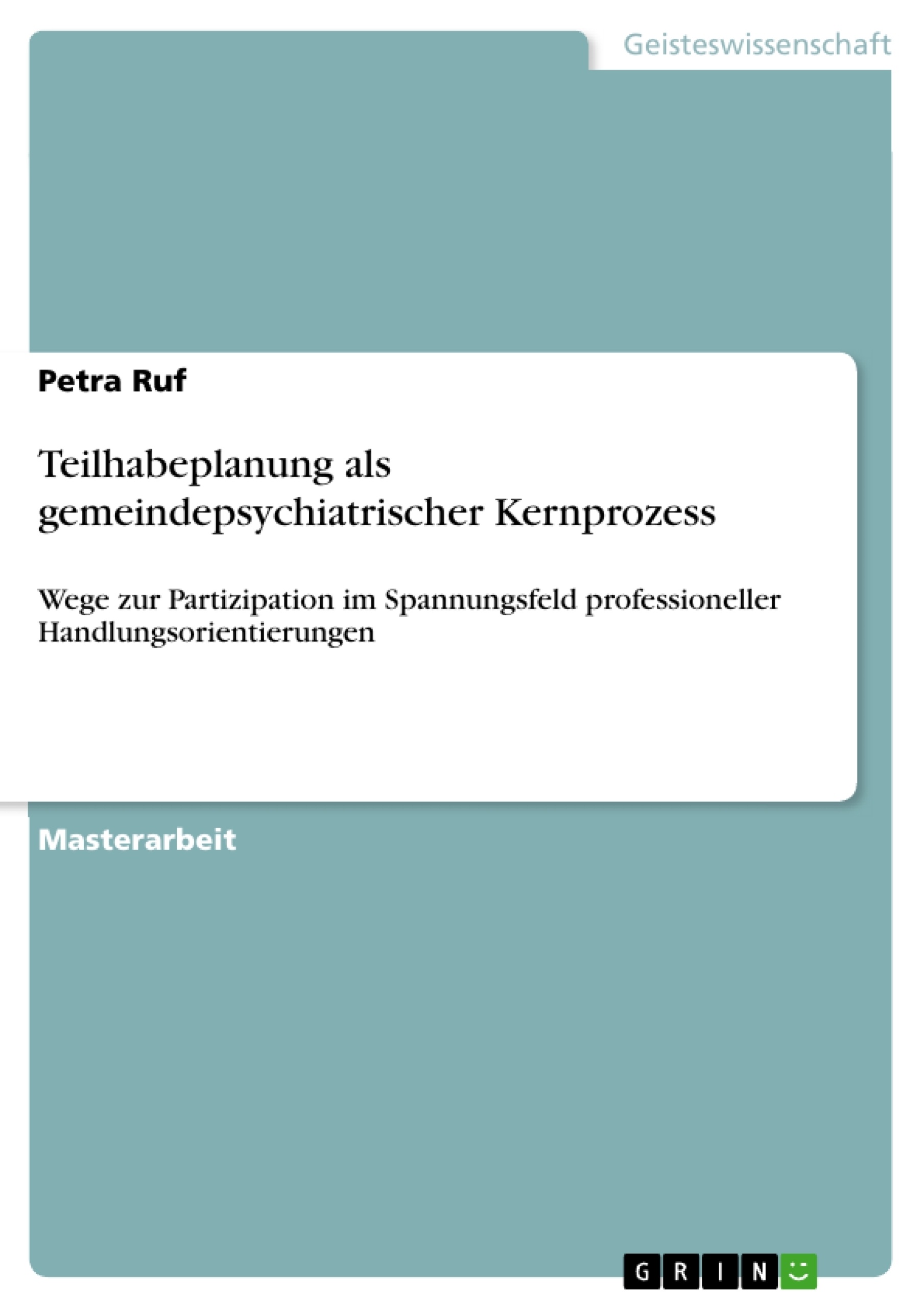Wenn es um die Zukunftsplanung von Menschen mit Behinderung geht, ist das Ergebnis abhängig von den beteiligten Personen. Grundlage für diese Masterarbeit ist die These, dass professionelle Grundhaltungen, Kompetenzen und Bilder der MitarbeiterInnen psychiatrischer Einrichtungen im Prozess der Teilhabeplanung offensichtlich oder verdeckt wirken. Ausgesprochen oder unausgesprochen wirken professionelle Handlungsorientierungen hemmend oder fördernd für die Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gesellschaft.
Die Masterarbeit überprüft in der Anfangsphase des Modellprojekts PerSEH in Hessen folgende Hypothese:
die Praxis der Teilhabe planenden Professionellen (gleichzeitig auch ITP-ErstellerInnen) wird von handlungsleitenden Orientierungen mitbestimmt. Diese können für die Bereiche
- Berufsrollenverständnis
- Sinnhorizonte bzw. Leitdifferenzen
- Bild vom/von der NutzerIn
- Verständnis von Teilhabeplanung
- Praxis der Kommunikation bei der Teilhabeplanerstellung
- Kompetenzen
thematisch erfasst und rekonstruktiv interpretiert werden. Leitdifferenzen und Qualitätsaspekte werden deutlich, z.B. bezüglich
- dem ITP als Medium der Teilhabeplanung und Hilfebeantragung
- des Gesamtprojekts PerSEH/Praxistest in Hessen
Zunächst werden aktuelle gesellschaftliche, rechtliche und sozialpolitische Entwicklungen diskutiert und die relevanten Ergebnisse einer ersten Auswertung aus qualitativen und quantitativen Befragungen präsentiert. Auf einer konstruktivistisch-systemtheoretischen Hintergrundfolie wird die qualitative Analyse mit Hilfe der dokumentarischen Methode der rekonstruktiven Sozialforschung von Bohnsack (2007) multiperspektivisch vertieft.
Die Darstellung der Ergebnisse und die Diskussion machen deutlich, dass Teilhabeplanung der Kernprozess ist; hier werden Teilhabechancen verteilt.
Den Professionellen werden im Spannungsfeld unterschiedlicher Aufträge außerordentlich vielfältige Handlungskompetenzen und reflektierte Handlungsorienterungen abverlangt, um im Zusammenwirken mit den NutzerInnen bestmögliche Teilhabe zu gestalten.
Integrierte Teilhabeplanung ist nur unter bestimmten Rahmenbedingungen möglich: sie muss eingebettet sein in ein umfassendes koopetitives und vom Leistungsträger i. S. seiner Pflichtaufgabe zur Daseinsvorsorge federführend getragenes Gesamtsystem.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Aktuelle Veränderungen
- 2.1 Gesellschaftliche Veränderungen
- 2.2 Bundesweite Entwicklungen in der Psychiatrie
- 2.3 Begriffsbestimmung
- 2.3.1 Menschenrechte und Behindertenrechte
- 2.3.2 Teilhabe
- 2.3.3 Medizinische und sozialpädagogische Diagnosekonzepte und das Teilhabekonzept der „International Classification of Functioning, Disability and Health\", ICF
- 2.3.4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)
- 2.4 Menschenrechte, Teilhabe und Sozialrecht – angemessene Verfahren
- 2.5 Wandel der Administration in ein öffentliches Dienstleistungsunternehmen
- 2.5.1 Das neue Steuerungsmodell
- 2.5.2 Aktuelle Verlautbarungen der Bundesarbeitsgemeinschaft überörtlicher Sozialhilfeträger (BAGÜS)
- 2.6 Wandel der „Versorgungslandschaft“ – Zusammenarbeit der Leistungserbringer
- 2.7 Qualität sozialpsychiatrischer Leistungen
- 3 Das Handlungsforschungsprojekt als Forschungsarbeit zum „Praxistest Integrierte Teilhabeplanung (ITP) in Wiesbaden“
- 3.1 Vorerfahrungen und Ausgangslage in Hessen
- 3.1.1 Organisation
- 3.1.2 Vorläuferprojekte
- 3.1.2.1 Verfahren und Instrumente
- 3.1.2.2 Finanzierung
- 3.1.2.3 Konzeptentwicklung Gesamtsteuerung
- 3.2 Der Praxistest
- 3.2.1 Projektregion
- 3.2.2 Zielgruppen
- 3.2.3 Weiterentwicklung
- 3.2.4 Projektvereinbarungen und Ziele, Auftrag und Auftraggeber
- 3.2.5 Ablauf des Praxistests
- 3.2.6 Stakeholder des Implementationsprojekts Hessen
- 3.3 Das Handlungsforschungsprojekt
- 3.3.1 Quantitative und qualitative Methoden des Gesamtprojekts
- 3.3.2 Auseinandersetzung mit dem ITP – methodische Schritte
- 3.3.3 Forschungsethische Entscheidungen
- 3.3.4 Arbeitshypothesen
- 3.3.5 Erkenntnisinteresse und Forschungsfragen
- 3.3.5.1 Forschungsfragen der quantitativen Befragung
- 3.3.5.2 Forschungsfragen zu den Gruppendiskussionen
- 3.3.5.3 Forschungsfragen zur Anwendung des ITP
- 3.3.6 Methoden und Vorgehen
- 3.3.6.1 Methode und Vorgehen bei der quantitativen Befragung
- 3.3.6.2 Methode und Vorgehen: Qualitative Gruppendiskussion
- 3.3.6.3 Vorgehen bei der qualitativen Auswertung der ITP
- 3.3.7 Aussagen und Trends der Erhebungen
- 3.3.7.1 Aussagen der quantitativen Forschung
- 3.3.7.2 Aussagen der Gruppendiskussionen
- 3.3.7.3 Aussagen zur ITP-Auswertung
- 3.3.7.4 Zusammenfassung aller Ergebnisse in Bezug auf die Forschungsfragen
- 3.3.8 Ausblick und Folgeüberlegungen
- 3.1 Vorerfahrungen und Ausgangslage in Hessen
- 4 Systemtheoretisch-Konstruktivistische Ansätze als Hintergrundfolie
- 4.1 Der Konstruktivismus
- 4.1.1 Der/die „neutrale“ BeobachterIn
- 4.1.2 Subjekt-Objekt
- 4.1.3 Ursache - Wirkung?
- 4.1.4 Konstruktivistisches Denken in der Postmoderne
- 4.2 Systemtheoretische Grundlagen
- 4.2.1 Beteiligte Systeme
- 4.2.2 Kommunikation als Organisationsprinzip
- 4.3 Systemmerkmale
- 4.3.1 Funktionale Differenzierung
- 4.3.2 Systemzweck
- 4.3.3 Autopoiesis und operative Geschlossenheit
- 4.3.4 Komplexität und Kontingenz
- 4.3.5 Sinn-generalisierte Kommunikationsmedien - Codes
- 4.3.6 Zeitliche Komplexität
- 4.3.6.1 Emergenz
- 4.3.6.2 Selbstreferentialität
- 4.3.6.3 Evolutionsmodell der Veränderung
- 4.4 Essenz für die Praxis
- 4.1 Der Konstruktivismus
- 5 Forschung in systemtheoretisch-konstruktivistischer Sichtweise
- 5.1 Folgerungen für qualitative Forschung
- 5.1.1 Zur Analyse der ITP
- 5.1.2 Analyse handlungsleitender Orientierungen von ITP-ErstellerInnen
- 5.2 Stand der Forschung im Hinblick auf Teilhabeplanung
- 5.3 Neue Hypothese und Forschungsfragen
- 5.4 Die Hypothese
- 5.5 Methode
- 5.5.1 Methodenwahl
- 5.5.2 Datengrundlage und Stichprobe
- 5.5.3 Zur Auswahl des Datenmaterials
- 5.6 Dokumentarische Evaluationsforschung – Formulierende Interpretation
- 5.6.1 Formulierende Interpretation bei der Gruppendiskussion
- 5.6.1.1 Thematische Gliederung der Gruppendiskussion Leistungserbringer/ITP-ErstellerInnen
- 5.6.1.2 Erste zusammenfassende Orientierung und Interpretation der gesamten Gruppendiskussion
- 5.6.2 Formulierende Interpretation des ITP
- 5.6.2.1 Thematische Gliederung des ITP
- 5.6.2.2 Professionelles Handeln - in Verben des ITP thematisiert
- 5.6.1 Formulierende Interpretation bei der Gruppendiskussion
- 5.7 Dokumentarische Evaluationsforschung – Reflektierende Interpretation
- 5.7.1 Reflektierende Interpretation der Gruppendiskussion
- 5.7.1.1 Gruppendiskussion, Passage 1, 30-103: Anwendung des ITP:
- 5.7.1.2 Gruppendiskussion - Passage 2, 200-280: der ITP und die Sicht der NutzerInnen - auch der Sicht der Teilhabe Planenden
- 5.7.1.3 Gruppendiskussion - Passage 3, 308-383: Umgang mit Frustrationen bei KlientInnen
- 5.7.2 Reflektierende Interpretation der Integrierten Teilhabeplanung - ITP
- 5.7.2.1 Reflektierende Interpretation - Ziele und Ressourcen im ITP
- 5.7.2.2 Reflektierende Interpretation - Fallexterner Vergleich der ITP-ErstellerInnen aus allen Beispiel-ITP
- 5.7.2.3 Vergleichshorizonte der Beispiel- ITP fallintern
- 5.7.2.4 Vergleichshorizonte der Teilhabeplanenden - fallübergreifend:
- 5.7.2.5 Typenbildung
- 5.7.1 Reflektierende Interpretation der Gruppendiskussion
- 5.1 Folgerungen für qualitative Forschung
- 6 Zusammenführung der Ergebnisse in der Zusammenschau von Gruppendiskussion und Teilhabeplanung und Interpretation in Bezug auf die Forschungsfragen
- 6.1 Zur Hypothese
- 6.2 Darstellung der Ergebnisse, Interpretation und mögliche Handlungsansätze im Hinblick auf die Forschungsfragen
- 6.2.1 Aussagen zur Einführung einer neuen Systematik
- 6.2.2 Handlungsleitende Orientierungen der Teilhabe Planenden
- 6.2.3 Bilder der Teilhabe Planenden vom Nutzer, von der Nutzerin
- 6.2.4 Das Planungsverständnis der Teilhabe Planenden
- 6.2.5 Die Praxis der Kommunikation bei der Erstellung des integrierten Teilhabeplans
- 6.2.6 Die Handlungskompetenzen der Teilhabe Planenden
- 6.2.7 Das Berufsrollenprofil der Teilhabe Planenden
- 6.2.8 Die Aussagen der Teilhabe Planenden zum Medium ITP
- 6.2.9 Bewertung des Gesamtprojekts PerSEH/Praxistest
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Implementierung der Integrierten Teilhabeplanung (ITP) in Hessen. Ziel ist es, die Erfahrungen und Perspektiven der beteiligten Akteure zu analysieren und Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche Umsetzung zu entwickeln. Die Forschungsarbeit stützt sich auf qualitative und quantitative Methoden.
- Analyse der ITP-Implementierung in der Praxis
- Handlungsleitende Orientierungen der ITP-ErstellerInnen
- Kommunikationsprozesse während der ITP-Erstellung
- Wirkung der ITP auf die Teilhabe der NutzerInnen
- Systemtheoretisch-konstruktivistische Betrachtung der Teilhabeplanung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den beruflichen Hintergrund des Autors im Bereich der Gemeindepsychiatrie und seine Erfahrungen mit Hilfeplanungsprozessen. Sie verdeutlicht die Notwendigkeit der Untersuchung der ITP aufgrund von positiven und negativen Reaktionen auf geplante Veränderungen im System. Die Einleitung legt den Grundstein für die Forschungsarbeit, indem sie die Komplexität der Hilfeplanung und die unterschiedlichen Interpretationen von Konzepten wie Personenzentrierung und Teilhabe hervorhebt. Der Autor betont, dass das Verständnis und die Umsetzung dieser Konzepte von divergierenden Interessen geprägt sind, was die Notwendigkeit einer fundierten Untersuchung unterstreicht.
2 Aktuelle Veränderungen: Dieses Kapitel beleuchtet den aktuellen Kontext der sozialpsychiatrischen Versorgung in Deutschland. Es beschreibt gesellschaftliche Veränderungen, bundesweite Entwicklungen in der Psychiatrie und die damit einhergehende Bedeutung von Menschenrechten, Teilhabe und Sozialrecht. Das Kapitel analysiert die Begriffsbestimmung von zentralen Konzepten wie Teilhabe und die Rolle des SGB IX. Es beleuchtet den Wandel der Administration hin zu einem öffentlichen Dienstleistungsunternehmen, inklusive neuer Steuerungsmodelle und Verlautbarungen der BAGÜS. Schließlich wird der Wandel der Versorgungslandschaft und die Zusammenarbeit der Leistungserbringer thematisiert, inklusive der Qualitätsaspekte sozialpsychiatrischer Leistungen.
3 Das Handlungsforschungsprojekt als Forschungsarbeit zum „Praxistest Integrierte Teilhabeplanung (ITP) in Wiesbaden“: Dieses Kapitel beschreibt das Handlungsforschungsprojekt, das als Grundlage der Arbeit dient. Es detailliert die Vorerfahrungen und die Ausgangslage in Hessen, inklusive der Organisation, Vorläuferprojekte (Verfahren, Instrumente, Finanzierung, Konzeptentwicklung), sowie die Projektregion, Zielgruppen, Weiterentwicklung, Vereinbarungen und Ziele, Ablauf des Praxistests und die Stakeholder. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der quantitativen und qualitativen Methoden, der Forschungsethischen Entscheidungen, der Arbeitshypothesen, des Erkenntnisinteresses und der Forschungsfragen. Die Methoden und das Vorgehen bei der quantitativen Befragung, der qualitativen Gruppendiskussion und der qualitativen Auswertung der ITP werden präzise dargelegt. Die Kapitel beschreibt ebenfalls die Aussagen und Trends der Erhebungen aus quantitativer und qualitativer Forschung sowie die Zusammenfassung der Ergebnisse in Bezug auf die Forschungsfragen und den Ausblick.
4 Systemtheoretisch-Konstruktivistische Ansätze als Hintergrundfolie: Dieses Kapitel erläutert die theoretischen Grundlagen der Arbeit, indem es systemtheoretisch-konstruktivistische Ansätze vorstellt. Es definiert den Konstruktivismus, inklusive der Betrachtung von neutralen Beobachtern, Subjekt-Objekt-Beziehungen und Ursachen-Wirkungszusammenhängen im Kontext der Postmoderne. Es werden systemtheoretische Grundlagen eingeführt, wie beteiligte Systeme, Kommunikation als Organisationsprinzip und die Beschreibung von Systemmerkmalen wie funktionale Differenzierung, Systemzweck, Autopoiesis, Komplexität, Kontingenz, Sinn-generalisierte Kommunikationsmedien und zeitliche Komplexität (Emergenz, Selbstreferentialität, Evolutionsmodell). Die Essenz dieser Ansätze für die Praxis wird schließlich herausgearbeitet.
5 Forschung in systemtheoretisch-konstruktivistischer Sichtweise: Kapitel 5 fokussiert auf die methodische Herangehensweise der Forschungsarbeit. Es leitet aus den systemtheoretisch-konstruktivistischen Ansätzen Folgerungen für die qualitative Forschung ab und analysiert den Stand der Forschung im Hinblick auf Teilhabeplanung. Eine neue Hypothese und die dazugehörigen Forschungsfragen werden formuliert. Die Kapitel beschreibt die gewählte Methode (dokumentarische Evaluationsforschung), die Datengrundlage, die Stichprobe und die Auswahl des Datenmaterials. Sowohl die formulierende als auch die reflektierende Interpretation der Gruppendiskussionen und der ITP werden detailliert beschrieben und analysiert, inklusive der thematischen Gliederung, der Interpretation professionellen Handelns und fallinterner und -übergreifender Vergleiche. Die Typenbildung wird als methodisches Vorgehen erläutert.
6 Zusammenführung der Ergebnisse in der Zusammenschau von Gruppendiskussion und Teilhabeplanung und Interpretation in Bezug auf die Forschungsfragen: Dieses Kapitel integriert die Ergebnisse aus den vorangegangenen Kapiteln und analysiert sie im Kontext der Forschungsfragen. Es beleuchtet die Hypothese, die Ergebnisse und mögliche Handlungsansätze. Die Kapitel analysiert die Aussagen zur Einführung einer neuen Systematik, die handlungsleitenden Orientierungen der Teilhabeplanenden, ihre Bilder von den NutzerInnen, ihr Planungsverständnis, ihre Kommunikationspraxen, ihre Handlungskompetenzen, ihr Berufsrollenprofil, ihre Aussagen zum Medium ITP und schließlich eine Bewertung des Gesamtprojekts.
Schlüsselwörter
Integrierte Teilhabeplanung (ITP), Handlungsforschung, qualitative Forschung, quantitative Forschung, Systemtheorie, Konstruktivismus, Teilhabe, Sozialpsychiatrie, Gemeindepsychiatrie, SGB IX, Hessen, Kommunikation, Professionelles Handeln, Nutzerperspektiven.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Forschungsarbeit: Implementierung der Integrierten Teilhabeplanung (ITP) in Hessen
Was ist der Gegenstand dieser Forschungsarbeit?
Die Forschungsarbeit untersucht die Implementierung der Integrierten Teilhabeplanung (ITP) in Hessen. Sie analysiert die Erfahrungen und Perspektiven der beteiligten Akteure (ITP-ErstellerInnen, NutzerInnen, etc.) und entwickelt daraus Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche Umsetzung.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Studie kombiniert qualitative und quantitative Forschungsmethoden. Qualitative Methoden umfassen Gruppendiskussionen und die qualitative Auswertung der ITP-Dokumente. Quantitative Methoden werden ebenfalls eingesetzt, jedoch sind die Details in der gegebenen Vorschau nicht vollständig ausgeführt.
Welche theoretischen Ansätze liegen der Arbeit zugrunde?
Die Arbeit stützt sich auf systemtheoretisch-konstruktivistische Ansätze. Der Konstruktivismus und die Systemtheorie bilden die theoretische Grundlage für die Analyse der Daten und die Interpretation der Ergebnisse. Konzepte wie Autopoiesis, Komplexität, Kommunikation und die Rolle des Beobachters werden berücksichtigt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: 1. Einleitung, 2. Aktuelle Veränderungen im Kontext der Sozialpsychiatrie, 3. Beschreibung des Handlungsforschungsprojekts zum Praxistest der ITP in Wiesbaden, 4. Systemtheoretisch-konstruktivistische Grundlagen, 5. Methodische Ausführungen zur Forschung in systemtheoretisch-konstruktivistischer Sichtweise (inkl. dokumentarischer Evaluationsforschung), 6. Zusammenführung der Ergebnisse und Interpretation in Bezug auf die Forschungsfragen.
Welche Zielgruppen werden in der Studie betrachtet?
Die Studie untersucht die Perspektiven verschiedener Akteure, darunter die ITP-ErstellerInnen (Leistungserbringer), die NutzerInnen der ITP und weitere Stakeholder des Implementationsprojekts in Hessen. Die genauen Zielgruppen werden im Kapitel 3 detailliert beschrieben.
Welche Forschungsfragen werden bearbeitet?
Die Forschungsarbeit untersucht verschiedene Aspekte der ITP-Implementierung. Die genauen Forschungsfragen werden in Kapitel 3 und 5 dargelegt und umfassen u.a. die Analyse der handlungsleitenden Orientierungen der ITP-ErstellerInnen, die Kommunikationsprozesse während der ITP-Erstellung und die Wirkung der ITP auf die Teilhabe der NutzerInnen. Sowohl quantitative als auch qualitative Forschungsfragen werden formuliert.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der Studie werden in Kapitel 6 zusammengeführt. Sie umfassen u.a. Aussagen zur Einführung neuer Systematiken, die handlungsleitenden Orientierungen der Teilhabeplanenden, deren Bilder von den NutzerInnen, das Planungsverständnis, die Kommunikationspraxen, Handlungskompetenzen und das Berufsrollenprofil. Eine Bewertung des Gesamtprojekts wird ebenfalls vorgenommen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Integrierte Teilhabeplanung (ITP), Handlungsforschung, qualitative Forschung, quantitative Forschung, Systemtheorie, Konstruktivismus, Teilhabe, Sozialpsychiatrie, Gemeindepsychiatrie, SGB IX, Hessen, Kommunikation, Professionelles Handeln, Nutzerperspektiven.
Wo kann ich die vollständige Arbeit finden?
Die vollständige Arbeit ist in dieser Vorschau nicht enthalten. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit der vollständigen Forschungsarbeit sind nicht enthalten.
Welche Bedeutung hat das SGB IX für die Studie?
Das SGB IX (Sozialgesetzbuch IX) spielt eine wichtige Rolle im Kontext der Studie, da es den rechtlichen Rahmen für Teilhabe und die damit verbundenen Planungs- und Umsetzungsprozesse vorgibt. Die Studie analysiert die Relevanz des SGB IX für die ITP-Implementierung.
- Citation du texte
- M.A. Social Work Petra Ruf (Auteur), 2009, Teilhabeplanung als gemeindepsychiatrischer Kernprozess, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150848