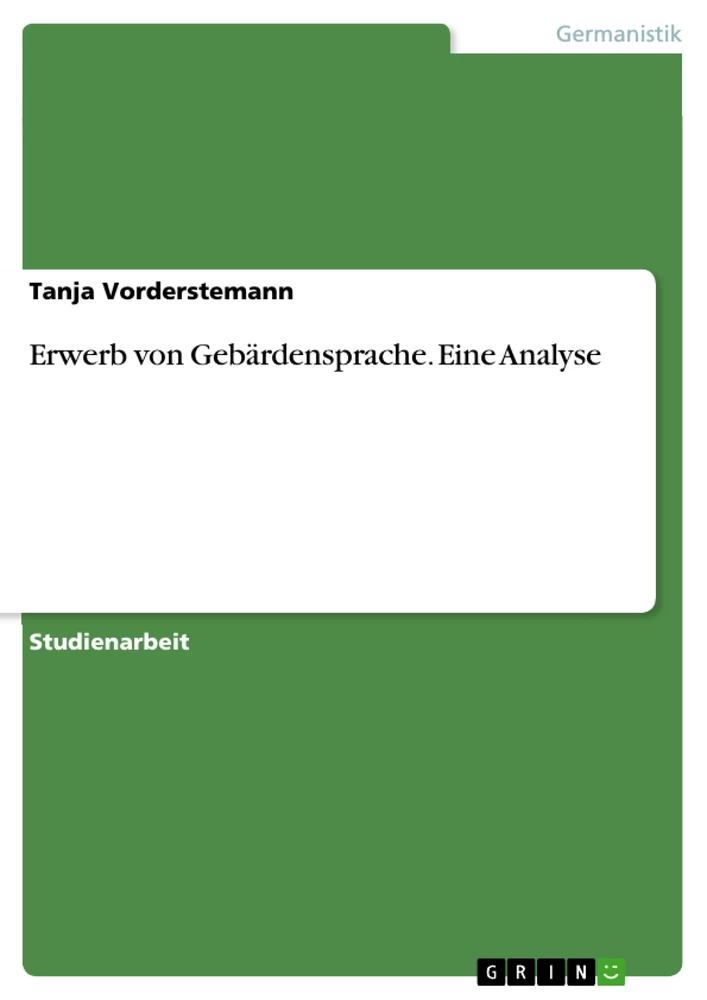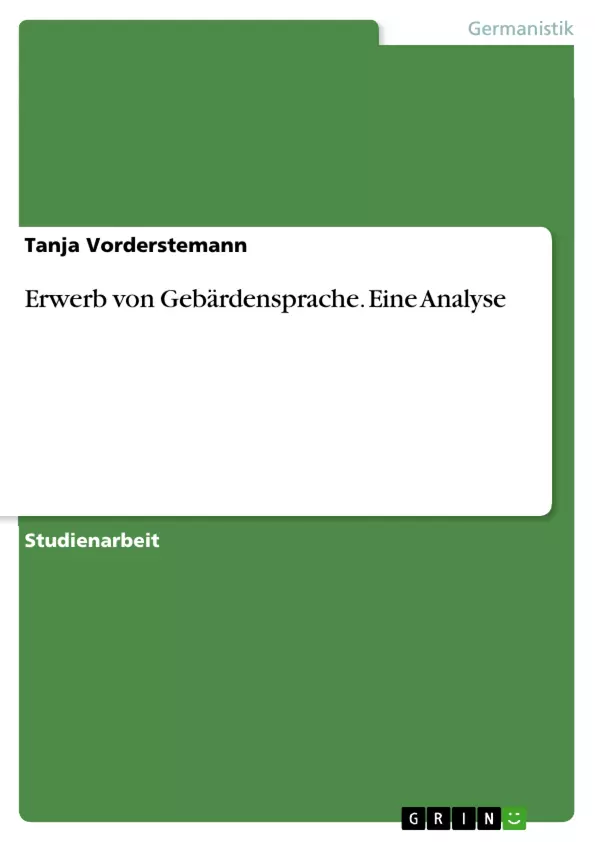Wie alle Gebärdensprachen ist auch die Deutsche Gebärdensprache eine visuell-motorische Sprache. Sie besitzt ein differenziertes Regelsystem, das sich
mit Hilfe von manuellen, sowie nicht-manuellen Mitteln ausdrückt. Ebenso wie die Lautsprachen unterliegen die Gebärdensprachen den gleichen sprachspezifischen Beschränkungen. In der Arbeit wird sowohl ihre grammatische Struktur und ihre Bildhaftigkeit dargestellt, als auch der Erwerb der Gebärdensprache - hinsichtlich Spracherwerb und Sprachverarbeitung - erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundzüge der Gebärdensprache
- Modalität
- Bildhaftigkeit
- Die grammatischen Module
- Erwerb von Gebärdensprachen
- Die Spracherwerbsfähigkeit
- Bilingualismus in zwei Modalitäten
- Die kritische Phase des Spracherwerbs
- Babbeln
- Wörter und Gebärden
- Kombinationen von Gebärdenwörtern
- Erwerb der phonologischen Einheiten
- Erwerb der Handformen
- Erwerb der Ausführungsstellen
- Erwerb des Fingeralphabets
- Die Sprachverarbeitung
- Erwerb des Wortschatzes
- Die Autonomie des Sprachsystems
- Studie von Ricke, Bettger & Klima (1995)
- Vom Lexikon zur Grammatik
- Grammatische Nutzung der Mimik
- Frühe Überlegenheit in der Raumverarbeitung
- Sprachliche Erfahrungen und Spracherwerb
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Erwerb der Gebärdensprache bei gehörlosen Kindern mit gehörlosen Eltern und vergleicht diesen mit dem Lautsprachenerwerb hörender Kinder. Sie analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Lernprozessen und beleuchtet die strukturellen Besonderheiten der Gebärdensprache im Vergleich zur Lautsprache. Die Arbeit beleuchtet die Frage, ob Gehörlosigkeit ein Defizit darstellt und hinterfragt die historische Entwicklung des Verständnisses von Gebärdensprache und ihrer Bedeutung für die sprachliche Entwicklung.
- Spracherwerbsfähigkeit bei gehörlosen Kindern
- Vergleich von Gebärdensprach- und Lautsprachentwicklung
- Strukturelle Besonderheiten von Gebärdensprachen
- Historische Entwicklung des Verständnisses von Gebärdensprache
- Die Rolle der Gebärdensprache für die kognitive Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Gebärdenspracherwerb vor dem Hintergrund der Situation hörgeschädigter Menschen in Deutschland dar und skizziert die Forschungsfrage, die im Mittelpunkt der Arbeit steht.
- Grundzüge der Gebärdensprache: Dieses Kapitel beleuchtet die modalitätsspezifische Natur der Gebärdensprache als visuell-motorische Sprache und hinterfragt die Rolle der Bildhaftigkeit in der Sprache. Es geht auch auf die grammatischen Module der Gebärdensprache ein.
- Erwerb von Gebärdensprachen: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Aspekten des Gebärdenspracherwerbs, wie die Spracherwerbsfähigkeit, Bilingualismus in zwei Modalitäten und die kritische Phase des Spracherwerbs. Es analysiert Phänomene wie das Babbeln, die Entwicklung des Wortschatzes und die Rolle der phonologischen Einheiten im Erwerbsprozess.
- Sprachliche Erfahrungen und Spracherwerb: Dieses Kapitel beleuchtet den Einfluss von sprachlichen Erfahrungen auf den Spracherwerb. Es diskutiert die Auswirkungen der Umgebung und der Interaktion auf die sprachliche Entwicklung.
Schlüsselwörter
Gebärdensprache, Lautsprache, Spracherwerb, Gehörlosigkeit, Modalität, Bildhaftigkeit, Grammatik, Bilingualismus, kritische Phase, Sprachverarbeitung, Wortschatz, Sprachliche Erfahrungen, Kognition, Defizit, historische Entwicklung, Sprachforschung.
- Citar trabajo
- Tanja Vorderstemann (Autor), 2002, Erwerb von Gebärdensprache. Eine Analyse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15096