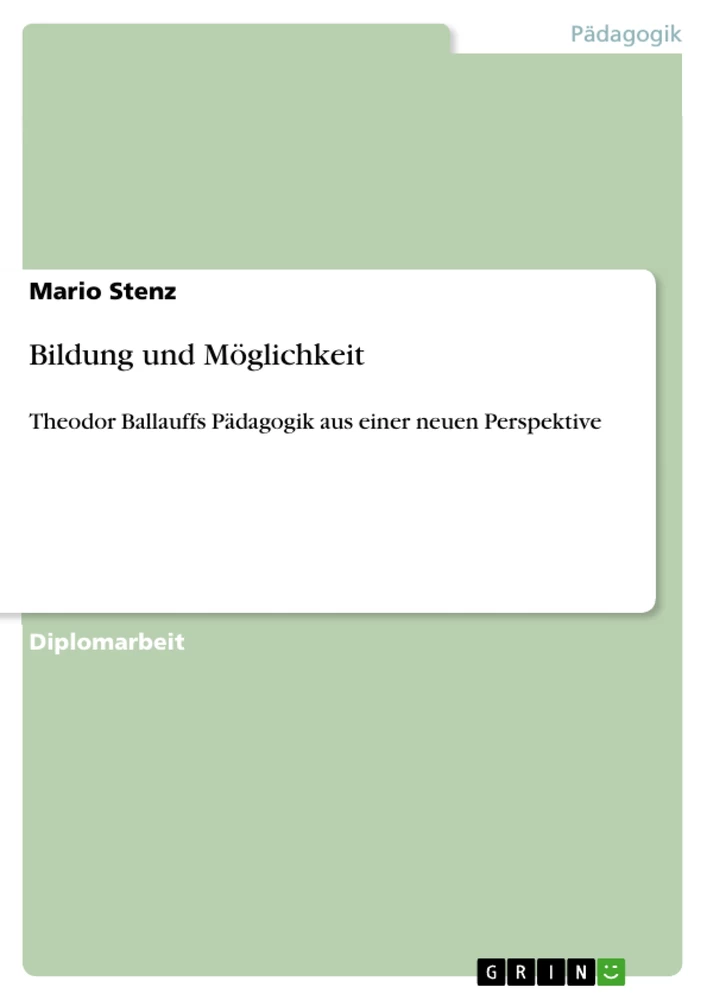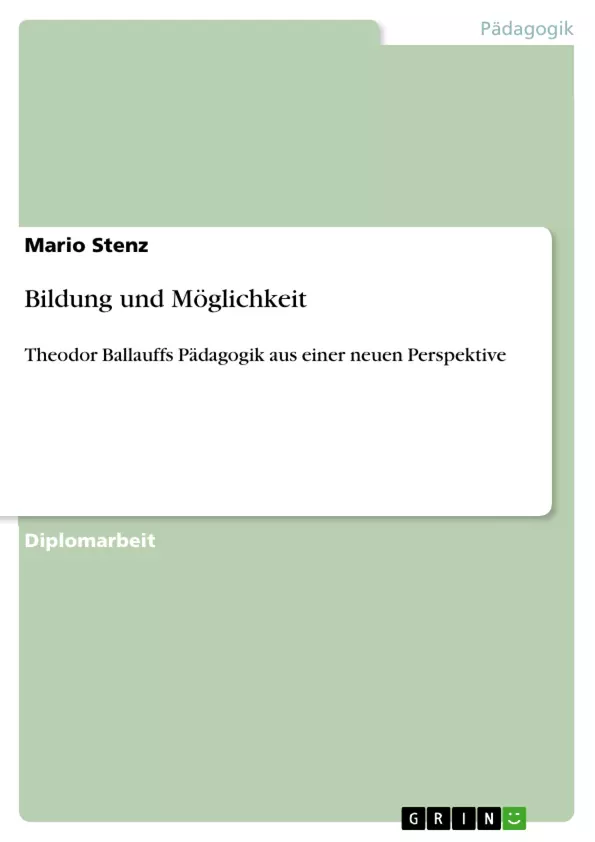„An uns Menschen ist zunächst nur bemerkenswert, daß wir denken; sonst bliebe alles im Dunkeln.“ (Ballauff 2004, S.32). Und dieser schlichten wie bemerkenswerten Faktizität der Menschen, dem Fakt, daß wir mit Denken ausgezeichnet sind sowie den sich daraus ergebenden pädagogischen Implikationen, widmet sich die vorliegende Diplomarbeit aus bildungsphilosophischer Sicht.
Sie befasst sich in diesem Zusammenhang als bildungstheoretische Grundlagenforschung mit dem Pädagogikverständnis und Bildungsbegriff des Mainzer Bildungstheoretikers Theodor Ballauff (1911-1995). Der besondere Interpretationsfokus von Ballauffs philosophischer Pädagogik liegt dabei, wie der Titel andeutet, auf dem Begriff der Möglichkeit, der in dreifacher Weise die Frageperspektive der Arbeit leitet:
Ersten wird herausgestellt wie eine alternative, antithetische Grundlegung von Pädagogik, entgegen den gängigen anthropologischen, ethischen und sozialisationstheoretischen Begründungen von Erziehung und Bildung, möglich ist. Die Grundlage liegt für Ballauff im Denken. Dieses „Denken“ als unumgängliche und konstitutive Möglichkeitsbedingung unserer Selbst- und Weltauffassung wird ausführlich analysiert und in seinen Strukturmomenten zur Sprache gebracht.
In einem zweiten Schritt erfolgt eine Erläuterung der Ermöglichung von Bildung. Bildung versteht Theodor Ballauff als „Selbständigkeit im Denken“. Dazu wird, ausgehend von sozialisationstheoretischen Überlegungen und der sozial-historischen Bedingtheit einer begrenzenden Wirklichkeitsauffassung, eine pädagogische Vorgehensweise dargestellt, die Bildung ermöglichen kann.
Drittens wird dargelegt, was im Rahmen des Möglichen liegt, wenn Bildung als gedanklich radikale Selbstständigkeit verwirklicht ist. Dazu werden sechs Merkmale von Bildung ausgearbeitet und auf den Begriff gebracht.
Zum Schluss wird in einer Apologetik versucht starke Argumente dafür vorzubringen, warum es aufgrund des historischen Status quo geboten sein könnte Bildung im ausgearbeiteten Sinne zu ermöglichen.
Abschließend, neben kurz angerissenen Forschungsausblicken, werden zwei Fragen aufgeworfen und reflektiert: Zum einen warum Ballauffs Werk in Anbetracht der daraussprechend gedanklichen Radikalität sowie theoretischen Trag- und Reichweite bisher nur wenig rezipiert wurde. Und zum anderen wird der Frage nachgegangen, welche fundamentalen Probleme bei der Umsetzung des ausgearbeiteten Bildungskonzepts auftreten können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung:
- 1. Bildung und Möglichkeit
- 1.1 Begründung der Themenwahl
- 1.2 Vorgehensweise
- Hauptteil:
- 2. Ermöglichung von Pädagogik als eigenständiger Wissenschaft
- 2.1 Systematik und Methodik der Pädagogik
- 2.2 Delegitimation der anthropologischen Begründung
- 2.3 Delegitimation der ethischen Begründung
- 2.4 Delegitimation der sozialisationstheoretischen Begründung
- 2.5 Grundzüge einer antithetischen Bildungskonzeption
- 2.6 Noologische Grundlegung: Die Transzendentalität des Denkens
- 3. Sozialisation: Die vermeintlich notwendige Wirklichkeit
- 3.1 Determination durchs Übliche: Soziale und historische A Priorität
- 3.1.1 Sozialisationslogik: Dialektik, Distinktion, Prädestination und Doxa
- 3.2 Der Zusammenhang zwischen Sozialisation und Bildung
- 3.1 Determination durchs Übliche: Soziale und historische A Priorität
- 4. Wege zur Ermöglichung von Bildung: Emanzipation und Partizipation
- 4.1 Emanzipation: Selbstkritisches Denken und Kontingenz
- 4.1.1 Skepsis und das Lernen verlernen
- 4.1.2 Möglichkeitsbedingungen der Wirklichkeitsauffassungen
- 4.1.3 Der pädagogische Umgang mit begrenzenden Auffassungsarten
- 4.2 Partizipation: Die gedankliche Vergangenheit als neue Zukunft
- 4.2.1 Erkennen und Ermessen als menschliche Grundvollzüge
- 4.2.2 Befähigungen durch gedankliche Teilhabe: Erdenken und Ermessen
- 4.2.2.1 Spezifizierung des Ermessensbegriffs
- 4.1 Emanzipation: Selbstkritisches Denken und Kontingenz
- 5. Konturen der erreichten Möglichkeiten: „Selbständigkeit im Denken“
- 5.1 Sechs Kennzeichen von Bildung
- 6. Rückblick: Theodor Ballauffs Bildungslehre als Möglichkeitstheorie
- 2. Ermöglichung von Pädagogik als eigenständiger Wissenschaft
- Die Ermöglichung von Pädagogik als eigenständige Wissenschaft
- Die Delegitimation verschiedener Begründungsansätze für Pädagogik
- Der Zusammenhang zwischen Sozialisation und Bildung
- Emanzipation und Partizipation als Wege zur Ermöglichung von Bildung
- Die Konturen der erreichten Möglichkeiten im Kontext von Bildung
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Bildungsbegriff in den Kontext des öffentlich-politischen Diskurses und grenzt ihn vom philosophisch-pädagogischen Themenfeld ab. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Bildungsproblems von der Antike bis zur Gegenwart und führt die zentrale Figur Theodor Ballauff ein.
- 2. Ermöglichung von Pädagogik als eigenständiger Wissenschaft: Dieses Kapitel untersucht die Systematik und Methodik der Pädagogik und analysiert die Delegitimation verschiedener Begründungsansätze, darunter anthropologische, ethische und sozialisationstheoretische Ansätze. Es skizziert die Grundzüge einer antithetischen Bildungskonzeption und beleuchtet die noologische Grundlegung der Transzendentalität des Denkens.
- 3. Sozialisation: Die vermeintlich notwendige Wirklichkeit: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Determination durchs Übliche, der Sozialisationslogik und dem Zusammenhang zwischen Sozialisation und Bildung.
- 4. Wege zur Ermöglichung von Bildung: Emanzipation und Partizipation: Dieses Kapitel untersucht Emanzipation als Selbstkritisches Denken und Kontingenz sowie Partizipation als die gedankliche Vergangenheit als neue Zukunft. Es analysiert die Rolle von Erkennen und Ermessen als menschliche Grundvollzüge und die Befähigungen durch gedankliche Teilhabe.
- 5. Konturen der erreichten Möglichkeiten: „Selbständigkeit im Denken“: Dieses Kapitel beleuchtet die sechs Kennzeichen von Bildung und zeigt auf, wie Bildung zu "Selbständigkeit im Denken" führt.
- 6. Rückblick: Theodor Ballauffs Bildungslehre als Möglichkeitstheorie: Dieses Kapitel bietet einen Rückblick auf Theodor Ballauffs Bildungslehre und interpretiert sie als Möglichkeitstheorie.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit Theodor Ballauffs Bildungslehre und analysiert sie aus einer neuen Perspektive. Sie untersucht die Ermöglichung von Pädagogik als eigenständige Wissenschaft und analysiert die Delegitimation verschiedener Begründungsansätze, darunter anthropologische, ethische und sozialisationstheoretische Ansätze. Weiterhin werden die Themen Sozialisation, Emanzipation, Partizipation und die Konturen der erreichten Möglichkeiten im Kontext von Bildung beleuchtet.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Pädagogik und Bildungstheorie, darunter die Ermöglichung von Pädagogik als eigenständige Wissenschaft, die Delegitimation verschiedener Begründungsansätze, Sozialisation, Emanzipation, Partizipation und die Konturen der erreichten Möglichkeiten. Wichtige Konzepte sind die Transzendentalität des Denkens, Selbstkritisches Denken, Kontingenz, Erkennen und Ermessen sowie die Selbständigkeit im Denken.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Theodor Ballauff?
Theodor Ballauff (1911-1995) war ein Mainzer Bildungstheoretiker, der Pädagogik als eigenständige Wissenschaft auf Basis des Denkens begründete.
Was versteht Ballauff unter dem Begriff "Bildung"?
Bildung wird bei Ballauff als „Selbständigkeit im Denken“ definiert, die über bloße Sozialisation hinausgeht.
Welche Rolle spielt das "Denken" in seiner Theorie?
Das Denken ist die unumgängliche Möglichkeitsbedingung unserer Selbst- und Weltauffassung und bildet das Fundament einer autonomen Pädagogik.
Wie unterscheidet sich Bildung von Sozialisation?
Während Sozialisation die Anpassung an die „notwendige Wirklichkeit“ und das Übliche beschreibt, ermöglicht Bildung die Emanzipation und das kritische Hinterfragen dieser Strukturen.
Was sind die "Möglichkeitsbedingungen" der Bildung?
Dazu gehören die Befähigung zum Erdenken und Ermessen sowie die Überwindung begrenzender Auffassungsarten durch Skepsis.
- Citation du texte
- Mario Stenz (Auteur), 2009, Bildung und Möglichkeit , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151007