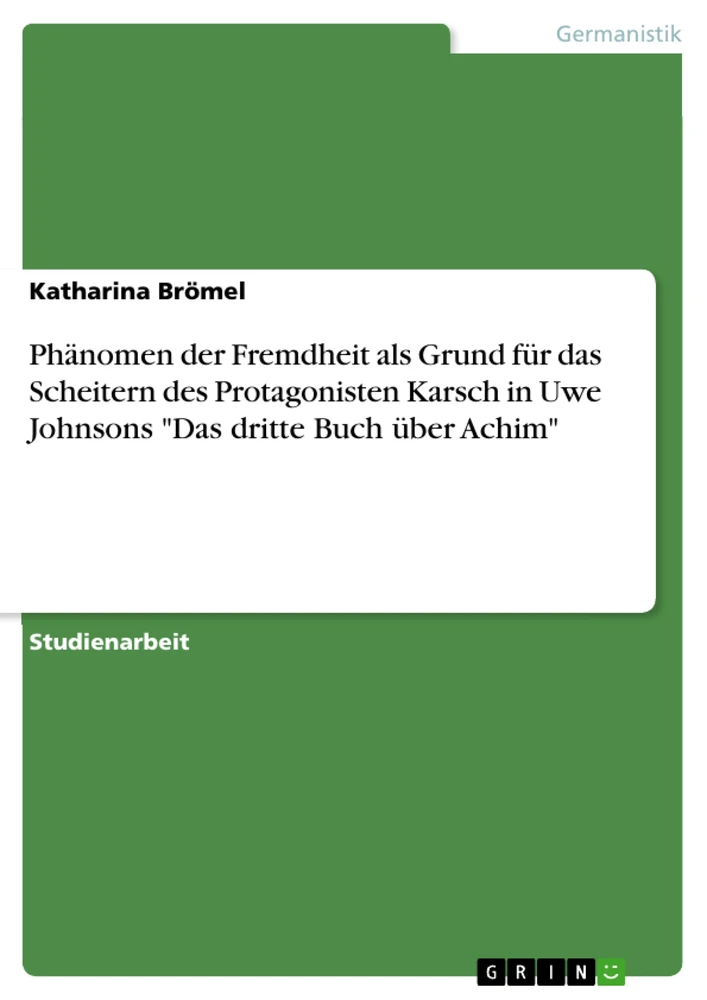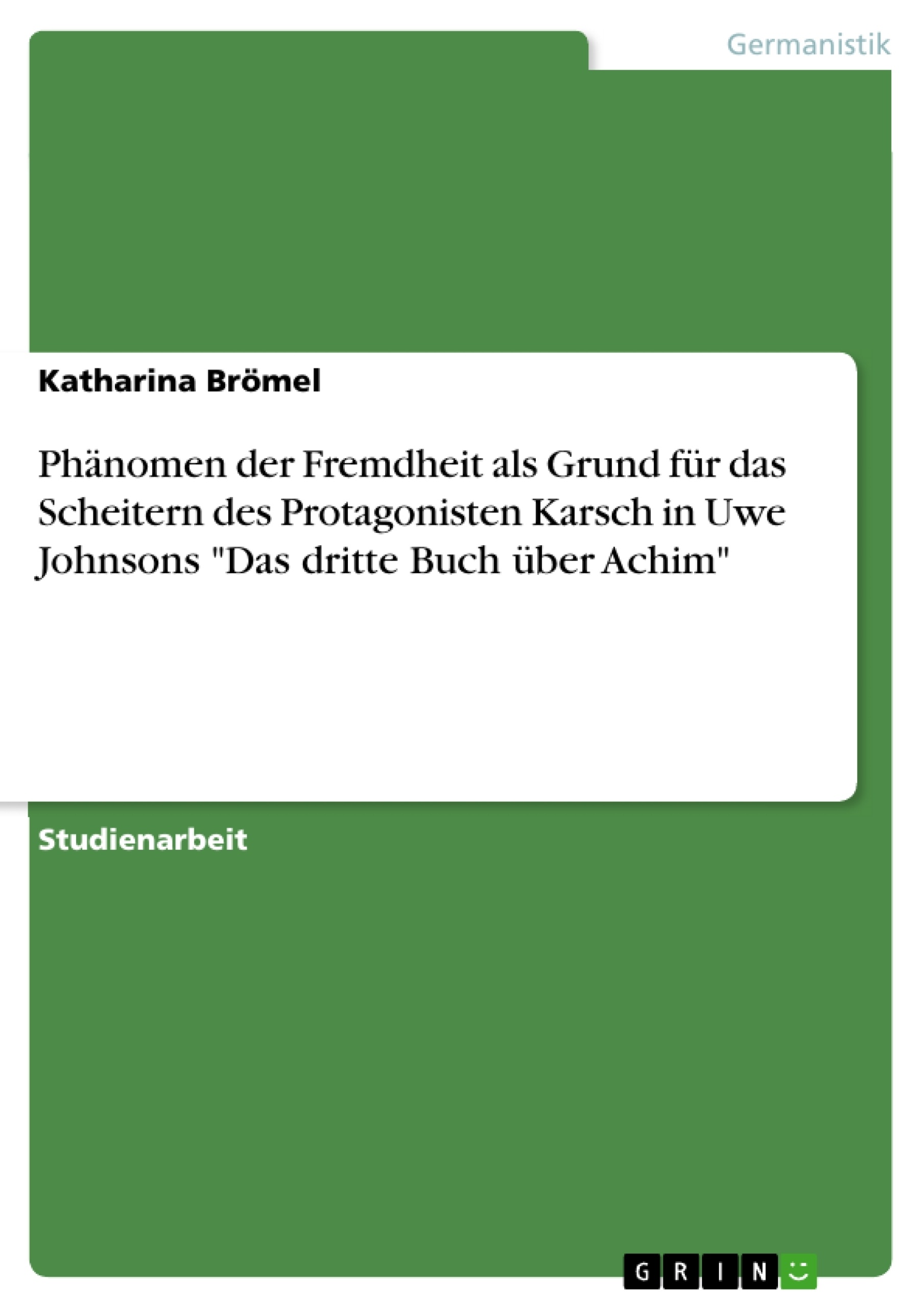Die Teilung Deutschlands ist einer der prägendsten Einschnitte in der Geschichte des Landes, dauerte dieser Zustand der zwei Staaten doch mehrere Jahrzehnte. Obwohl beide die gleiche
Vergangenheit hatten, entwickelten sie sich, vor allem aufgrund der verschiedenen Besatzungsmächte und deren unterschiedlichen Ideologien, in zwei verschiedene Richtungen.
Diese Differenzen und vor allem die Menschen in Ost- und Westdeutschland stellt Uwe Johnson in seinem zweiten Buch „Das dritte Buch über Achim“ (DBA) in den Mittelpunkt. Da er
selbst vom Osten in den Westen Berlins umzog, verfügte er über eine große Menge an Einsichten und Erfahrungen. Er ist auch einer der ersten gewesen, die das Thema der Grenzproblematik
literarisch umgesetzt haben. Schnell wurde er zu dem deutschen Schriftsteller, der als 'Dichter des geteilten Deutschlands' galt, da die Teilung dieses Landes (seines Landes) immer der
Ausgangspunkt für seine Romane gewesen ist.
Deswegen ist es besonders interessant, das Phänomen der Fremdheit im vorliegenden Buch zu betrachten und auch seine Ursachen und Wirkungen, da die Hauptpersonen stellvertretend für Tausende andere Deutsche zu dieser Zeit stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ein Land – zwei Staaten: Fremdheit in BRD und DDR.
- Das Straßenbild
- Die Sprache
- Das Fremde zwischen den Menschen
- Ost vs. West: Achim und Karsch
- Einheimisch und doch fremd: Karin
- Karschs Bemühungen um Verständnis
- Wie die Fremdheit zum Scheitern führt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Phänomen der Fremdheit als zentralen Faktor für das Scheitern des Protagonisten Karsch in Uwe Johnsons „Das dritte Buch über Achim“. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Differenzen zwischen der BRD und DDR, die sich durch die Teilung Deutschlands und die verschiedenen Besatzungsmächte entwickelten. Die Arbeit beleuchtet, wie diese Unterschiede in Form von Straßenbildern, Sprache und menschlichen Interaktionen die Wahrnehmung und das Verständnis des jeweils „anderen“ Deutschlands beeinflussen.
- Fremdheitserfahrungen des Protagonisten Karsch in der DDR
- Die Bedeutung des Straßenbildes als Symbol für die Unterschiede zwischen Ost und West
- Die sprachlichen Barrieren und Missverständnisse zwischen den beiden Deutschen Staaten
- Die Rolle der menschlichen Interaktionen und Begegnungen im Kontext der Fremdheit
- Die Folgen der Fremdheit für das Scheitern von Karsch
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der deutschen Teilung als prägenden Faktor für die Geschichte des Landes ein. Sie stellt Uwe Johnsons „Das dritte Buch über Achim“ als ein Werk vor, das die Differenzen zwischen Ost- und Westdeutschland thematisiert und die Fremdheit als zentrales Problem beleuchtet.
Kapitel 2 analysiert die Unterschiede zwischen BRD und DDR anhand des Straßenbildes und der Sprache. Karsch, der vom Westen in den Osten reist, nimmt die Unterschiede in der Umgebung und der Sprache wahr und interpretiert diese als Zeichen der Fremdheit. Auch Achim, der kurzzeitig die BRD besucht, empfindet die fremde Umgebung als unbequem.
Kapitel 3 untersucht das Thema der Fremdheit zwischen den Menschen. Die Beziehung zwischen Achim und Karsch wird als Beispiel für die Missverständnisse und Kommunikationsprobleme zwischen Ost und West betrachtet. Karin, eine weitere Figur, stellt die Ambivalenz von Eingebundenheit und Fremdheit dar. Karschs Bemühungen um Verständnis und Kommunikation mit den Menschen in der DDR werden analysiert.
Kapitel 4 befasst sich mit den Folgen der Fremdheit für Karsch und seine Handlungsweise.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Deutsche Teilung, Fremdheit, Straßenbild, Sprache, Interkulturelle Kommunikation, Ost-West-Beziehungen, Uwe Johnson, „Das dritte Buch über Achim“, Karsch, Achim, Karin.
- Citar trabajo
- Katharina Brömel (Autor), 2009, Phänomen der Fremdheit als Grund für das Scheitern des Protagonisten Karsch in Uwe Johnsons "Das dritte Buch über Achim", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151117