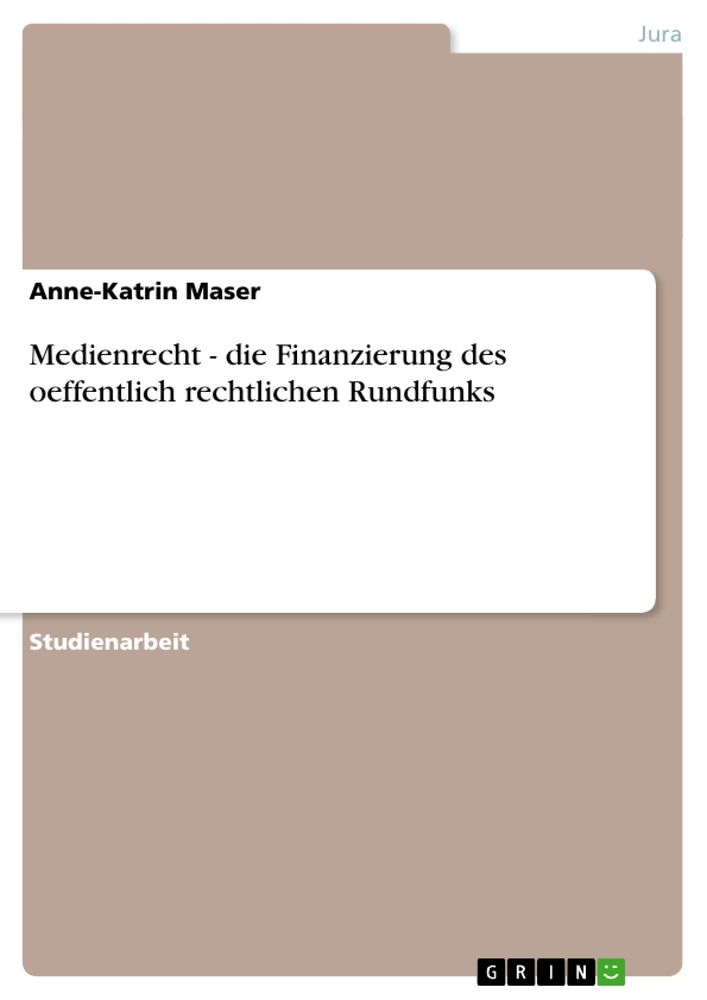Die öffentlich-rechtlichen, föderal strukturierten Rundfunkanstalten strahlen zwei bundesweite Vollprogramme, acht regionale Fernsehprogramme und über 60 Hörfunkprogramme aus. Hinzu kommen Beteiligungen an den europäischen Programmen Arte und 3sat, die Spartenkanäle Kinderkanal und Phoenix sowie das digitale Programmangebot. In meiner Arbeit werde ich zunächst die Funktion des öffentlichrechtlichen Rundfunks im dualen System darstellen. Im zweiten Kapitel erläutere ich dann die Ausgestaltung der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Zentraler Aspekt ist die Darstellung des Zusammenhangs zwischen dem Grundversorgungsauftrag und der Finanzierung. Ziel meiner Arbeit ist es zu erörtern, wie eine gesicherte Finanzausstattung der öffentlich-rechtlichen Anstalten auch in Zukunft erreicht werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im dualen System
- 1.1. Die Grundrechtsfähigkeit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
- 1.2. Die dynamische Grundversorgung
- 2. Die Rechtsgrundlagen der Gewährleistung einer funktionsgerechten Finanzierung
- 2.1. Umfang der Finanzierungspflicht des Staates
- 3. Finanzierungsmodell
- 3.1. Gebührenfinanzierung
- 3.2. Rechtsnatur der Rundfunkgebühr
- 3.3. Die Rundfunkgebührenentscheidung des Bundesverfassungsgerichts
- 3.4. Mischfinanzierung
- 4. Wie kann die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Zukunft gesichert werden?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Bundesrepublik Deutschland. Ziel ist es, die Funktionsweise des Finanzierungsmodells zu erklären und zu erörtern, wie eine gesicherte Finanzausstattung der öffentlich-rechtlichen Anstalten auch in Zukunft erreicht werden kann.
- Die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im dualen System
- Die Grundrechtsfähigkeit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
- Die Rechtsgrundlagen der Finanzierungspflicht des Staates
- Das Finanzierungsmodell, insbesondere die Gebührenfinanzierung
- Zukunftsperspektiven für die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im dualen System und die Notwendigkeit einer gesicherten Finanzierung dar.
- Kapitel 1: Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im dualen System: Dieses Kapitel behandelt die Grundrechtsfähigkeit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sowie die Bedeutung des Rundfunks für den Meinungs- und Willensbildungsprozess in der Gesellschaft.
- Kapitel 2: Die Rechtsgrundlagen der Gewährleistung einer funktionsgerechten Finanzierung: Dieses Kapitel erläutert die Finanzierungspflicht des Staates für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den Zusammenhang zwischen dem Grundversorgungsauftrag und der Finanzierung.
- Kapitel 3: Finanzierungsmodell: Dieses Kapitel beschreibt das aktuelle Finanzierungsmodell des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, insbesondere die Gebührenfinanzierung, und untersucht die Rechtsnatur der Rundfunkgebühr. Es behandelt auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Rundfunkgebühr sowie alternative Finanzierungsmodelle wie die Mischfinanzierung.
Schlüsselwörter
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, duales System, Grundrechtsfähigkeit, Rundfunkfreiheit, Grundversorgung, Finanzierung, Gebührenfinanzierung, Mischfinanzierung, Bundesverfassungsgericht, Meinungsbildung, Medienrecht, Medienpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland finanziert?
Die Finanzierung erfolgt primär über Rundfunkgebühren (heute Rundfunkbeitrag) sowie durch eine begrenzte Mischfinanzierung aus Werbeeinnahmen.
Was bedeutet der Begriff „Grundversorgung“?
Die Grundversorgung verpflichtet die öffentlich-rechtlichen Anstalten, ein breites Programmangebot für alle Bevölkerungskreise bereitzustellen, das Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung umfasst.
Warum ist die staatliche Finanzierungspflicht rechtlich verankert?
Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass der Staat verpflichtet ist, die Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch eine angemessene Finanzierung zu sichern, um dessen Unabhängigkeit zu gewährleisten.
Was ist das „duale System“ im deutschen Rundfunk?
Es bezeichnet das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichem Rundfunk (gebührenfinanziert) und privatem Rundfunk (werbefinanziert), die unterschiedlichen rechtlichen Anforderungen unterliegen.
Wie kann die Finanzierung in Zukunft gesichert werden?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Modelle, um die steigenden Kosten und die digitale Transformation abzufangen, während die Unabhängigkeit von politischer Einflussnahme gewahrt bleibt.
- Quote paper
- Anne-Katrin Maser (Author), 2003, Medienrecht - die Finanzierung des oeffentlich rechtlichen Rundfunks, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15177