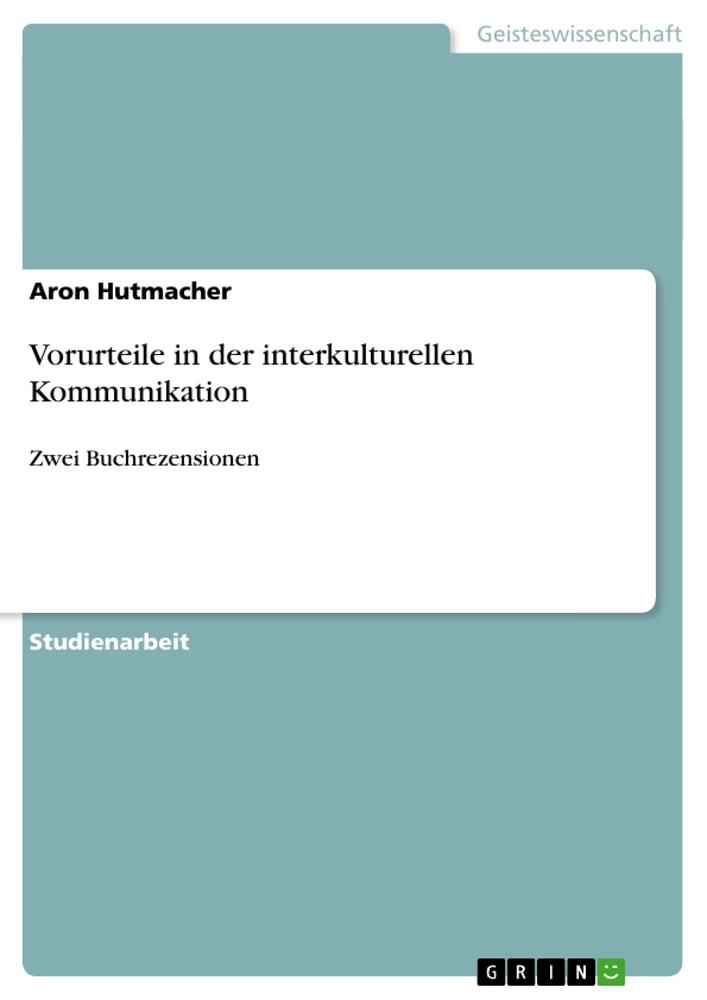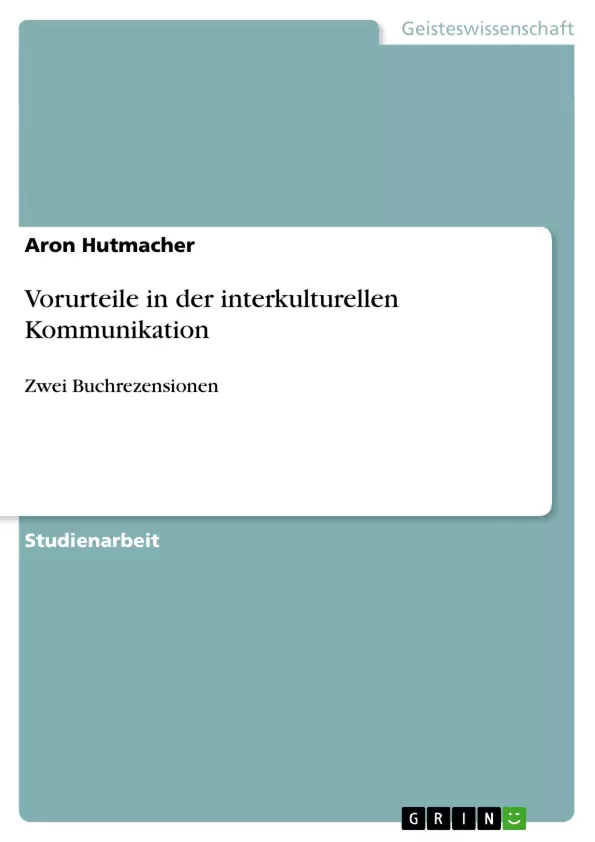Thema: Vorurteile in der interkulturellen Kommunikation
„Menschen, wenn sie sich in einem Wald befinden, sehen sie keinen Wald, sie sehen das, was sie von dem Wald bereits wissen.“ (Rösch, S. 64)
Rezension I
Rösch, Olga (Hrsg.): Stereotypisierung des Fremden. Auswirkungen in der Kommunikation
Dieses Buch fasst die Denkansätze verschiedener Autoren zusammen, die sich mit den Problemen der interkulturellen Kommunikation auseinandersetzen. Dabei wird deutlich, dass für einen toleranten und verständnisvollen Umgang mit fremden Kulturen eine gewisse Kenntnis über das Vorhandensein von Einstellungen, Vorurteilen und Stereotypen, die mitunter unseren noch so guten Willen untergraben können, von Vorteil sein kann. Das Buch vermittelt eher die Suche nach neuen Wegen, die die Forschung der interkulturellen Kommunikation vorantreiben, um Differenzen
zwischen unterschiedlichen Kulturen verstehen zu können und bessere Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. So gliedert sich das Buch in zwei Teile, indem zunächst der Forschungsstand der Stereotypenbildung beschrieben wird, um im folgenden Abschnitt konkrete Beispiele zu liefern, die sich mit dem Umgang von Stereotypen bei dem Aufeinandertreffen zweier Kulturen beschäftigen. Der in das Thema einführende Text wurde von Alexander Thomas erstellt, dessen Wirken in der interkulturellen Forschung bereits wichtige Anstöße gab. Ein unzureichendes Vorgehen im interkulturellen Austausch ist seiner Meinung nach der intensivere Kontakt zwischen unterschiedlichen Gruppen, welcher vorhandene Vorurteile durch das Entdecken von
Gemeinsamkeiten beseitigen kann („Kontakthypothese“). Es besteht nämlich dennoch die Möglichkeit, dass Vorurteile bewusst bestätigt, bzw. verfestigt werden. Thomas verweist darauf,
dass Vorurteile als „[...] eine bestimmte Unterkategorie sozialer Einstellungen“ (S. 14) verstanden werden sollten, wobei die Alltagssprache die Kategorie Vorurteil meist nur im negativen Sinne verwendet. Die psychologische Vorurteilsforschung geht davon aus, dass Vorurteile, unabhängig ob positiv oder negativ gefärbt, emotionale Werturteile eines Menschen sind, dem es objektiv jedoch an Wissen fehlt, damit dieses Urteil in der Realität auch standhält. „Damit bezieht sich der Vorurteilsbegriff auf die Vielfalt unseres naiven, alltäglichen und selbstverständlichen Urteilsverhaltens“ (S. 15).
Inhaltsverzeichnis
- Stereotypisierung des Fremden. Auswirkungen in der Kommunikation
- Vorurteile und Stereotype in der interkulturellen Kommunikation
- Stereotype und Vorurteile: Definitionen und Funktionen
- Stereotype in der deutsch-polnischen Kommunikation
- Stereotype im Internet: Kulturelle Muster im Webdesign
- Stereotype in der Werbung: Russische Werbung im Vergleich
- Interkulturelle Kommunikation: Praktische Hilfestellungen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch „Stereotypisierung des Fremden. Auswirkungen in der Kommunikation“ befasst sich mit den Herausforderungen der interkulturellen Kommunikation und analysiert die Rolle von Vorurteilen und Stereotypen in diesem Kontext. Es untersucht die Entstehung, Funktionen und Auswirkungen von Stereotypen in verschiedenen Bereichen, wie der deutsch-polnischen Kommunikation, dem Internet und der Werbung.
- Die Entstehung und Funktionen von Vorurteilen und Stereotypen
- Die Auswirkungen von Stereotypen auf die interkulturelle Kommunikation
- Die Rolle von Stereotypen in verschiedenen kulturellen Kontexten
- Praktische Hilfestellungen für den interkulturellen Austausch
- Die Bedeutung von interkultureller Kompetenz für eine tolerante und verständnisvolle Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorurteile und Stereotype in der interkulturellen Kommunikation
- Stereotype und Vorurteile: Definitionen und Funktionen
- Stereotype in der deutsch-polnischen Kommunikation
- Stereotype im Internet: Kulturelle Muster im Webdesign
- Stereotype in der Werbung: Russische Werbung im Vergleich
- Interkulturelle Kommunikation: Praktische Hilfestellungen
Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Vorurteilen und Stereotypen in der interkulturellen Kommunikation. Es wird erläutert, wie Vorurteile als emotionale Werturteile entstehen und welche Funktionen sie erfüllen. Der Autor Alexander Thomas diskutiert die „Kontakthypothese“ und ihre Grenzen, um die Herausforderungen im interkulturellen Austausch zu verdeutlichen.
Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und den Funktionen von Stereotypen. Die Autorin Magdalena Roclawski erklärt, wie Stereotype in der sozialen Kategorisierung entstehen und welche Rolle sie in der Kommunikation spielen. Sie beleuchtet die These von Putnam, die den Stereotypengebrauch im sprachwissenschaftlichen Sinne als Mittel der Verständigung betrachtet.
Dieses Kapitel analysiert stereotype Äußerungen im deutsch-polnischen Kontext. Roclawski untersucht empirisches Material, um die Stereotypen auf deutscher und polnischer Seite zu beleuchten und deren Ursachen im historischen Kontext zu erklären. Die Analyse zeigt die klare Gegenüberstellung zwischen Eigen- und Fremdgruppe und die Rolle der politischen Konfliktlage in der Stereotypenbildung.
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Stereotypisierungen im Kontext des Internets. Die Autorin Ursula Wrobel untersucht kulturelle Muster im Webdesign und zeigt auf, wie die fehlende Berücksichtigung der Kulturabhängigkeit die Kommunikation zwischen Nationen stören kann. Sie analysiert die Bedeutung von Ethnozentrismus im Webdesign und die Herausforderungen, die sich aus der Subjektivität des Betrachters ergeben.
Dieses Kapitel analysiert Stereotype in der Werbung, insbesondere in der russischen Werbung. Der Autor Edgar Hoffman erläutert die erhöhte Werbewirksamkeit von Stereotypen und die Bedeutung der ethnischen Mythologisierung von Waren. Er diskutiert die Unterschiede zwischen russischer und europäischer Werbung und die Rolle der Werbung in der gesellschaftlichen Manifestierung von Stereotypen.
Dieses Kapitel bietet praktische Hilfestellungen für den interkulturellen Austausch. Die Autorin Nazarkiewicz erläutert, wie sich Stereotype von allgemeinen Kategorienbildungen unterscheiden und wie sie in der Kommunikation erkannt und gemanagt werden können. Sie stellt die methodische „Konversationsanalyse“ vor, um Interaktionsmuster in natürlichen Gesprächen zu analysieren und die emotionale Komponente von Stereotypen zu verstehen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Vorurteile, Stereotype, interkulturelle Kommunikation, deutsch-polnische Beziehungen, Internet, Werbung, Ethnozentrismus, Kulturabhängigkeit, Konversationsanalyse und interkulturelle Kompetenz.
- Citation du texte
- Aron Hutmacher (Auteur), 2009, Vorurteile in der interkulturellen Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151835