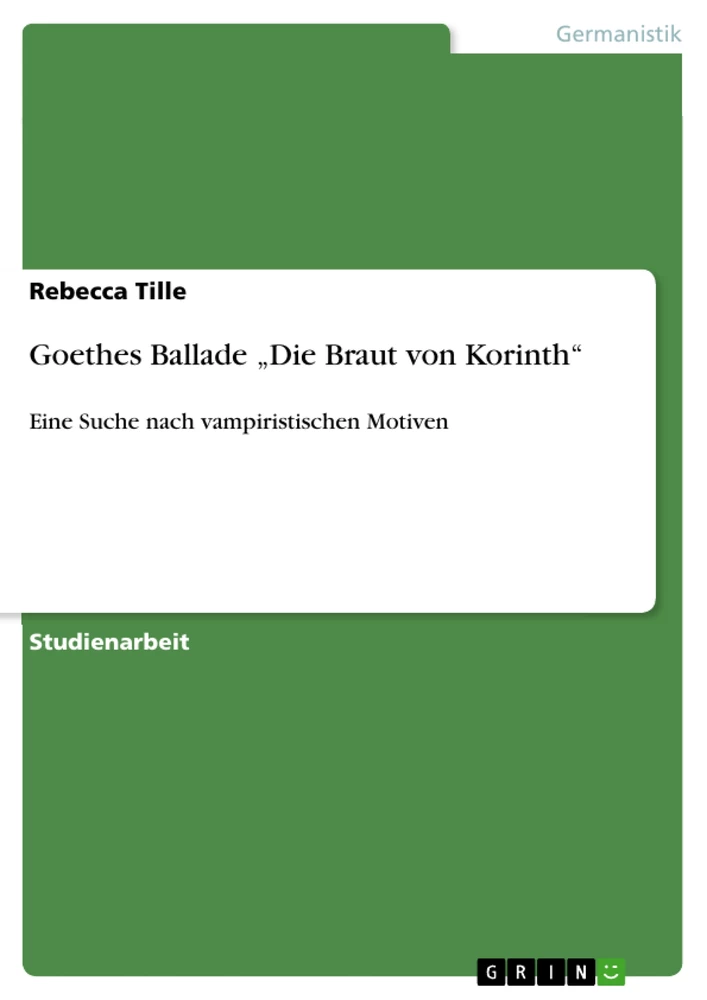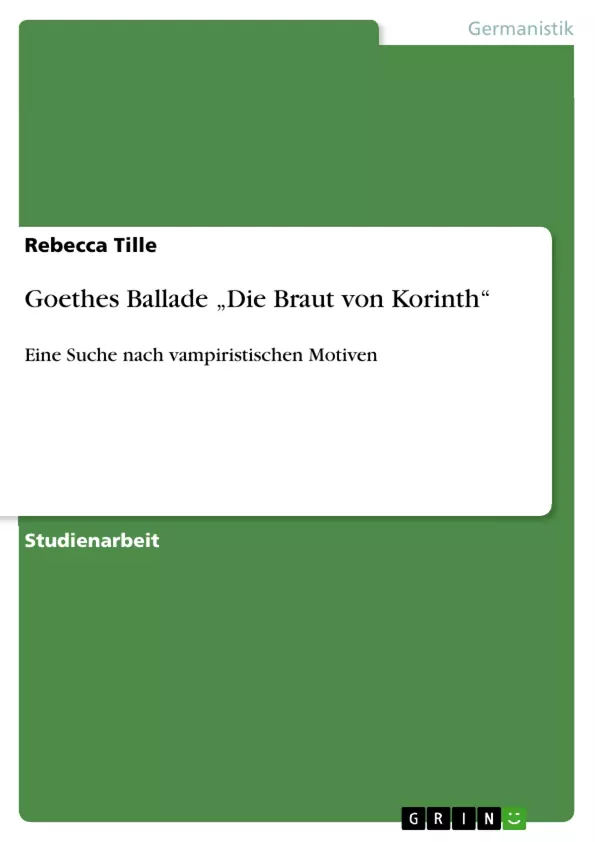Während des 18. Jh. fand das Vampirgenre bei den Literaten nur wenig Anklang. „Erst als sich das Jahrhundert seinem Ende zuneigte, fühlten sich die Künstler und Dichter von der Tiefe und Abgründigkeit des Vampirthemas angezogen.“ Es erschien Johann Wolfgang von Goethes Gedicht Die Braut von Korinth (1797).
„In Goethes Braut von Korinth plädiert ein reizender weiblicher Vampir für größere religiöse Toleranz und sinnliche Freizügigkeit und droht im Verstocktheitsfall den Ausbruch einer erotischen Epidemie an: ‚Und das junge Volk erliegt der Wut‘.“
Im Vordergrund der Analyse steht die Aufgabe, vampiristische Motive innerhalb des Gedichtes herauszuarbeiten.
Die Forschungsliteratur ist sich nicht einig darüber, ob für Goethe beim Verfassen seines Werkes das Vampirthema im Vordergrund stand oder die antike Sage aus dem "Buch der Wunder" Phlegon Aelius von Tralles. Es sollen die zeitgenössischen Vorstellungen des Vampirismus im 18. Jh. vorgestellt werden. Worin besteht der Vampirmythos überhaupt? Der Vampir soll nicht allein eine Darstellung hinsichtlich des Aberglaubens als Nachzehrer oder Wiedergänger erfahren, sondern auch Verwandtschaftsformen wie die Femme fatale u. die Femme fragile werden beleuchtet. Inwiefern gestaltete Goethe sein Vampirmädchen im Vergleich zu den derzeitigen Vorbildern um?
Innerhalb dieser Arbeit sollen antike Quellen herangezogen werden, welche Goethe womöglich hinsichtlich seines Werkes beeinflusst haben. Neben Phlegons Gespenstergeschichte könnte sich Goethe ebenso an den mytholog. Lamien orientiert haben.
Im Zentrum der Untersuchung steht allerdings die ausführliche Herausarbeitung des Vampirmotivs im Hinblick seiner Funktion in Goethes Ballade. Da die Annahme besteht, dass er in seinem Tagebuch seine Braut von Korinth nicht umsonst als „Vampyrisches Gedicht“ bezeichnete, gilt es vorwiegend das Aussagevolumen des Vampirmythos innerhalb der Goetheschen Ballade einzuschätzen.
Zuletzt werden kontrastierende Interpretationsansätze vorgestellt. Der Literaturwissenschaft galt der vampirische Stoff meist als zu trivial und sie kritisierte die geringe künstlerische Dignität. Er musste an etwas Geistiges angeknüpft werden und Goethes Vampirmädchen galt nicht allein als tragische Figur, sondern wurde zum Medium der Goetheschen Gesellschaftskritik instrumentalisiert. Daher scheint es umso interessanter, neuere Deutungen ins Auge zu fassen, welche das Vampirische der Braut ins Zentrum rücken.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- VAMPIRISMUS IM 18. JAHRHUNDERT
- DER VAMPIRMYTHOS
- GOETHES VAMPIRERFAHRUNGEN
- ANTIKE QUELLEN DER GOETHESCHEN BRAUT VON KORINTH
- DER VAMPIR IN GOETHES BALLADE DIE BRAUT VON KORINTH
- KONTRASTIERENDE INTERPRETATIONSANSÄTZE
- FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert Goethes Ballade „Die Braut von Korinth“ im Hinblick auf vampiristische Motive. Ziel ist es, die Rolle des Vampirmythos in der Ballade zu beleuchten und zu untersuchen, wie Goethe diesen Mythos in seinen literarischen Kontext einbettet. Die Arbeit befasst sich mit den zeitgenössischen Vorstellungen des Vampirismus im 18. Jahrhundert, den antiken Quellen, die Goethe möglicherweise beeinflusst haben, und der Funktion des Vampirmotivs in der Ballade selbst.
- Vampirmythos im 18. Jahrhundert
- Antike Quellen der Ballade
- Vampirmotiv in Goethes „Die Braut von Korinth“
- Kontrastierende Interpretationsansätze
- Die Braut von Korinth als Femme fatale
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt die zentrale Fragestellung nach der Rolle des Vampirmythos in Goethes „Die Braut von Korinth“ vor. Sie beleuchtet die Rezeption des Vampirthemas im 18. Jahrhundert und die Besonderheit von Goethes Werk in diesem Kontext.
Das Kapitel „Vampirismus im 18. Jahrhundert“ beschäftigt sich mit den zeitgenössischen Vorstellungen des Vampirmythos. Es werden die Merkmale des Vampirs als Nachzehrer und Wiedergänger sowie die verbreiteten Aberglauben und Mythen rund um den Vampirismus dargestellt. Die sexuelle Dimension des Vampirmythos wird ebenfalls beleuchtet.
Das Kapitel „Antike Quellen der Goetheschen Braut von Korinth“ untersucht mögliche antike Quellen, die Goethe bei der Entstehung seiner Ballade beeinflusst haben könnten. Hierbei werden die mythologischen Lamien, die Korintherbriefe des Apostels Paulus und die Gespenstergeschichte des griechischen Schriftstellers Phlegon Aelius von Tralles betrachtet.
Das Kapitel „Der Vampir in Goethes Ballade Die Braut von Korinth“ analysiert die Funktion des Vampirmotivs in der Ballade. Es werden die vampirischen Eigenschaften der Braut von Korinth herausgearbeitet und in Bezug zu den zeitgenössischen Vorstellungen des Vampirismus gesetzt. Die Diskrepanz von Heidentum und Christentum in der Ballade wird ebenfalls beleuchtet.
Das Kapitel „Kontrastierende Interpretationsansätze“ stellt verschiedene Interpretationsansätze zur „Braut von Korinth“ vor. Es werden geistesgeschichtliche und sozialkritische Ansätze betrachtet und die unterschiedlichen Deutungen des Vampirmotivs in der Ballade diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Vampirmythos, die Braut von Korinth, Goethes Ballade, Schwarze Romantik, antike Quellen, Femme fatale, Heidentum und Christentum, Interpretationsansätze.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt der Vampirismus in Goethes „Die Braut von Korinth“?
In der Ballade wird das Vampirmotiv genutzt, um Themen wie religiöse Toleranz und sinnliche Freizügigkeit zu behandeln. Das „Vampirmädchen“ fungiert dabei als Medium für Goethes Gesellschaftskritik.
Welche antiken Quellen beeinflussten Goethe bei diesem Werk?
Goethe orientierte sich vermutlich an der Gespenstergeschichte von Phlegon Aelius von Tralles sowie an mythologischen Erzählungen über Lamien und den Korintherbriefen des Apostels Paulus.
Wie wird das Vampirmädchen im Vergleich zur zeitgenössischen Literatur dargestellt?
Goethe gestaltete seine Figur komplexer als die damaligen Vorbilder des Aberglaubens. Sie vereint Züge der Femme fatale und der Femme fragile und dient als tragische Figur der Kritik am Christentum.
Was ist der zentrale Konflikt in der Ballade?
Ein wesentlicher Aspekt ist die Diskrepanz zwischen Heidentum und Christentum, die durch die Begegnung der Braut mit ihrem Bräutigam und die Intervention der Mutter verdeutlicht wird.
Warum bezeichnete Goethe das Gedicht als „vampyrisch“?
Goethe nutzte den Begriff in seinem Tagebuch, um den düsteren, grenzüberschreitenden Charakter des Stoffes zu unterstreichen, der weit über den bloßen Volksaberglauben hinausging.
- Citar trabajo
- Rebecca Tille (Autor), 2010, Goethes Ballade „Die Braut von Korinth“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151868